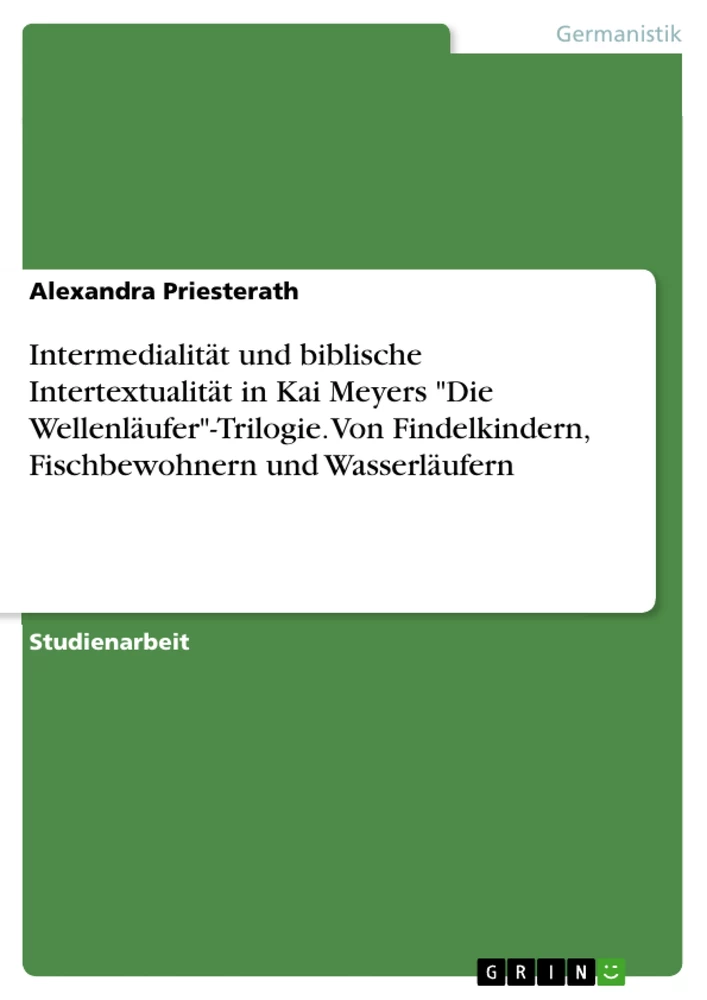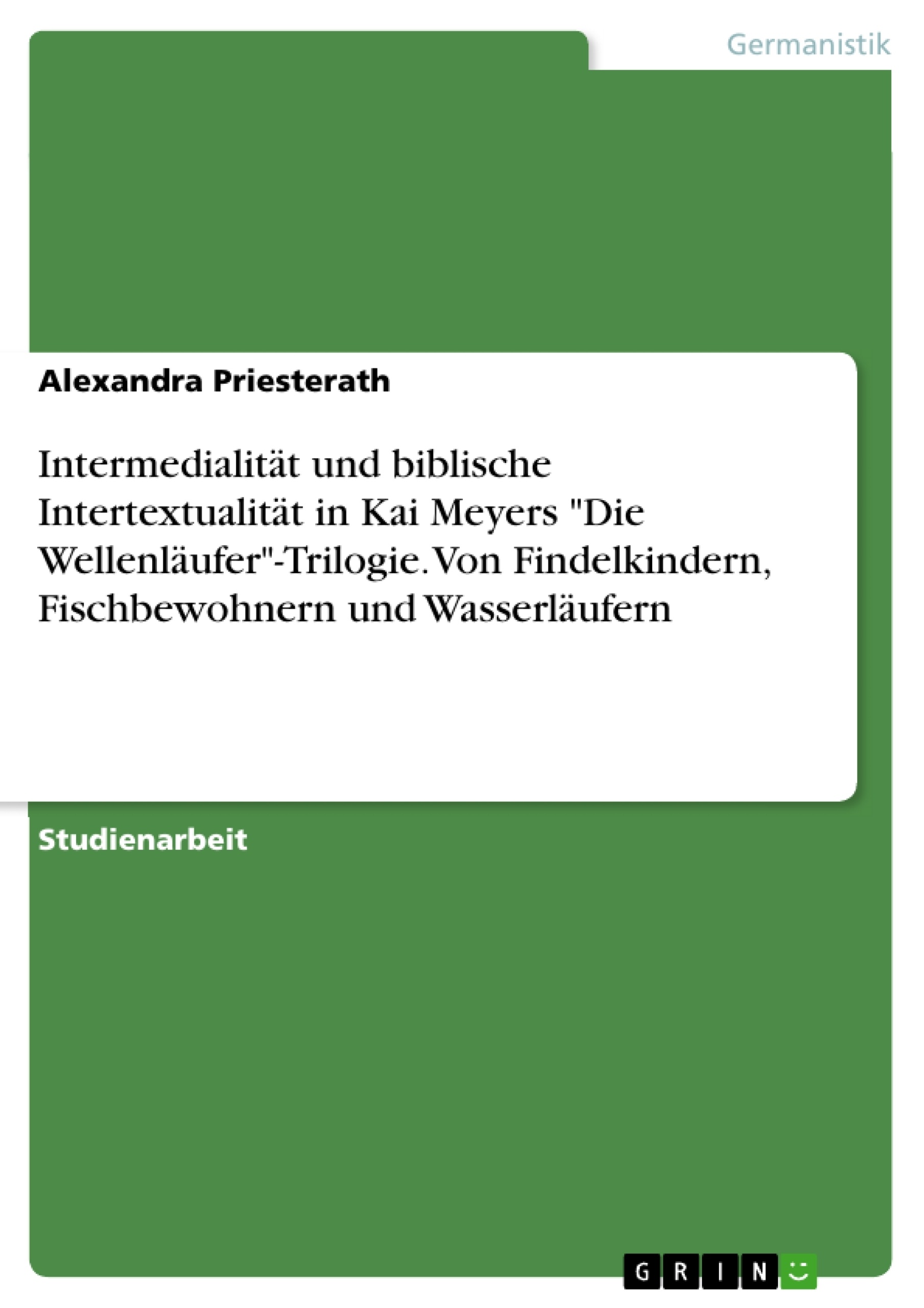Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Intermedialität und biblischen Intertextualität in Kai Meyers "Wellenläufer"-Trilogie. Sie analysiert die biblischen intertextuellen Bezüge der Trilogie auf drei Motive (Findelkind, Wasserlaufen, Fischbewohner) unter Verwendung der genettschen Terminologie. Es soll gezeigt werden, dass Meyer nicht an eine originalgetreue Wiedergabe der Intertexte in seinen Werken gebunden ist und biblische Motive zugunsten seiner fantastischen Handlung modifizierte, erweiterte und psychologisierte.
Kai Meyer (geboren 1969), ein deutscher Schriftsteller, Journalist und Drehbuchautor, veröffentlichte von 2003 ("Die Wellenläufer") bis 2004 ("Die Muschelmagier", "Die Wasserweber") seine fantastische über 1000-seitige "Wasserläufer"-Trilogie, die in 25 Sprachen übersetzt wurde. Bisher wurden weder Kai Meyer als Autor noch seine Werke erforscht, allerdings ist das Genre der Phantastik ein umfangreiches Forschungsgebiet der Kinder- und Jugendliteratur.
Als offensichtliche Quellen für die Trilogie dienten griechisch-römische Mythen, Märchen, die Bibel, indische sowie südamerikanische Gottheiten und historische Werke über karibische Piraten und das Erdbeben von 1692 in Port Royal, wobei die Quellen noch im Detail erforscht werden müssten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung (Autor, Quellen, Forschungsüberblick)
- Zum Medienverbund der Wellenläufer-Trilogie
- Intertextualität nach Genette
- Biblische Intertextualität
- Die Findelkinder: Moses, Jolly und Munk
- Die Wasserläufer: Jesus, Jolly, Munk, Acherus, Aina, Klabauterherr
- Die Fischbewohner: Jonas, Griffin und der Mönch Ebenezer
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die biblischen Intertextualitäten in Kai Meyers Wellenläufer-Trilogie, um zu zeigen, wie der Autor biblische Motive in seinen fantastischen Handlungsverlauf integriert. Dabei wird die Intertextualitätstheorie von Gérard Genette als theoretischer Rahmen verwendet.
- Die Verwendung biblischer Motive in der Trilogie
- Die Intertextualitätstheorie von Genette
- Die Modifizierung und Erweiterung biblischer Motive durch Meyer
- Die Rolle der Findelkinder, Wasserläufer und Fischbewohner in der Trilogie
- Der Medienverbund der Wellenläufer-Trilogie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert den Autor Kai Meyer, die Quellen der Trilogie und den Forschungsstand zu phantastischer Literatur. Des Weiteren wird der Medienverbund der Wellenläufer-Trilogie vorgestellt. Das Kapitel 1.2 erläutert die Intertextualitätstheorie von Gérard Genette, die als Grundlage für die Analyse der biblischen Intertextualitäten in der Trilogie dient.
Kapitel 2 beleuchtet die biblischen Intertextualitäten in der Trilogie anhand von drei Motiven: Findelkind, Wasserlaufen und Fischbewohner. Es werden die entsprechenden biblischen Figuren und Geschichten vorgestellt und deren Beziehung zu den Figuren und Handlungssträngen der Trilogie dargestellt.
Schlüsselwörter
Kai Meyer, Wellenläufer-Trilogie, Phantastik, Kinder- und Jugendliteratur, Intertextualität, Biblische Intertextualität, Genette, Findelkind, Wasserlaufen, Fischbewohner, Medienverbund, Hörbuch, Comic, Hörspiel.
Häufig gestellte Fragen
Welche biblischen Motive nutzt Kai Meyer in "Die Wellenläufer"?
Zentrale Motive sind das Findelkind (Moses-Bezug), das Wasserlaufen (Jesus-Bezug) und die Fischbewohner (Jonas-Bezug).
Wie wird Intertextualität in der Arbeit definiert?
Die Analyse basiert auf der genettschen Terminologie zur Untersuchung von Bezügen zwischen verschiedenen Texten.
Wie verändert Kai Meyer die biblischen Vorlagen?
Meyer modifiziert, erweitert und psychologisiert die biblischen Motive zugunsten seiner fantastischen Handlung.
Welche weiteren Quellen dienten der Trilogie?
Neben der Bibel dienten griechisch-römische Mythen, Märchen sowie historische Fakten über Piraten und Port Royal als Quellen.
Gehört die Trilogie zu einem Medienverbund?
Ja, zur "Wellenläufer"-Welt gehören neben den Büchern auch Hörbücher, Hörspiele und Comics.
- Quote paper
- Alexandra Priesterath (Author), 2020, Intermedialität und biblische Intertextualität in Kai Meyers "Die Wellenläufer"-Trilogie. Von Findelkindern, Fischbewohnern und Wasserläufern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/984876