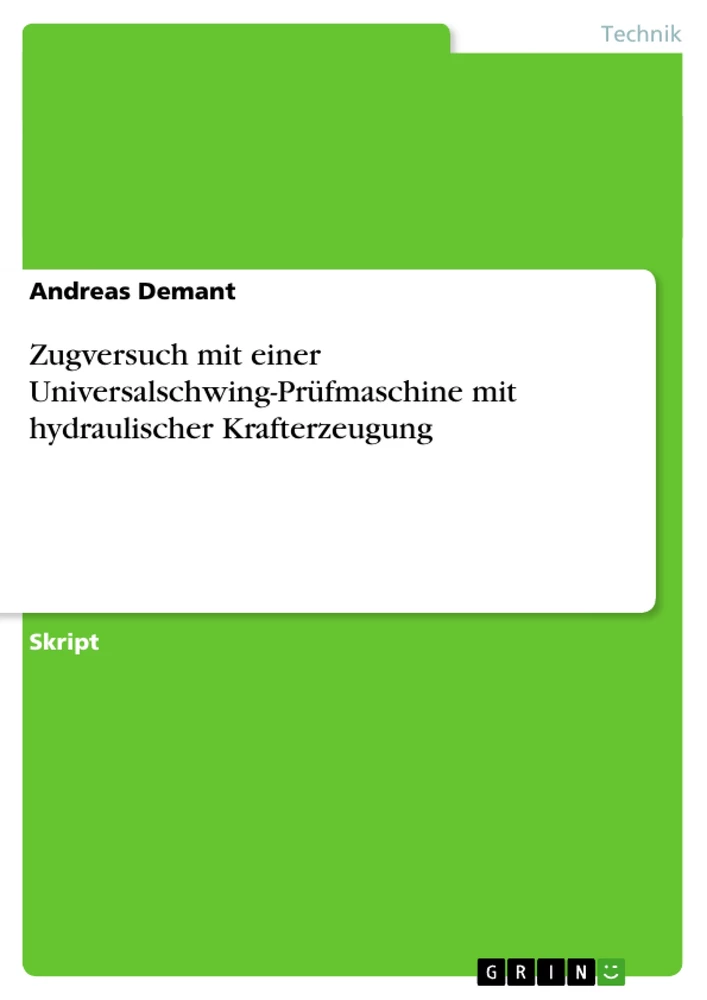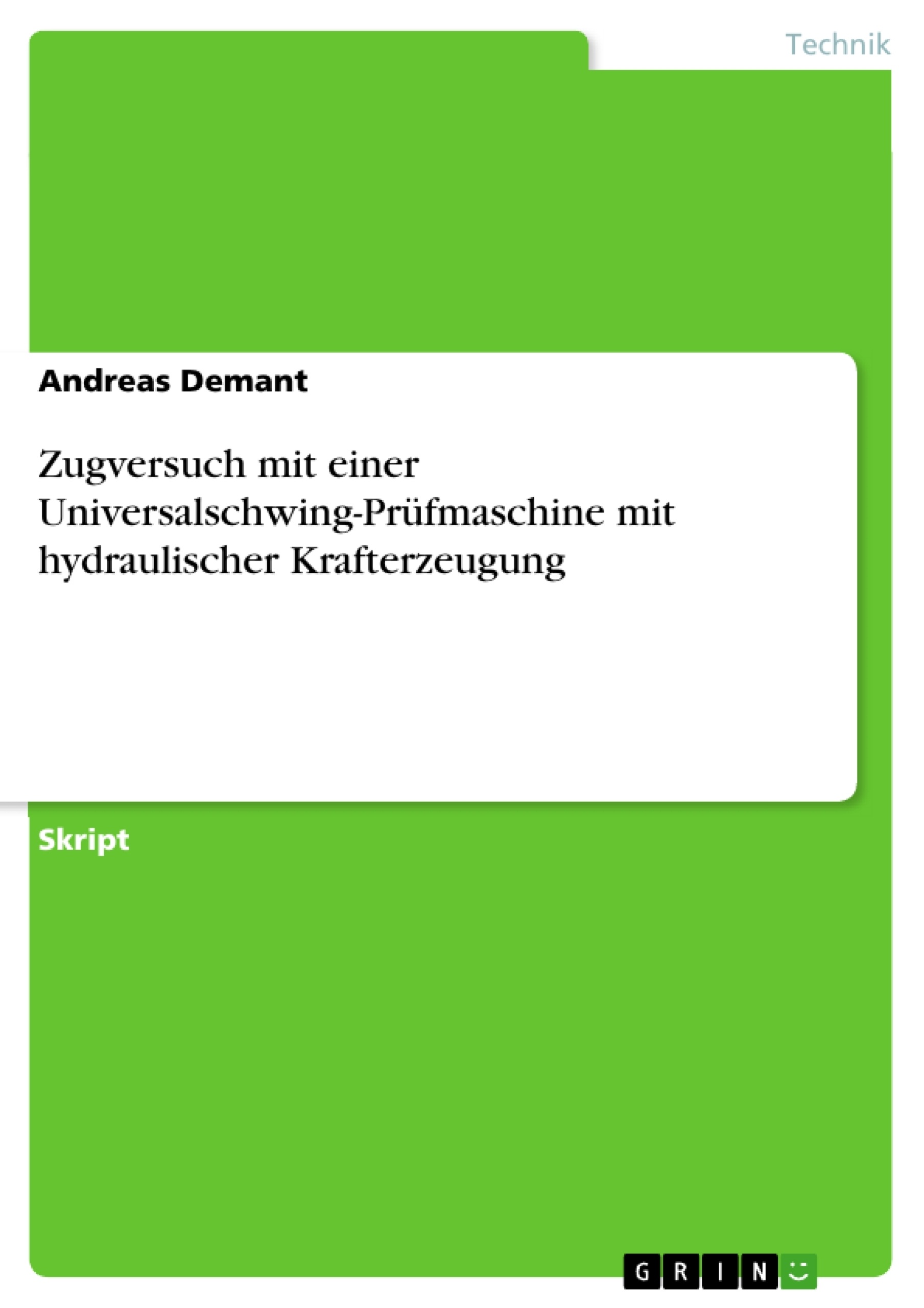Was verraten uns Werkstoffe, wenn wir sie bis zum Äußersten belasten? Diese Frage steht im Zentrum einer aufschlussreichen Untersuchung, die sich dem Zugversuch nach DIN 50145 widmet – einem Schlüsselverfahren der mechanisch-technologischen Prüfung. Im Fokus stehen zwei Proben: eine Rundschulterprobe aus C35 und ein Flachstahl St 37k, die einer einachsigen Zugbeanspruchung unterzogen werden, um ihr Verhalten hinsichtlich Längenänderung und Querschnittsverjüngung bis zum Bruch zu analysieren. Der Leser wird in die detaillierte Durchführung des Versuchs eingeführt, von der präzisen Probengeometrie bis zur Anwendung einer Universalschwing-Prüfmaschine mit hydraulischer Krafterzeugung. Die Auswertung der resultierenden Diagramme, insbesondere die Analyse der Hookeschen Geraden und des Elastizitätsmoduls, offenbart aufschlussreiche Einblicke in das Materialverhalten. Untersucht werden die Unterschiede im Verhalten der Proben, das Vorliegen einer Streckgrenze, und die Analyse der Brucharten, die Aufschluss über duktile und spröde Eigenschaften geben. Tabellen und Kennwerte fassen die Ergebnisse zusammen, während eine umfassende Materialbewertung und Fehleranalyse mögliche Ursachen für Abweichungen von idealen Werten ergründet. Anisotropie, Lunker, Gasblasen oder Einschlüsse werden als potenzielle Einflussfaktoren diskutiert, die die mechanischen Eigenschaften verändern könnten. Abschließend werden die Auswirkungen des Kaltziehens auf St 37k und die daraus resultierenden Veränderungen in Streckgrenze und Zugfestigkeit beleuchtet. Diese Arbeit bietet somit einen umfassenden Einblick in die Materialprüfung und -bewertung, ideal für Ingenieure, Werkstoffkundler und alle, die sich für die mechanischen Eigenschaften von Werkstoffen interessieren. Tauchen Sie ein in die Welt der Werkstoffprüfung und entdecken Sie die Geheimnisse, die in der Verformung und im Bruch verborgen liegen.
Gliederung:
1. Einleitung
2. Versuchsablauf
2.1. Probengeometrie
2.2. Durchführung
3. Diagrammauswertung
3.1. Allgemeines
3.2. Rundeisen
3.3. Flachstab
3.4. Brucharten
4. Tabellen und Kennwerte
5. Diagramme
6. Materialbewertung und Fehleranalyse
6.1. Rundschulterprobe
6.2. Flacheisen
1. Einleitung
Der Zugversuch nach DIN 50145 zählt zur Gruppe der mechanisch-technologischen Prüfverfahren. Anhand des Zugversuches kann man feststellen, wie sich eine Probe (in unserem Fall eine Rundschulterprobe des Materials C 35 und ein Flachstahl der Sorte St 37k) bei einer einachsigen, auf den gesamten Probenquerschnitt wirkenden Zugbeanspruchung verhält. Es wird hierbei vor allem dessen werkstoffspezifisches Verhalten hinsichtlich seiner Längenänderung und seiner Querschnittsverjüngung in verschiedenen Bereichen des Werkstoffs bis zum Bruch der Probe überprüft. Wir führen diesen Versuch mit einer Universalschwing-Prüfmschine mit hydraulischer Krafterzeugung durch.
2. Versuchsablauf
2.1 Probengeometrie
Um einen Vergleich zwischen genormter Rundprobe und Flachprobe durchführen zu können, ist es nötig einen Zusammenhang zwischen Messlänge und Probenquerschnitt zu bestimmen :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dieselbe Beziehung trifft auch beim Flachstahl zu, und ermöglicht zusammen mit der Normierung der Rundprobe einen internationalen Vergleich der Messergebnisse. Damit nach dem Bruch die gesamte Verlängerung der Probe, sowie die der einzelnen Abschnitte messbar ist, werden auf der Probe Längenabschnitte zu 10mm eingeritzt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abmessungen :
Die Rundprobe wird durch eine ringförmige Vorrichtung biegemomentenfrei fixiert. Flachstahl ungenormt
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im Gegensatz zur Rundprobe erfolgt die Fixierung der Flachprobe durch Beißkeile, die sich mit wachsender Kraft immer stärker in die Probe ,,beißen", und die jeweils mit gegenläufigen Feilenhieb versehen sind, um Spannungen und Kerbenbildung auf der Probenoberfläche zu vermeiden.
2.2 Durchführung
Zur Durchführung wird eine MAN Universalschwingprüfmaschine verwendet, die eine max. Prüfkraft von 20 Mp ( 196 kN ) aufbringen kann. Es wurde der größte Messbereich gewählt, um eine möglichst genaue Messung zu gewährleisten. Die genormten und skalierten Proben werden nacheinander eingespannt und dann langsam und stoßfrei bis zum Bruch belastet. Mittels einer im Meß- und Steuerungsschrank eingebrachtem Papierrolle und Tuschestift erzeugt die Maschine selbstständig ein Kraft-Verlängerungs-Diagramm. Beim Erreichen der Höchstkraft bleibt ein mitlaufender Schleppzeiger stehen.
3. Diagrammauswertung
3.1 Allgemeines
Auffällig ist zunächst, dass bei beiden Proben der erste Bereich des Graphen im Spannungs - Dehnungsdiagramm bzw. im Kraft - Verlängerungsdiagramm ein lineare Funktion darstellt, die sog. Hookesche Gerade.
Dies bedeutet, dass in diesem Bereich die Spannung direkt proportional zur Dehnung ist. Es gilt also: __E· wobei E konstant ist.
Die Konstante E wird als sog. E - Modul ( Elastizitätsmodul ) bezeichnet. Das E - Modul gibt Auskunft über den Widerstand den der Werkstoff der Formänderung entgegensetzt.
In diesem linearen Bereich, auch elastischer Bereich genannt, dehnen sich die Proben zwar, gehen aber wieder in ihre Ausgangsform zurück, wenn keine Kraft mehr auf die Probe wirkt. Erst bei Überschreiten der Streckgrenzen bleibt eine sog. plastische Verformung bestehen.
Plastische Verformung bedeutet, dass nach Entlastung die ursprüngliche Gestalt nicht wieder eingenommen wird.
3.2 Rundprobe ( C35 )
Das __Diagramm zeigt, dass nach Erreichen der oberen Streckgrenze ReH die Spannung abfällt. Hier entsteht das Fließen, wobei sich der Körper bereits plastisch verformt. Die Kristalle bzw. die Körner beginnen nun mit Gleitvorgängen auf den Gitterebenen. Diese Versetzungsbewegungen bzw. die daraus resultierenden Blockierungen der Gleitebenen führen zu Lastschwankungen die man im Diagramm als den ,,gezackten" Bereich erkennt. Die kleinste Spannung in diesem Intervall wird Rel genannt.
Die Gleitbewegung führt dazu, dass die im polykristallinen Gefüge vorhandenen Versetzungen bis zu den Korngrenzen gleiten, wo ein Versetzungsstau auftritt. Damit die Probe weitergedehnt werden kann muss nun mehr Spannung aufgebracht werden. Dies wird aus dem Diagramm deutlich.
Im Bereich ab der oberen Streckgrenze bis zum Spannungsmaximum, der sog. Zugfestigkeit, verfestigt sich der Werkstoff durch die bereits geschilderten Vorgänge, was auch Kaltverfestigung genannt wird.
Ab der Höchstspannung Rm sinkt die Kurve bis zum Bruch ab. In diesem Bereich kommt es zur Brucheinschnürung, d.h. die Probe schnürt sich ein und reißt schließlich.
3.3 Flachstahl ( St 37 k )
Die Probe zeigt im __Diagramm keinen Fließbereich und auch keine Streckgrenze. Dies ist damit zu erklären, dass die Probe bereits bei der Herstellung kaltgewalzt wurde, was zur Folge hat, dass der Werkstoff schon kaltverfestigt ist.
Bei Werkstoffen die keine ausgeprägte Streckgrenze aufweisen, wird die Dehngrenze Rp ermittelt. In unserem Fall wird die Dehngrenze Rp0.2 durch eine Parallele zur Hookeschen Gerade mit 0.2 % Dehnung erstellt.
Wenn diese Streckgrenze erreicht ist, bleibt also eine plastische Verformung von 0.2 % bestehen.
Die Spannungs - Dehnungs Kurve steigt stetig an bis sie schließlich einen Extremwert erreicht, welche ebenfalls wie bei der Rundprobe als Rm bezeichnet wird. Ab diesem Punkt fällt sie bis zum Bruch ab.
3.4 Brucharten
An beiden Proben kann man den sog. Mischbruch, der auch ,, Cup and Cone" - Bruch genannt wird, erkennen. Die Art des Bruches gibt uns Auskunft über den Werkstoff. Beide Proben weißen daher sowohl duktile ( zähe ) als auch spröde Eigenschaften auf.
4. Tabellen und Kennwerte
Abmeßungstabelle Flachstab
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Summe der Bereiche beim Flachstab: lgesamt = 104,65 mm;
Abgemessene Länge (Schieblehre): lgesamt = 104,55 mm;
Abmeßungstabelle Rundstab
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Summe der Bereiche beim Rundstab: lgesamt = 101,2 mm;
Abgemessene Länge (Schieblehre): lgesamt = 101,25 mm;
Kennwerte
Rundeisen:
10 verschiedene Werte anhand des Graphen (Schreibvorrichtung an der Maschine):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die umgerechneten Spannungs - und Dehnungswerte:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wichtige Kennwerte:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Weiterhin:
A=26% ( Bruchdehnung )
Z=46,4% ( Brucheinschnürung )
Flacheisen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die umgerechneten Spannungs - und Dehnungswerte:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wichtige Kennwerte:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Weiterhin:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5. Diagramme
nächste Seite: Spannungs-Dehnungsdiagramm der Rundschulterprobeübernächste Seite: Spannungs-Dehnungsdiagramm der Flachprobe
6. Materialbewertung und Fehleranalyse
Im folgenden sollen mögliche Ursachen ermittelt werden, durch die beide Proben (Rundschulterprobe und Flachprobe) eine Veränderung in ihren Kennwerten erfahren haben.
6.1. Rundschulterprobe
Vergleich der ermittelten Werte mit den ,,Idealwerten"
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei der Rundschulterprobe ist anzunehmen, dass der im Versuch verwendete Stahl nicht unbedingt der offiziellen Deklarierung entspricht, d. h. es könnte sich auch um eine andere Stahlsorte handeln.
Vor allem bei einem Rm-Vergleich (siehe obige Tabelle) wird deutlich, dass die Rundschulterprobe aus einem anderen Material bestehen muss, da der ermittelte Wert erheblich unter dem Sollwert von C35 liegt. Bei der verwendeten Stahlsorte dürfte es sich wohl um Ck25 oder C22 handeln (siehe Vergleichswerte in obiger Tabelle). Auch die im Versuch bestimmte Bruchdehnung A und die Brucheinschnürung Z sprechen eher für eine der beiden Stahlsorten Ck25 oder C22.
Die oben in der Tabelle aufgeführten mechanischen Eigenschaften können jedoch auch durch Anisotropie, Lunker, Gasblasen oder Einschlüsse maßgeblich beeinflusst werden. Durch das Walzen (bei Vergütungsstahl C35 gew.) wird die anisotrope Kristallgittergestalt eventuell so verändert, dass eine Ausrichtung der Kristalle erfolgt => Textur.
Dadurch könnten auch die höheren A (Bruchdehnung), Z (Brucheinschnürung) - Werte und die geringere Zugfestigkeit erklärt werden.
6.2. Flacheisen
Vergleich der ermittelten Werte mit den ,,Idealwerten"
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck des Zugversuchs gemäß DIN 50145?
Der Zugversuch ist ein mechanisch-technologisches Prüfverfahren, um das Verhalten einer Probe (hier: Rundschulterprobe aus C 35 und Flachstahl St 37k) unter einachsiger Zugbeanspruchung zu untersuchen. Es werden Längenänderung und Querschnittsverjüngung bis zum Bruch der Probe analysiert.
Wie wird der Zugversuch durchgeführt?
Der Versuch wird mit einer Universalschwing-Prüfmaschine mit hydraulischer Krafterzeugung durchgeführt. Genormte und skalierte Proben werden eingespannt und langsam bis zum Bruch belastet. Die Maschine erstellt ein Kraft-Verlängerungs-Diagramm.
Was ist die Hookesche Gerade im Zusammenhang mit dem Zugversuch?
Im Spannungs-Dehnungs-Diagramm stellt der erste Bereich, in dem Spannung und Dehnung proportional sind, die Hookesche Gerade dar. Die Proportionalitätskonstante ist der E-Modul (Elastizitätsmodul), der den Widerstand des Werkstoffs gegen Formänderung angibt.
Was bedeutet plastische Verformung?
Plastische Verformung bedeutet, dass die Probe nach Entlastung nicht mehr in ihre ursprüngliche Form zurückkehrt.
Was passiert bei Erreichen der Streckgrenze (ReH) bei der Rundprobe (C35)?
Nach Erreichen der oberen Streckgrenze fällt die Spannung ab, und es kommt zum Fließen, wobei sich der Körper plastisch verformt. Gleitvorgänge auf den Gitterebenen der Kristalle beginnen.
Was ist die Zugfestigkeit (Rm)?
Die Zugfestigkeit ist die Höchstspannung, die ein Werkstoff im Zugversuch aushält, bevor es zur Brucheinschnürung und zum Bruch kommt.
Warum zeigt der Flachstahl (St 37 k) keine ausgeprägte Streckgrenze?
Der Flachstahl zeigt keine ausgeprägte Streckgrenze, da er bereits bei der Herstellung kaltgewalzt wurde, was zu einer Kaltverfestigung des Werkstoffs führt.
Was ist die Dehngrenze Rp0.2?
Die Dehngrenze Rp0.2 wird bei Werkstoffen ohne ausgeprägte Streckgrenze ermittelt. Sie wird durch eine Parallele zur Hookeschen Geraden mit 0.2 % Dehnung erstellt. Bei Erreichen dieser Grenze bleibt eine plastische Verformung von 0.2 % bestehen.
Was ist ein Mischbruch ("Cup and Cone"-Bruch)?
Ein Mischbruch, auch "Cup and Cone"-Bruch genannt, zeigt sowohl duktile (zähe) als auch spröde Eigenschaften des Werkstoffs.
Welche möglichen Fehlerquellen können die Kennwerte der Proben beeinflussen?
Mögliche Ursachen für Abweichungen der Kennwerte von den Idealwerten sind z.B. Anisotropie, Lunker, Gasblasen oder Einschlüsse im Material. Zudem kann es sein, dass der verwendete Stahl nicht der offiziellen Deklarierung entspricht.
Wie beeinflusst Kaltziehen die Eigenschaften von St 37k Stahl?
Durch das Kaltziehen (k) können die Streckgrenzwerte bis zu 50% höher liegen als bei St 37. Die Kaltumformung führt zu einem Verlust an Dehnungsfähigkeit, was die Neigung zum Trennbruch erhöht. Gleichzeitig steigt die Zugfestigkeit (Kaltverfestigung).
- Quote paper
- Andreas Demant (Author), 2001, Zugversuch mit einer Universalschwing-Prüfmaschine mit hydraulischer Krafterzeugung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98489