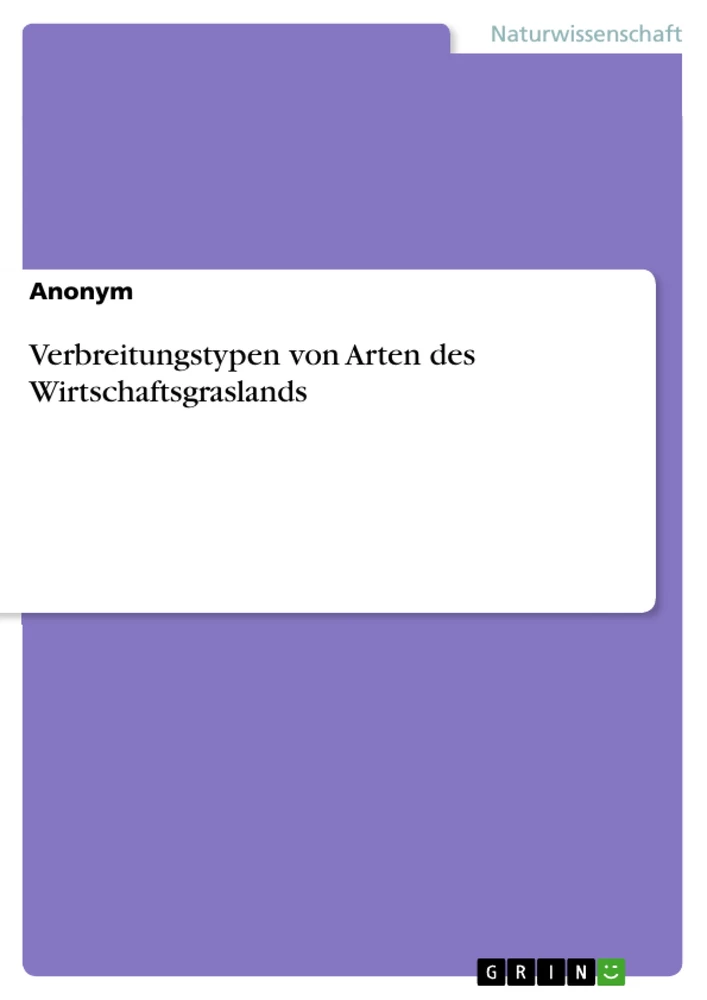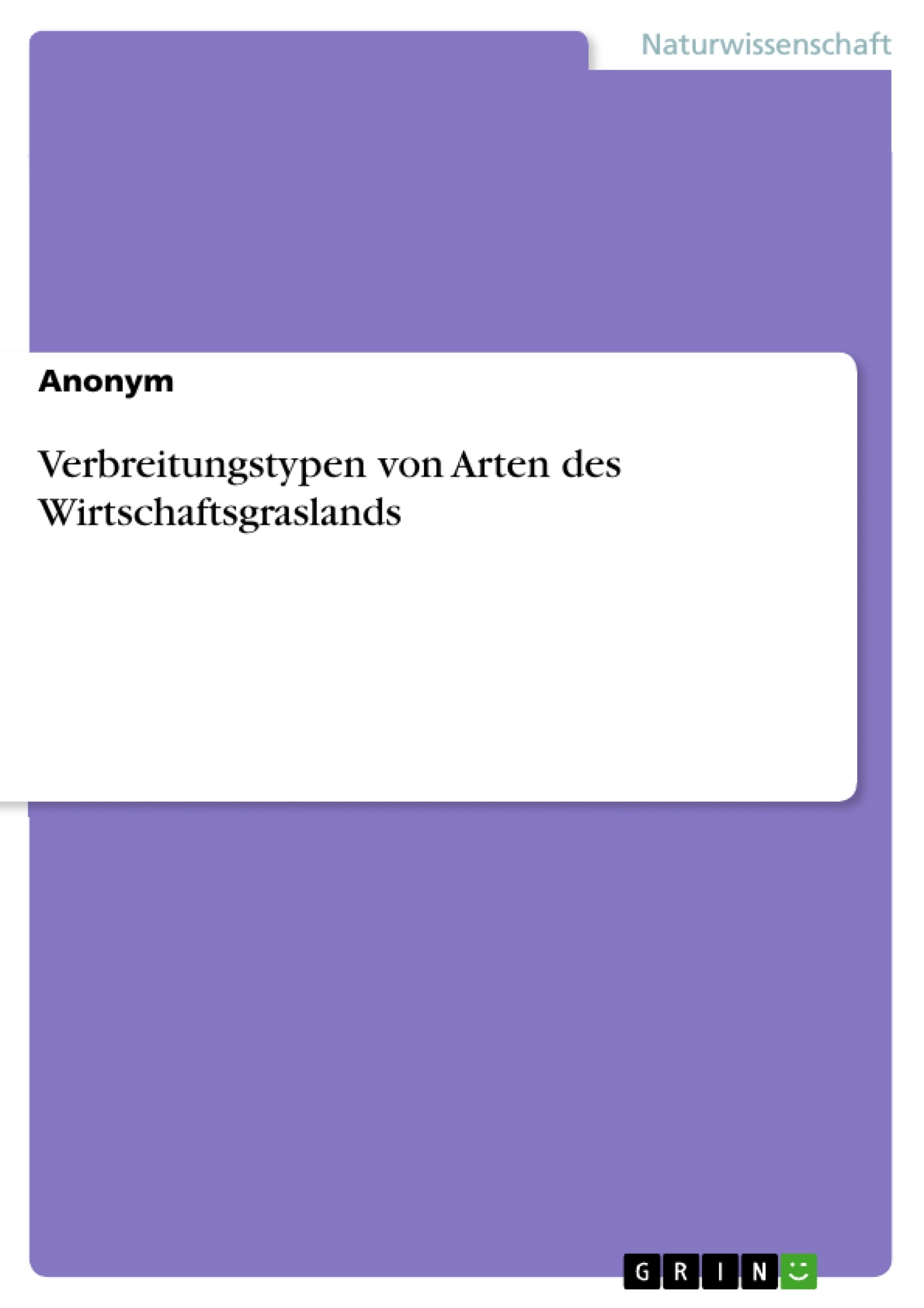Verbreitungstypen von Arten des Wirtschaftsgraslands
(dominante und verbreitete Arten im Vergleich zu Begleitern aus anderen Pflanzengesellschaften)
Referat zur Labor- und Geländeübung Wirtschaftsgraslandß 2000
Grundlagen der Diasporenverbreitung
Die Tabelle zeigt die möglichen Ausbreitungswege von Diasporen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: BONN & POSCHLOD 1998, S. 20
Häufig werden Diasporen einer Art auf verschiedene Weise ausgebreitet (Polychorie), wobei auch Ausbreitungsprozesse, die nicht auf morphologischen Eigenschaften beruhren, stattfinden, z.B. viele anemochore Diasporen, die in Gewässern schwimmend transportiert werden. Es gibt auch Diasporen ohne morphologische Anpassung an ein Ausbreitungsagens. Möglicherweise ist die Polychorie weit häufiger als die spezialisierte Ausbreitung, die Bedeutung ist noch kaum bekannt. Die Diasporenmorphologie liefert nur ein sehr eingeschränktes Bild von den tatsächlichen Ausbreitungsmöglichkeiten. Daher sind Fehlprognosen der Ausbreitungsfähigkeit von Arten möglich. Die Ausbreitung ist vom Zufall bestimmt. Morphologische Eigenschaften erhöhen nur die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Ausbreitungsweise. Ausbreitungsbiologisch relevante Merkmale sind Größe, Gewicht, Form, Oberfläche, Anhängsel und sonstige morphologische Strukturen. Die folgenden Tabellen zeigen die prozentuale Verteilung der Diasporenverbreitung von Borstgrasrasen des Hunsrück und Eifel (Polygalo-Nardetum), Kalkmagerrasen der Eifel (Mesobrometum erecti) und Glatthaferwiesen (Arrhenatheretum elatioris typicum).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zusammenfassung (Gesamt):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ausbreitungsmuster
Im Allgemeinen nimmt die Zahl der ausgebreiteten Diasporen mit zunehmender Entfernung von der Mutterpflanze rasch ab. Diesen Zusammenhang kann man in Ausbreitungskurven darstellen. Die Steilheit des Kurvenabfalls ist abhängig von der Ausbreitungsart, z.B. haben anemochore und viele zoochore Arten einen sanfteren Abfall und damit eine höhere Ausbreitungsdistanz. Durch Polychorie kann eine Art relativ unterschiedliche Ausbreitungsmuster aufweisen, was eine größere Risikostreuung bedeutet. Die Ausbreitungsmuster einzelner Diasporen der gleichen Mutterpflanze können stark varrieren, indem die Pflanze unterschiedliche Diasporen herstellt (z.B. Form, Gewicht oder Keimungsverhalten), was man z.B. bei vielen Asteraceen und Poaceen findet. Der Vorteil ist eine Risikostreuung und breitere ökologische Amplitude für die Etablierung einer Art. Mit steigender Entfernung und abnehmender Häufigkeit spielen zufällige Ausbreitungsprozesse eine zunehmende Rolle. Daher werden isolierte Standorte wegen den großen Distanzen durch Zufallsereignisse besiedelt.
Sehr verbreitet ist eine Mehrfachausbreitung, d.h. eine Diaspore wird nach Ablagerung erneut transportiert. Dadurch sind starke Modifikationen der Ausbreitungsmuster möglich, z.B. primäre Ausbreitung anemochor und sekundär zoochor. V.a. die Sekundärausbreitung ist entscheidend für die Verbreitung von Arten. Dieser Aspekt wird in den Ausbreitungskurven vollständig vernachlässigt. Noch schwieriger ist die Beurteilung der für den Erhalt einer Population wirksamen Ausbreitung. Bei den vorhandenen Ausbreitungsmodellen bleibt i.A. der Zusammenhang zwischen Ausbreitung und Populationswachstum unberücksichtigt, z.B. kann schnelles Populationswachstum eine geringe Ausbreitungsfähigkeit zumindest partiell kompensieren. Für das Überleben von Populationen ist eine Ausbreitung zwischen einzelnen Populationen erforderlich, ansonsten sterben vollkommen isolierte Populationen aus. Gefährdet sind v.a. Arten mit größeren jährlichen Bestandsschwankungen (annuelle und bienne Arten). In einer Untersuchung von FISCHER/STÖCKLEIN (1995, zitiert in BONN & POSCHLOD 1998) konnte festgestellt werden, daß im Mesobrometum im Vergleich vor 35 Jahren durchschnittlich 40 % aller Arten pro Standort verschwunden waren, da die Einzelflächen früher weniger isoliert waren. Die Aussterberate war abhängig von den jährlichen Bestandsschwankungen und der Populationsgröße. Die Artenvielfalt wird maßgeblich durch die Ausbreitungsfähigkeit der Arten bestimmt. Die Ausbreitung ist v.a. dafür verantwortlich wieviele und welche Arten am "Eingang einer Gesellschaft" warten. Die Standortfaktoren entscheiden dann über die Etablierung.
Etablierung
Die Etablierung ist letztendlich relevant. Vorraussetzung für erfolgreiche Etablierung ist das Vorhandensein von Schutzstellen, d.h. Mikro- und Makrohabitate, welche die zur Keimung und Keimlingswachstum notwendigen Eigenschaften besitzen: Reize, die die Dormanz der Samen brechen, Ressourcen (z.B. Wasser), Schutz vor Prädatoren und Störung, die die Keimung bedingt (hohe Bedeutung). Nachbarpflanzen sind wichtige Schutzstellenkomponenten (z.B. vor Austrocknung). Eine Art kann daher in einem Habitat entweder fehlen, weil keine der Art entsprechenden Schutzstellen vorhanden sind, obwohl die Diasporen dorthin ausgebreitet wurdden, oder weil die Diasporen nicht dorthin ausgebreitet wurden. Diaspore und Keimling können sich in ihren Ansprüchen an eine Schutzstelle unterscheiden, z.B. günstig für Keimung, aber nicht für Etablierung des Keimlings.
Die Ausbreitungseffektivität wurde oft nur an der Ausbreitungsdistanz gemessen, z.B. ist die Anemochorie unter alleiniger Berücksichtigung der Ausbreitungsdistanz wirksam, unter Einbeziehung der Etablierung aber oft relativ ineffektiv. Es besteht ein Forschungsdefizit, welche Ausbreitungsprozesse für die Etablierung relevant sind. Die Ausbreitungsqualität ist wichtiger als die Ausbreitungsquantität. Arten mit kleinen Diasporen und geringen Nährstoffreserven haben eine geringe Anzahl an geeigneten Schutzstellen, weswegen in diesem Fall eine hohe Ausbreitungsdistanz am günstigsten ist. Für Arten mit häufiger vorkommenden Schutzstellen ist hingegen eine geringere Ausbreitungsdistanz von Vorteil. Einen deutlich negativen Einfluß auf die Etablierung übt die Prädation aus. Für die Ausbreitung ist auch Dauer und Zeitpunkt der Ausstreu wichtig, z.B. ist nach herbstlichem Laubfall die Windgeschwindigkeit höher, im Spätherbst und Winter die Anzahl der Prädatoren geringer und die Bereitstellung von Früchten in fruchtarmen Zeiten erhöht die Ausbreitungswahrscheinlichkeit. Diasporen einer Pflanze können unterschiedliche Ausstreuzeitpunkte haben. Eine rasche Ausstreu mindert das Risiko des Prädatorenbefalls der fruchtenden Pflanze, eine verlängerte Ausstreu dagegen die Chance der Etablierung. Die Etablierung von großen Diasporen ist wahrscheinlicher wegen der hohen Nährstoffversorgung. Kleinsamige Diasporen werden in in weit höherer Anzahl produziert und haben auch eine höhere räumliche Ausbreitung. Große Diasporen können aber durch zoo- und hydrochore Ausbreitungsprozesse über große Distanzen verfrachtet werden. Kleine Diasporen werden von r-Strategen früher Sukzessionsstadien produziert, Arten stabilerer Standorte besitzen größere, weniger ausbreitungsfähige Diasporen. Zahlreiche Grünlandarten besitzen Möglichkeit der Endo- und Epizoochorie, ohne entsprechende morphologische Anpassungen. Die heutigen Kenntnisse über Bedeutung der verschiedenen Ausbreitungsprozesse und deren Relevanz für das Überleben von Populationen ist immer noch äußerst lückenhaft.
RYSER (1993) stellte in Kalkmagerrasen fest, daß Lücken weniger wichtig für die Etablierung der Arten sind. Dürre, Frost und Krankheiten beeinflußen die Etablierung stärker als die Konkurrenz durch benachbarte Pflanzen. Einige Arten können sich kaum ohne Beschattung der Nachbarvegetation etablieren. Manche Arten können sich in Lücken etablieren, andere nur in Mikrostandorte der benachbarten Pflanzen. Arten mit den größten Samen hatten die geringste Sterblichkeit, besonders in Lücken. Die Vegetationsbedeckung kann den Etablierungserfolg steigern oder reduzieren, abhängig von der Art und der Struktur der Beschattung. Die Lücken werden hauptsächlich vegetativ widerbesiedelt. Daher besitzen Lücken nur geringe Bedeutung für die Etablierung, was im Widerspruch zur generellen Meinung steht. Eine Streuauflage reduziert die Etablierung. Jungpflanzen können lange in der geschlossenen Vegetation überleben.
Das langsame Wachstum und die Fähigkeit der Pflanzen, lange Zeitperioden in der Vegetation zu überleben, sind wichtige Faktoren für die Erhaltung des Artenreichtums in nährstoffarmen Grünlandgesellschaften.
GIGON (1997) untersuchte Trespen-Halbtrockenrasen und kam zum Schluß, daß es unregelmäßige Fluktuationen (mehrjährig und jahreszeitlich) des Deckungsgrads der Arten gibt. Die Fluktuationen werden z.B. durch altersbedingtes Sterben gleichaltriger Pflanzen einer Art oder Witterungsschwankungen verursacht. Je nach Witterungsbedingungen werden unterschiedliche Arten begünstigt oder benachteiligt. Je nach dem Mahdzeitpunkt können Samen bestimmter Arten ausreifen oder nicht. Der Mahdzeitpunkt spielt auch für den Deckungsgrad und Konkurrenzbedingungen der Arten eine große Rolle. Fluktuationen im Deckungsgrad kommen auch durch verschieden lange Lebensdauer der Individuen einzelner Arten zustande. Fluktuationen treten des weiteren durch Schwanken der Populationsdichte von Feldmäusen auf, die die Deckungsgrade beeinflussen. Immer wider haben andere Arten besonders gute und besonders schlechte Wachstumsbedingungen (mit Folgen für die Samenproduktion) in unregelmäßiger Abfolge. Für keine Art sind die Bedingungen dauernd derart günstig, daß sie die anderen durch Konkurrenz verdrängen könnte. Daher sind Fluktuationen Vorraussetzung für die Koexistenz vieler Arten und damit Artenvielfalt. Wiesen sind wesentlich artenärmer, da die Standortbedingungen relativ konstant bleiben z.B. wegen besserer Wasserversorgung.
In den meisten Pflanzengesellschaften gibt es eine geringe Anzahl mit großer und eine Mehrzahl mit kleiner Populationsdichte. Die Ursachen der Seltenheit sind:
- Spezialisation auf rare Mikrohabitate (z.B. bestimmte Nährstoffverhätnisse)
- Beschränkung an Lücken verursacht durch Tiere, Maschinen, etc.
- spezielle Interaktion mit anderen Arten
- geringe Konkurrenzkraft
- limitierte Samenverbreitung
Diasporenbank
Neben der räumlichen Ausbreitung von Diasporen gibt es die Möglichkeit des Aufbaus einer Diasporenbank im Boden, wodurch ein Überdauern über mehrere Jahre bis Jahrzehnte und eine Neukolonisation möglich ist. Dadurch wird die Extinktionswahrscheinlichkeit einer Population verringert. Arten, die eine geringe räumliche Ausbeitungsfähigkeit besitzen, haben oft ein gutes Überdauerungsvermögen in der Diasporenbank.
Die Dynamik der Diasporenbank hängt ab von:
- jahreszeitlichem Eintrag von Diasporen
- Dormanzstruktur der Diasporen
- Tiefenverlagerung der Diasporen (v.a. von der Größe abhängig neben Bodenprozessen)
- Größe der tiefenverlagerten Diasporenbank wird durch Tod, Krankheitsbefall, Fraß und fehlgeschlagene Keimung beeinflußt
Kleinere Samen haben geringeres Risiko der Prädation, das sie weniger attraktiv und schneller im Boden verlagert werden. Daher entwicklen kleine Samen eher eine Diasporenbank. In einer Untersuchung von POSCHLOD und JACKEL (1993) in einem Kalkmagerrasen konnte festgestellt werden, daß 60 % der Arten der aktuellen Vegetation als keimfähige Diasporen im Boden vorliegen. Zwischen den Diasporen der verschiedenen Arten bestehen starke Unterschiede in der Nachweisdauer und der Tiefenverteilung in der Diasporenbank. Manche Arten sind nur kurze Zeit in der Bank nachweisbar und fast nur in den oberen 2 cm, andere das ganze Jahr auch in größerer Tiefe. Die Tiefenverlagerung hängt auch von der Lebensdauer der Diasporen ab. Die Anzahl der keimfähigen Diasporen beträgt in Kalkmagerrasen 4000 - 8400 /m[2]. Bei manchen Arten kann die Keimung durch Dormanz (z.B. angeboren oder infolge niedriger Temperatur) verzögert sein. Für Arten mit vorübergehender Diasporenbank und ohne Dormanz verbessert die verlängerte Ausstreu die Chance der Etablierung. Einige Arten kamen noch Jahrzehnte nach Brachfallen oder Aufforstung von Kalkmagerrasen als keimfähige Diasporen im Boden vor, obwohl sie in der aktuellen Vegetation fehlen. Leucanthemum vulgare überlebt als vergrabene Diaspore länger als 20 Jahre. Bezüglich der Dormanz existieren unterschiedliche Genotypen. Forschungen von KOLLMANN & POSCHLOD (1997) ergaben, daß die meisten Graslandarten keine effektiven Verbreitungsmechanismen und nur eine kurze Diasporenbank (kleiner 2 Jahre) haben. In Kalkmagerrasen wurden nur 10 % der Arten werden weiter als 100 m transportiert. Eine zusätzliche Verbreitung geschieht durch Tiere wie z.B. Schaafe. Dormanz ist selten. Mittlere Bedeckung ist wahrscheinlich am günstigsten für die Etablierung von Graslandarten. Die Sterblichkeit von Keimlingen und Jungpflanzen ist auf nicht abgedeckten Flächen deutlich höher als auf abgedeckten. Für die Etablierung sind Lücken im Bestand entscheidend.
MILBERG (1994) stellte fest, daß das Samenkeimungsverhalten eine der wichtigsten Faktoren für die Akkumulation in dauerhaften Samenbanken ist. Ein wichtiger Auslöser der Keimung ist Licht (für viele Arten Bedingung). Relativ wenige Samen von Lychnis flos- cuculi keimten auch in Dunkelheit bei hohen Temperaturen. Weitere mögliche Auslöser bzw. Verhinderer der Keimung sind bodenchemische Verhältnisse, Temperatur und Bodenklima. MILBERG und PERSSON (1994) untersuchten die Auswirkung von Mähen auf brachgefallenes Grünland. Dabei zeigte sich, daß Mähen die Artenvielfalt erhöht, da direktes Licht den Boden erreicht (Keimung) und die Konkurrenz mindert. Die neu etablierten Arten stammten meist aus nahegelegenen Habitaten. Samen von nicht windverbreiteten Grünland- Arten wurden selten mehr als einige Meter weit transportiert, die meisten Arten waren nicht anemochor. In Bezug auf die Samenbank stellte sich heraus, daß sie die zukünftige Artenzusammensetzung nur gering beeinflußt. 42 % der durch Mähen neu etablierten Arten stammten aus der Samenbank. Viele Arten mit Naturschutzwert im Grünland haben kurzlebige Samen, trotzdem kamen eine Reihe dieser Arten in der Samenbank vor, so daß ein Renaturierungspotential besteht.
Literaturverzeichnis
BONN, S. & POSCHLOD, P. (1998): Ausbreitungsbiologie der Pflanzen Mitteleuropas. Wiesbaden
FASSBENDER, E. (1989): Vegetationskundliche und bodenökologische Untersuchungen an Borstgrasrasen in Hunsrück und Eifel. Diplomarbeit an der Universität Trier, Abteilung Geobotanik. Trier
GIGON, A. (1997): Fluktuationen des Deckungsgrads und die Koexistenz von Pflanzenarten in Trespen- Halbtrockenrasen (Mesobromium). Phytocoenologia 27 (2), 275-287 GIGON, A. & MARTI, R. (1994): Seltenheit, Konkurrenz und Naturschutz von Pflanzen in Trespen- Halbtrockenrasen bei Schaffhausen. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 23
KOLLMANN, J. & POSCHLOD, P. (1997): Population processes at the grassland-scrub interface. Phytocoenologia 27 (2), 235-256
MILBERG, P. (1994): Annual dark domancy cycle in buried seeds of Lychnis flos-cuculi. Annuales Botanici Fennici 31, 163-167
MILBERG, P. & PERSSON T. S. (1994): Soil seed bank and species recruitment in road verge grassland vegetation. Annuales Botanici Fennici 31, 155-162
MÖSELER, B. M. (1989): Die Kalkmagerrasen der Eifel. Bonn
MÜLLER-SCHNEIDER, P. (1986): Verbreitungsbiologie der Blütenpflanzen Graubündens. Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der ETH, Stiftung Rübel, Zürich, Heft 85. Zürich
PATZELT, A. et al. (1997): Renaturierungsverfahren zur Etablierung von Feuchtwiesenarten.
Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 27, 165-172
POSCHLOD, P. & JACKEL, A.-K. (1993): Jahreszeitliche Dynamik des Diasporenregens und der
Diasporenbank auf zwei Kalkmagerrasenstandorten der Schwäbischen Alb. Flora 188, 49-71
RYSER, P. (1993): Influences of neighbouring plants on seedling establishment in limestone grassland.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die wichtigsten Ausbreitungswege von Diasporen?
Die Diasporen können durch verschiedene Wege ausgebreitet werden, einschließlich Wind (Anemochorie), Tiere (Zoochorie), Wasser (Hydrochorie) und Selbstausbreitung (Autochorie). Oft erfolgt die Ausbreitung über mehrere Wege (Polychorie).
Warum ist die Diasporenmorphologie nur ein eingeschränktes Bild der Ausbreitungsmöglichkeiten?
Die Diasporenmorphologie gibt nur Hinweise auf potenzielle Ausbreitungswege, aber die tatsächliche Ausbreitung hängt stark von Zufallsereignissen und der Umwelt ab. Polychorie, bei der Diasporen auf verschiedene Weise ausgebreitet werden, und Sekundärausbreitung, bei der Diasporen nach der Ablagerung erneut transportiert werden, spielen eine wichtige Rolle.
Was ist ein Ausbreitungsmuster und wie beeinflusst es die Verbreitung von Arten?
Ein Ausbreitungsmuster beschreibt, wie sich Diasporen in Abhängigkeit von der Entfernung zur Mutterpflanze verteilen. Anemochore und zoochore Arten haben oft eine größere Ausbreitungsdistanz. Polychorie ermöglicht unterschiedliche Ausbreitungsmuster und damit eine größere Risikostreuung.
Wie wichtig ist die Etablierung von Diasporen für das Überleben einer Art?
Die Etablierung ist entscheidend. Vorraussetzung ist das Vorhandensein von Schutzstellen (Mikro- und Makrohabitate) mit geeigneten Eigenschaften für Keimung und Keimlingswachstum. Nachbarpflanzen können wichtige Schutzstellenkomponenten sein.
Was beeinflusst die Etablierung von Pflanzen in Kalkmagerrasen?
Laut RYSER (1993) sind Dürre, Frost und Krankheiten wichtigere Faktoren für die Etablierung als Konkurrenz durch benachbarte Pflanzen. Die Vegetationsbedeckung kann je nach Art und Struktur der Beschattung sowohl förderlich als auch hinderlich sein. Lücken werden hauptsächlich vegetativ widerbesiedelt.
Welche Rolle spielen Fluktuationen im Deckungsgrad der Arten für die Artenvielfalt?
GIGON (1997) fand heraus, dass unregelmäßige Fluktuationen des Deckungsgrads (mehrjährig und jahreszeitlich) Vorraussetzung für die Koexistenz vieler Arten und damit für die Artenvielfalt sind. Ursachen sind altersbedingtes Sterben, Witterungsschwankungen und unterschiedliche Lebensdauern der Individuen.
Was sind die Ursachen für die Seltenheit von Arten in Pflanzengesellschaften?
Die Ursachen sind vielfältig: Spezialisation auf rare Mikrohabitate, Beschränkung an Lücken, spezielle Interaktionen mit anderen Arten, geringe Konkurrenzkraft und limitierte Samenverbreitung.
Was ist eine Diasporenbank und wie beeinflusst sie die Artenvielfalt?
Eine Diasporenbank ist ein Reservoir von Diasporen im Boden, das ein Überdauern über Jahre bis Jahrzehnte und eine Neukolonisation ermöglicht. Dies verringert die Extinktionswahrscheinlichkeit einer Population. Arten mit geringer räumlicher Ausbreitungsfähigkeit haben oft ein gutes Überdauerungsvermögen in der Diasporenbank.
Welche Faktoren beeinflussen die Dynamik der Diasporenbank?
Die Dynamik hängt ab von jahreszeitlichem Eintrag von Diasporen, Dormanzstruktur, Tiefenverlagerung, Größe der tiefenverlagerten Diasporenbank (beeinflusst durch Tod, Krankheitsbefall, Fraß und fehlgeschlagene Keimung).
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus den Studien von MILBERG zur Samenkeimung und Samenbank in Bezug auf Grünland?
MILBERG fand heraus, dass das Samenkeimungsverhalten ein wichtiger Faktor für die Akkumulation in Samenbanken ist. Licht ist für viele Arten ein wichtiger Auslöser der Keimung. Mähen kann die Artenvielfalt erhöhen, da es direktes Licht auf den Boden bringt und die Konkurrenz mindert. Die Samenbank beeinflusst die zukünftige Artenzusammensetzung nur gering, aber viele Arten mit Naturschutzwert im Grünland haben kurzlebige Samen und können trotzdem in der Samenbank vorkommen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2000, Verbreitungstypen von Arten des Wirtschaftsgraslands, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98524