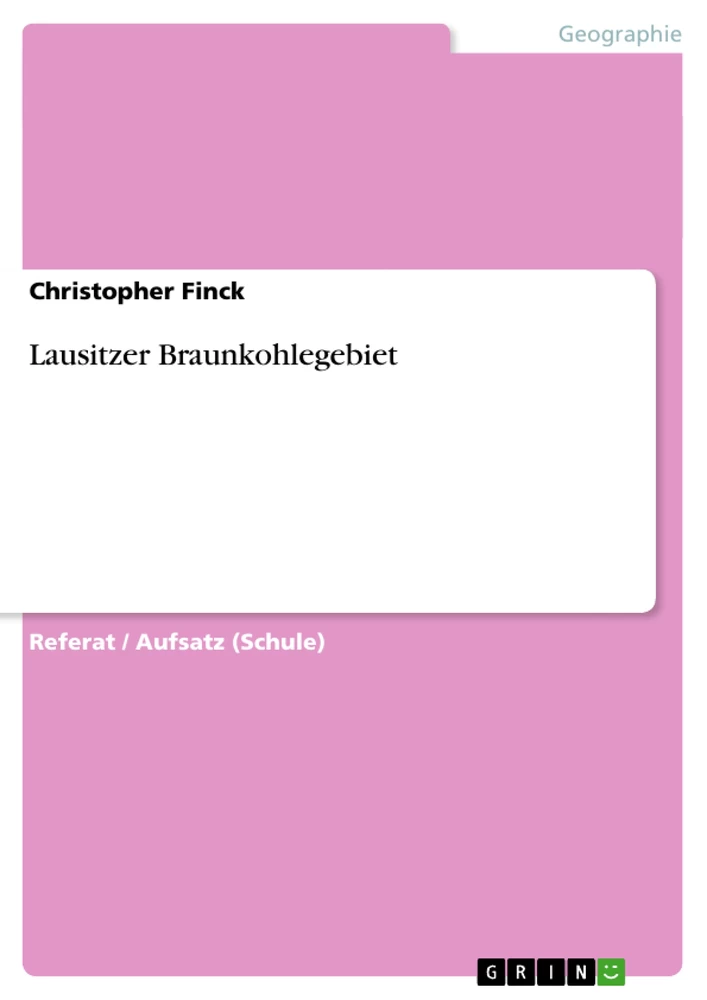Inhaltsverzeichnis
1.) Die Lage der Lausitz und ihre Besonderheit
2.) Die Braunkohle allgemein ( Wie sie entsteht...)
3.) Die Braunkohle in der Lausitz
4.) Die Braunkohleförderung zu DDR -Zeiten
5.) Die Braunkohleförderung heute
6.) Die Maßnahmen zur Rekultivierung in der Lausitz.
Ich referiere heute über das lausitzer Braunkohlegebiet. Ich habe das Referat in 6 Teile unterteilt:
1. Die Lage der Lausitz:
Die Lausitz liegt im Südosten Brandenburg bis hin zum Nordosten Sachsens und hat eine Fläche von rund 100 000 ha. ( Folie auflegen ).
Man sieht das in der Lausitz insgesamt 13 Milliarden Tonnen Kohle geologisch vorhanden sind aber nur 5,9Milliarden Tonnen wirtschaftlich gewinnbar sind. Für die nächsten Jahre sind jedoch nur 2,4 Milliarden für den Abbau geplant und genehmigt. Man sieht auch dass die Lausitz das 2. größte Braunkohlegebiet Deutschland ist. Im Ruhrgebiet sind gerade mal 12,6% der wirtschaftlich gewinnbaren kohle genehmigt und geplant. Das sind 28% weniger als in der Lausitz.
2.)Die Braunkohle allgemein:
Die Braunkohle ist vor ungefähr 62 -2 Millionen Jahren entstanden:
Durch Aufschichtungen von Pflanzen ,Torf, Meeressand, Kies... sind in Laufe der Millionen Jahren Braunkohleflöze entstanden. In der gesamten Bundesrepublik kommen rund 78 Milliarden Tonnen Braunkohle vor, davon sind jedoch nur 48 Mrd. Tonnen Kohle wirtschaftlich gewinnbar.
3.)Die Braunkohle in der Lausitz:
Die Braunkohle in der Lausitz ist vor rund 15-20 Millionen Jahren entstanden. Die Flöze befinden sich geradeeinmal in 40-120m Tiefe und ist ungefähr 8-15m dick. Die Braunkohle reicht noch rund 50 Jahre und sichert somit viele Arbeitsplätze. Die Qualität der Braunkohle ist mittelmäßig gut da sie noch ziemlich Jung ist. Ihr Schwefelgehalt beträgt rund 0,3%-1%.
Jetzt will ich euch noch was von der Geschichte in der Lausitz erzählen.
1789 wurde die Braunkohle zum ersten Mal in der Niederlausitz gefunden.
1850 wurde die Braunkohle zum ersten Mal wirtschaftlich genutzt.
1872 wurde die erste Brikettfabrik der Welt in Betrieb genommen.
1882 wurde die Niederlausitzer Kohlenwerk AG gegründet
4.)Die Braunkohleförderung zu DDR-Zeiten:
Nach dem 2. Weltkrieg setzte die neu entstandene DDR in starkem Maße auf die Braunkohle, weil in ihrem Gebiet andere Energieträger nur in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung standen. Während 1945 dort 35 % der Elektroenergie aus Steinkohle erzeugt wurden, betrug der Anteil 1976 nur noch 0,6 %. Gerade unter dem Eindruck der Ölkrisen in den 70er Jahren ging man dazu über, alle verfügbaren Braunkohlenlagerstätten in das Energiekonzept einzubeziehen. Im Jahr 1944 lag die Braunkohleforderung bei rund 156 Millionen Tonnen pro 100 m² im Jahr 1989 wurde doppelt soviel Braunkohle gefördert. Dies war, wie man heute weiß, ohne Zweifel eine Überbeanspruchung der natürlichen und technischen Ressourcen. Annähernd 40 Tagebaue waren in Betrieb. In über 50 Fabrikstandorten wurden Kohlever- edlungsprodukte hergestellt. In der Braunkohlenindustrie waren rd. 140 000 Menschen beschäftigt, rechnet man angegliederte Bereiche wie Maschinenbau oder Transportwesen hinzu, kommt man auf annähernd 200 000 Menschen. Die Braunkohle wurde zu 98 % an die Braunkohlekraftwerken verkauft. Sie belieferten in den fünfziger Jahren das modernste Braunkohle Kraftwerk Lübbenau- Vetschau.
5.) Die Braunkohleförderung heute:
Heute beträgt die Arbeitslosigkeit in der gesamten Lausitz rund 25 % das sind rund 16% über den Bundesdurchschnitt. Nach der Wende wurde die Lausitzer Braunkohle Aktiengesellschaft kurz LAUBAG gegründet und 1994 privatisiert. Die LAUBAG fördert heute rund 450 000 m³ Kohle pro Tag. Sie sind heute mit 7000 Arbeitsplätzen immer noch der größte Arbeitgeber in der Lausitz. Heute besitzt die LAUBAG gerade mal noch 5 Tagebaue. Das sind immerhin 35 weniger als vor der Wende. Die LAUBAG beliefert heute das modernste Braunkohlekraftwerk der Welt , welches in Schwarze Pumpe steht und 5 Mrd. DM gekostet hat, dabei hat sich die LAUBAG an dem Bau mit rund 1,5Mrd. DM beteiligt. Der Umsatz der LAUBAG beläuft sich auf rund 1,5Mrd DM pro Jahr.
Die LAUBAG ist allerdings auch durch eventuelle Strompreissenkungen und Rechtsverfahren ( Horno ) finanziell gefährdet.
6.) Die Maßnahmen zur Rekultivierung in der Lausitz ( Prospekte verteilen )
Die DDR hat keinen Wert auf die Rekultivierung gelegt. Sie haben zum Beispiel keine Filter in die Schornsteine eingebaut das führte dazu dass rund 320kg Schwefeldioxid und Kohlenstoffmonoxid pro Einwohner in die Luft verschleudert wurde. Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft müssen rund 50 000 ha rekultivieren. Einige Vergleiche mögen den Umfang der Aufgabe verdeutlichen:
- Ca. 38 500 ha Öd- und nicht rekultiviertes Kippenland sind wieder nutzbar zu machen, ein Gebiet, so groß wie der Landkreis Dresden.
- Insgesamt 164 Tagebau-Restlöcher mit einer Fläche von rd. 220 km², zweimal so groß wie der Müritzsee, sind zu gestalten.
- In den Bergbauregionen besteht insgesamt ein Grundwasserdefizit von 21 Mrd. m³, davon 13 Mrd. m³ in der Lausitz und 8 Mrd. m³ in Mitteldeutschland. Dieses Defizit ist planvoll auszugleichen. In der Lausitz muß dafür gesorgt werden, daß der Spreewald und die Trinkwasserversorgung der Stadt Berlin nicht beeinträchtigt werden. Durch Zuführung von Oberflächenwasser soll die Wiederherstellung eines stabilen Wasserhaushaltes in wenigen Jahrzehnten erreicht werden.
- Viele Kohleverarbeitungsbetriebe, Werkstätten oder Verwaltungsstandorte müssen beräumt und einer Folgenutzung zugeführt werden. Daraus sollen regional-wirtschaftliche Impulse resultieren.
Insgesamt werden 1,5 Mrd. DM pro 100m² Rekultivierungsfläche ausgegeben, dabei bezahlt der Staat rund 1 Mrd. DM und die beteiligten Bergbauländer 0,5 Mrd. DM.
Der Grundwasserdefizit ist dadurch zu erklären, dass zu DDR - Zeiten viel Wasser als Energieträger benötigt wurde. Das Wasser wurde aus den Braunkohlegruben gepumpt und in den Tagebau- Restlöchern gespeichert. Um es länger in der Lausitz zu halten ( Verdunstung ; Absickerung ... ) wurde unter anderem die Flussarme des Spree verbreitet. Nach der Wende wurde kaum noch Wasser gebraucht, sprich es wurde nicht mehr aus den Braunkohlegruben gepumpt. Im Laufe der Zeit, fehlen heute rund 1/3 des Grundwassers. Das ist für die Lausitz fatal, da die Spree wieder rückwärts fließt und die Tagebau-Restlöcher füllt. Wenn man keine finanziellen Mittel zur Unterstützung des Wasserhaltes ausgibt, wird die Spree in ung. 20-30 Jahren vollkommen austrocknet. Das würde bedeuten das die Arbeitslosigkeit um rund 10% steigen würde. (Tourismus...)
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Referat über das Lausitzer Braunkohlegebiet?
Das Referat behandelt die Lage der Lausitz, die Entstehung und Bedeutung von Braunkohle im Allgemeinen, speziell in der Lausitz, die Braunkohleförderung zu DDR-Zeiten und heute, sowie Maßnahmen zur Rekultivierung in der Lausitz.
Wo liegt die Lausitz und welche Besonderheiten hat sie bezüglich der Braunkohle?
Die Lausitz liegt im Südosten Brandenburgs bis hin zum Nordosten Sachsens. Geologisch sind dort 13 Milliarden Tonnen Kohle vorhanden, wovon 5,9 Milliarden Tonnen wirtschaftlich gewinnbar sind. Die Lausitz ist das zweitgrößte Braunkohlegebiet Deutschlands.
Wie ist Braunkohle entstanden und wie viel gibt es davon in Deutschland?
Braunkohle entstand vor ungefähr 62-2 Millionen Jahren durch Aufschichtungen von Pflanzen, Torf, Meeressand und Kies. In Deutschland gibt es rund 78 Milliarden Tonnen Braunkohle, wovon 48 Milliarden Tonnen wirtschaftlich gewinnbar sind.
Wie alt ist die Braunkohle in der Lausitz und welche Qualität hat sie?
Die Braunkohle in der Lausitz ist vor rund 15-20 Millionen Jahren entstanden. Die Flöze befinden sich in 40-120m Tiefe und sind 8-15m dick. Die Qualität ist mittelmäßig gut, und der Schwefelgehalt beträgt rund 0,3%-1%.
Wann wurde die Braunkohle in der Lausitz entdeckt und wirtschaftlich genutzt?
Die Braunkohle wurde 1789 zum ersten Mal in der Niederlausitz gefunden und 1850 zum ersten Mal wirtschaftlich genutzt. Die erste Brikettfabrik der Welt wurde 1872 in Betrieb genommen.
Wie wurde die Braunkohleförderung zu DDR-Zeiten betrieben?
Die DDR setzte stark auf Braunkohle, da andere Energieträger nur begrenzt zur Verfügung standen. Die Förderung wurde stark ausgebaut, was zu einer Überbeanspruchung der natürlichen und technischen Ressourcen führte. Es waren annähernd 40 Tagebaue in Betrieb, und rund 140.000 Menschen waren in der Braunkohlenindustrie beschäftigt.
Wie sieht die Braunkohleförderung heute in der Lausitz aus?
Heute ist die Arbeitslosigkeit in der Lausitz hoch. Die LAUBAG (Lausitzer Braunkohle Aktiengesellschaft) wurde gegründet und privatisiert. Sie fördert heute rund 450.000 m³ Kohle pro Tag und ist mit 7000 Arbeitsplätzen der größte Arbeitgeber in der Lausitz. Es gibt nur noch 5 Tagebaue.
Welche Maßnahmen werden zur Rekultivierung in der Lausitz durchgeführt?
Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft muss rund 50.000 ha rekultivieren. Dazu gehört die Wiederherstellung von Kippenland, Gestaltung von Tagebau-Restlöchern und Ausgleich des Grundwasserdefizits. Es werden insgesamt 1,5 Mrd. DM pro 100m² Rekultivierungsfläche ausgegeben.
Welche Probleme gibt es mit dem Grundwasserdefizit in der Lausitz?
Zu DDR-Zeiten wurde viel Wasser aus den Braunkohlegruben gepumpt. Nach der Wende wurde weniger Wasser benötigt, was zu einem Grundwasserdefizit führte. Dies führt dazu, dass die Spree rückwärts fließt und die Tagebau-Restlöcher füllt. Es besteht die Gefahr, dass die Spree austrocknet, was die Arbeitslosigkeit erhöhen würde.
Was ist das Problem mit dem Lausitzer Dorf Horno?
Horno soll laut LAUBAG umgebaggert werden, und die Bewohner haben gegen die LAUBAG vor dem Landgericht geklagt.
- Quote paper
- Christopher Finck (Author), 2000, Lausitzer Braunkohlegebiet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98534