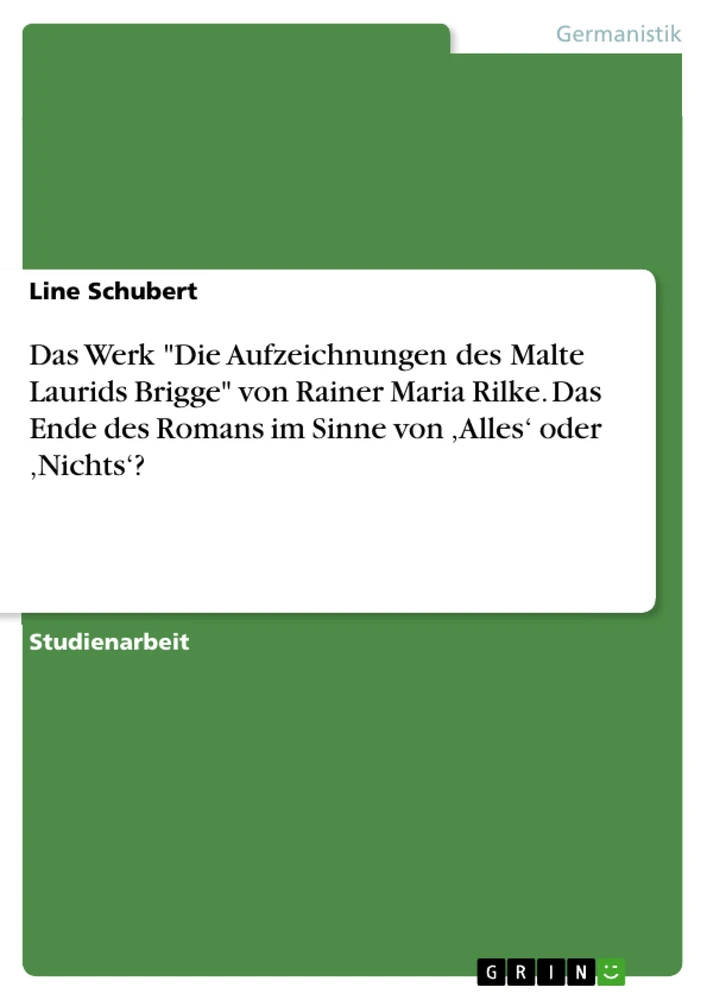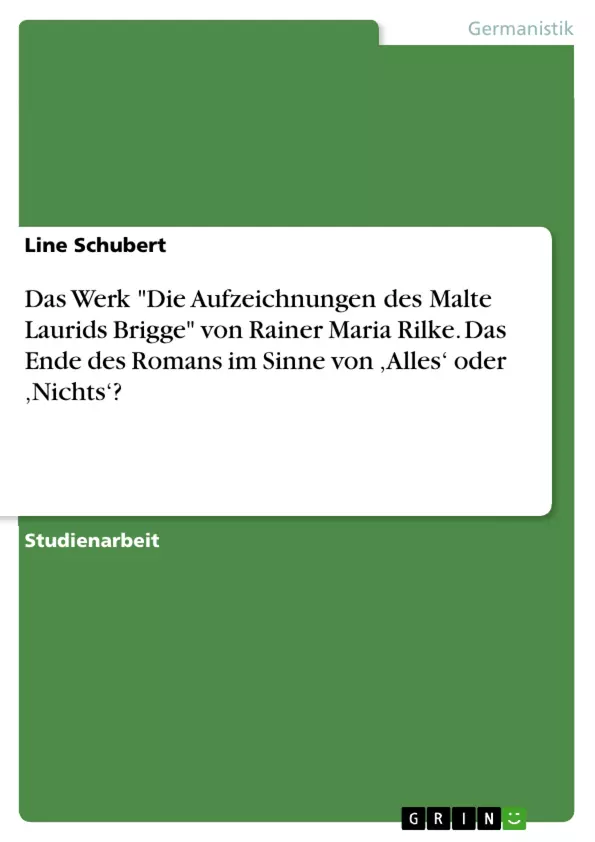Die Arbeit widmet sich vor der Umbruchs– und Stagnationsthematik im Malte anhand ausgewählter Aufzeichnungen gezielt der Fragestellung, ob der Romanausgang als Ende oder Anfang, als ‚Nichts‘ oder ‚Alles‘, gedeutet werden kann. Rainer Maria Rilke schreibt von 1904 bis 1910 an den „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“. Aus dieser Zeitspanne gehen 71 fragmentarische Aufzeichnungen hervor, welche den Übergang zur Moderne während der Jahrhundertwende im Raum der Pariser Großstadt spiegeln. Decker (2004) betont, dass Paris auch im Leben Rilkes eine entscheidende Rolle als ein zentraler Ort der Anziehung und Abstoßung spielt. Maltes Autor empfindet seine Zeit in der Stadt als kraftraubend, dennoch kehrt er immer wieder zur abstoßenden Quelle zurück und erfährt Paris als Medium der Selbstbegegnung. Überträgt Rilke demnach einen Bruchteil seines Ich in die Hauptfigur, indem er Malte vom Land in die neue Welt der Großstadt schickt und ihn dort einsam zurücklässt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vom,Sehen lernen in Paris...
- Im Negativ der Großstadt
- Im Positiv der Großstadt..
- Entwicklung im Malte?
- Aufzeichnung 14 als brüchiger Umbruch….
- Aufzeichnungen 15 und 16 in neuer Deutung ......
- Notwendiger Ich-Zerfall
- „Eine vollkommen andere Auffassung aller Dinge”
- Maltes Kindheit im Spiegel der Großstadtproblematiken
- Ein Übergang
- Blumen, Rot und Ich-Spaltung als wiederkehrende Elemente
- Von Fieber und Spiegeln
- Der Tod als Anfang
- Das (fremde) Ich in der Krise
- Der falsche Zar
- Karl der Kühne
- Die Möglichkeiten des Romanausgangs – „Alles' oder, Nichts\"?.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob der Romanausgang von Rainer Maria Rilkes „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ als Ende oder Anfang, als „Nichts“ oder „Alles“ gedeutet werden kann. Sie analysiert ausgewählte Aufzeichnungen im Kontext der Umbruchs- und Stagnationsthematik des Werkes.
- Maltes Entwicklung als Figur im Spannungsfeld von Umbruch und Stagnation
- Die Rolle von Paris als Ort der Selbstbegegnung und der Konfrontation mit der modernen Großstadt
- Die Bedeutung des „Sehen Lernens“ für Maltes Wahrnehmung und Schreibprozess
- Die Ambivalenz von Maltes Ich-Identität und der Einfluss des Todes auf seine Selbstfindung
- Die Deutungsmöglichkeiten des Romanausgangs und die Frage nach seiner Offenheit oder Geschlossenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext des Werkes „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ und die zentrale Fragestellung der Arbeit einführt. Kapitel 2 befasst sich mit Maltes „Sehen lernen in Paris“ und analysiert die Stadt zunächst als Ort der negativen Erfahrungen, geprägt von Hässlichkeit, Krankheit und Tod. Anschließend werden die Aufzeichnungen beleuchtet, die ein positiveres Bild von Paris zeichnen, mit Fokus auf Maltes veränderte Wahrnehmung und seine neue Sichtweise.
Kapitel 3 geht der Frage nach, ob Maltes Entwicklung im Werk als Umbruch oder Stagnation zu verstehen ist. Es analysiert die Aufzeichnung 14, in der Malte seinen Schreibprozess in Frage stellt und gleichzeitig eine neue Sichtweise auf seine künstlerische Arbeit entwickelt. Die Aufzeichnungen 15 und 16 zeigen Maltes Rückzug in seine Kindheit und seine Auseinandersetzung mit dem Tod und dem „Unsichtbaren“, die ihm durch die „Gabe“ seines Großvaters Brahe ermöglicht wird.
In Kapitel 4 werden Maltes Kindheitserfahrungen und ihre Verbindung zu den Großstadtproblematiken des Werkes beleuchtet. Es wird untersucht, wie die wiederkehrenden Elemente der Blumen, des Roten und der Ich-Spaltung die Entwicklung der Figur prägen.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“, Rainer Maria Rilke, Großstadt, Paris, Sehen lernen, Umbruch, Stagnation, Ich-Identität, Tod, Romanausgang, „Nichts“, „Alles“.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Rilkes „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“?
Der Roman spiegelt in 71 fragmentarischen Aufzeichnungen den Übergang zur Moderne wider. Er thematisiert die Einsamkeit, den Ich-Zerfall und die Konfrontation mit der Großstadt Paris um die Jahrhundertwende.
Was bedeutet „Sehen lernen“ für die Hauptfigur Malte?
Es beschreibt einen Prozess der veränderten Wahrnehmung, bei dem Malte lernt, die hässlichen und grausamen Aspekte der Realität (Tod, Krankheit, Armut) ungeschönt zu betrachten und literarisch zu verarbeiten.
Welche Rolle spielt Paris im Roman?
Paris fungiert als Ort der Anziehung und Abstoßung zugleich. Die Stadt ist ein Medium der Selbstbegegnung, das Malte zwar Kraft raubt, ihm aber auch eine neue künstlerische Sichtweise ermöglicht.
Ist der Ausgang des Romans als Ende oder Anfang zu deuten?
Die Arbeit untersucht genau diese Ambivalenz: Ob Maltes Weg im „Nichts“ (völliger Zerfall) oder im „Alles“ (einem neuen spirituellen oder künstlerischen Anfang) mündet.
Wie hängen Maltes Kindheit und die Großstadtproblematik zusammen?
Maltes Erinnerungen an seine Kindheit spiegeln oft dieselben Ängste und Spaltungserfahrungen wider, die er in der modernen Großstadt erlebt, was auf eine tiefere Krise der Identität hindeutet.
- Citar trabajo
- Line Schubert (Autor), 2020, Das Werk "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" von Rainer Maria Rilke. Das Ende des Romans im Sinne von ‚Alles‘ oder ‚Nichts‘?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/985609