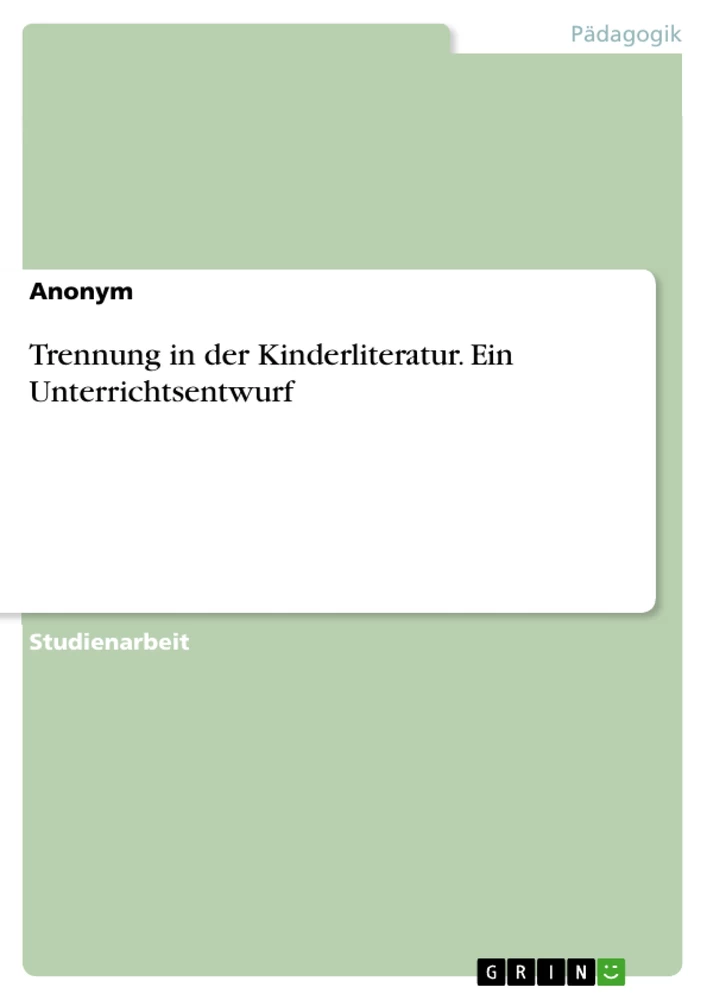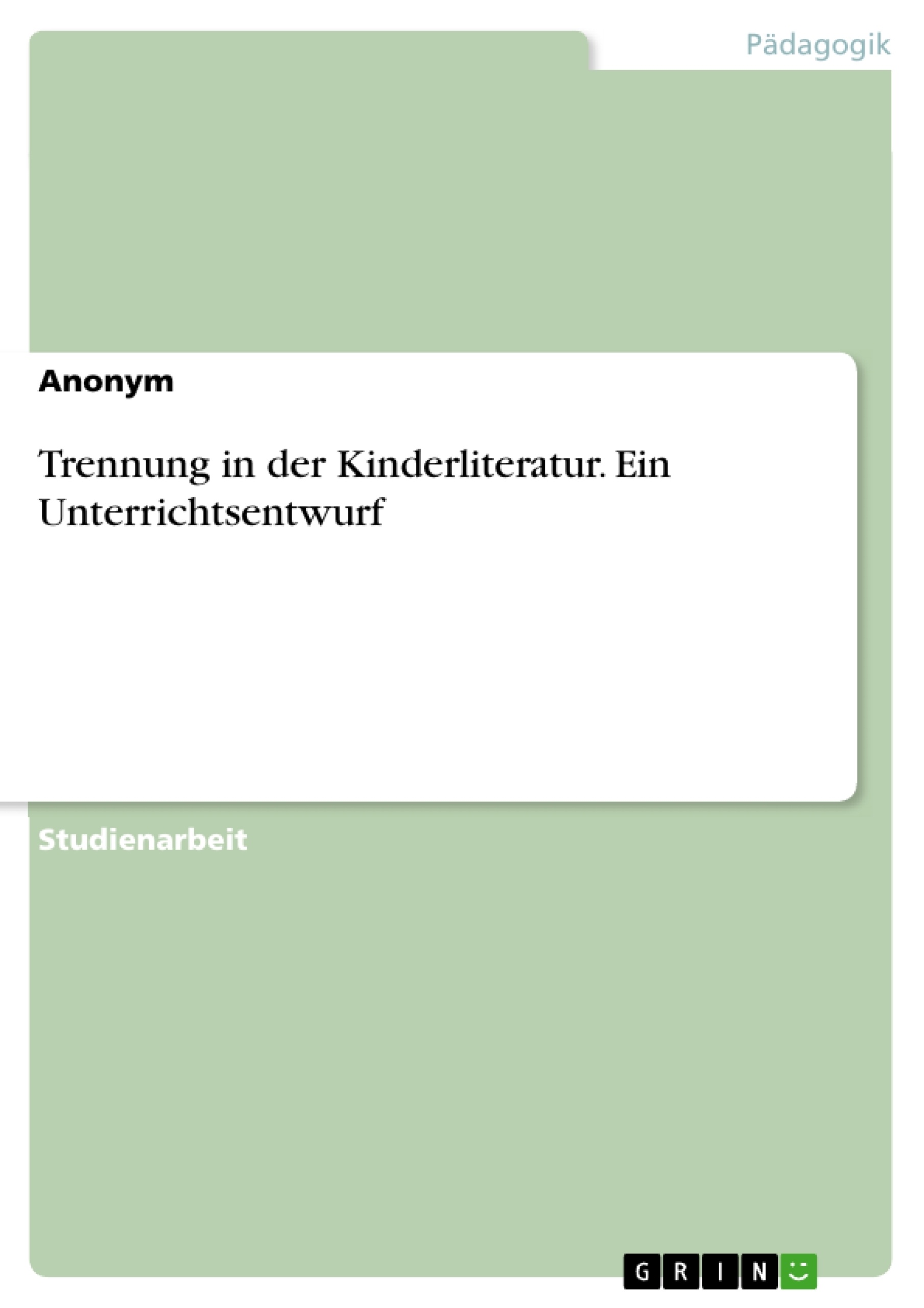Die Thematik der Trennung nimmt in unserer Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert ein, insbesondere im Zusammenhang mit Familien und der Literatur- und Leseerziehung von Kindern. Diese Seminararbeit widmet sich dem faszinierenden Thema "Trennung" in der Kinderliteratur und beleuchtet dabei die vielschichtigen Facetten dieser Herausforderung. Die Auswahl dieses Themas wird nicht nur durch die aktuelle gesellschaftliche Brisanz motiviert, sondern auch durch das zunehmende Bedürfnis, sich intensiver mit den Auswirkungen von Trennungen auf Kinder auseinanderzusetzen.
Die steigende Anzahl von Scheidungen in der heutigen Gesellschaft verdeutlicht die aktuelle Brisanz des Themas "Trennung". Statistiken zeigen einen dramatischen Anstieg von 13,9% im Jahr 1960 auf 40,98% im Jahr 2017 aller geschlossenen Ehen in Österreich. Die zunehmende Häufigkeit von Trennungen stellt eine Herausforderung für Kinder dar, die sich in einer familiären Umgebung befinden, die von solchen Veränderungen geprägt ist. Dieser gesellschaftliche Kontext unterstreicht die Notwendigkeit einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema in verschiedenen Kontexten, insbesondere in der Literatur- und Leseerziehung.
Im Folgenden werden verschiedene Aspekte rund um das Thema "Trennung" beleuchtet, angefangen bei einer Definition von Familie über die Ursachen von Trennungen bis hin zu den Konsequenzen, sowohl negativen als auch positiven. Zwei ausgewählte Kinderbücher, "Nuno geteilt durch Zwei" und "Elternkleber", werden genauer betrachtet, um deren Beitrag zur Sensibilisierung und Verarbeitung des Themas bei Kindern zu analysieren. Darüber hinaus werden auch Unterrichtsplanung und Materialien vorgestellt, um die Integration dieses Themas in die Literatur- und Leseerziehung zu erleichtern.
Inhaltsverzeichnis
- WARUM WURDE DAS THEMA „TRENNUNG“ AUSGEWÄHLT
- Persönliche Erfahrungen
- Gegenwärtige Brisanz des Themas
- WAS IST FAMILIE ÜBERHAUPT?
- Die „normale“ Familie
- Familie früher vs. Familie heute
- Weitere Formen von Familie
- TRENNUNG
- Wann trennen sich Paare
- Konsequenzen einer Trennung bzw. Scheidung
- Negative Konsequenzen
- Positive Konsequenzen
- Alternative: Eine Woche Mama - eine Woche Papa
- KINDERBUCH „NUNO GETEILT DURCH ZWEI“
- KINDERBUCH „ELTERNKLEBER“
- UNTERRICHTSPLANUNG
- MATERIAL
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Thema „Trennung“ in der Kinderliteratur, wobei der Fokus auf die Darstellung der Trennungserfahrungen von Kindern liegt. Dabei werden die Auswirkungen von Trennung und Scheidung auf Kinder analysiert und es wird untersucht, wie Kinderbücher dieses Thema aufgreifen und Kindern beim Verstehen und Verarbeiten der Situation helfen können.
- Die verschiedenen Auswirkungen von Trennung und Scheidung auf Kinder
- Die Darstellung von Trennungserfahrungen in der Kinderliteratur
- Die Bedeutung von Kinderbüchern als Instrument zur emotionalen Unterstützung von Kindern in Trennungs- und Scheidungssituationen
- Die Relevanz des Themas „Trennung“ im Kontext der heutigen Gesellschaft und der gestiegenen Scheidungsraten
- Die Rolle von Familien und Schulen bei der Unterstützung von Kindern in Trennungssituationen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die persönliche Motivation der Verfasserin, sich mit dem Thema „Trennung“ in der Kinderliteratur auseinanderzusetzen. Es wird auf die eigenen Erfahrungen der Verfasserin mit der Trennung ihrer Eltern eingegangen und der aktuelle gesellschaftliche Kontext, der von einem Anstieg der Scheidungsraten geprägt ist, beleuchtet. Im zweiten Kapitel wird der Begriff „Familie“ analysiert und die verschiedenen Formen der Familie, die es heute gibt, werden vorgestellt. Dabei wird auch auf die historische Entwicklung des Familienbildes eingegangen. Das dritte Kapitel fokussiert sich auf die Thematik „Trennung“ selbst und behandelt verschiedene Aspekte wie die Gründe für Trennungen, die Konsequenzen von Trennung und Scheidung für Kinder sowie alternative Modelle der Familienorganisation nach einer Trennung.
Schlüsselwörter
Die Kernthemen dieser Seminararbeit sind die Trennung von Eltern, die Auswirkungen auf Kinder, Kinderliteratur, Familienformen, Familientherapie und die emotionale Unterstützung von Kindern in schwierigen Lebenslagen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist das Thema Trennung in der Kinderliteratur aktuell so brisant?
Aufgrund der stark gestiegenen Scheidungsraten (z.B. über 40% in Österreich) ist Trennung für viele Kinder eine unmittelbare Lebenserfahrung, die literarisch aufgearbeitet werden muss.
Welche Kinderbücher werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit untersucht die Bücher „Nuno geteilt durch Zwei“ und „Elternkleber“ als Hilfsmittel zur emotionalen Verarbeitung von Trennungen.
Welche positiven Konsequenzen kann eine Trennung für Kinder haben?
Neben den oft thematisierten negativen Folgen beleuchtet die Arbeit auch positive Aspekte, wie das Ende von elterlichen Konflikten und ein harmonischeres Umfeld.
Was ist das „Nestmodell“ (eine Woche Mama - eine Woche Papa)?
Es wird als alternatives Modell der Familienorganisation nach einer Trennung vorgestellt, bei dem die Kinder stabil an einem Ort bleiben oder regelmäßig zwischen den Eltern pendeln.
Wie kann die Schule Kinder in Trennungssituationen unterstützen?
Die Arbeit bietet Unterrichtsplanungen und Materialien an, um das Thema sensibel in die Leseerziehung zu integrieren und betroffenen Kindern eine Stimme zu geben.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Trennung in der Kinderliteratur. Ein Unterrichtsentwurf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/986016