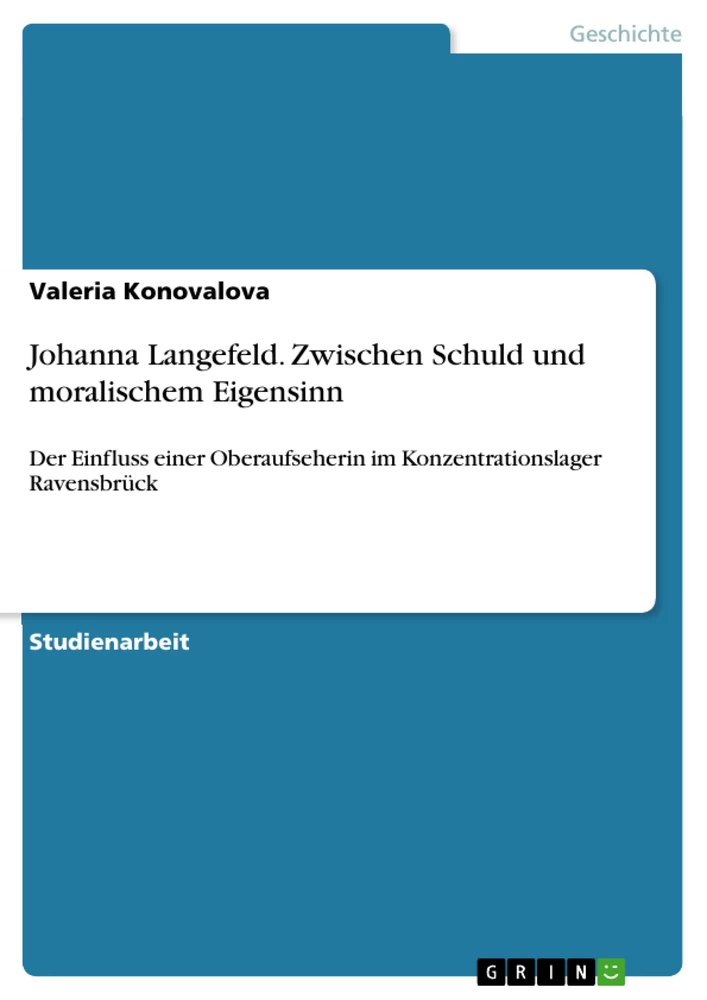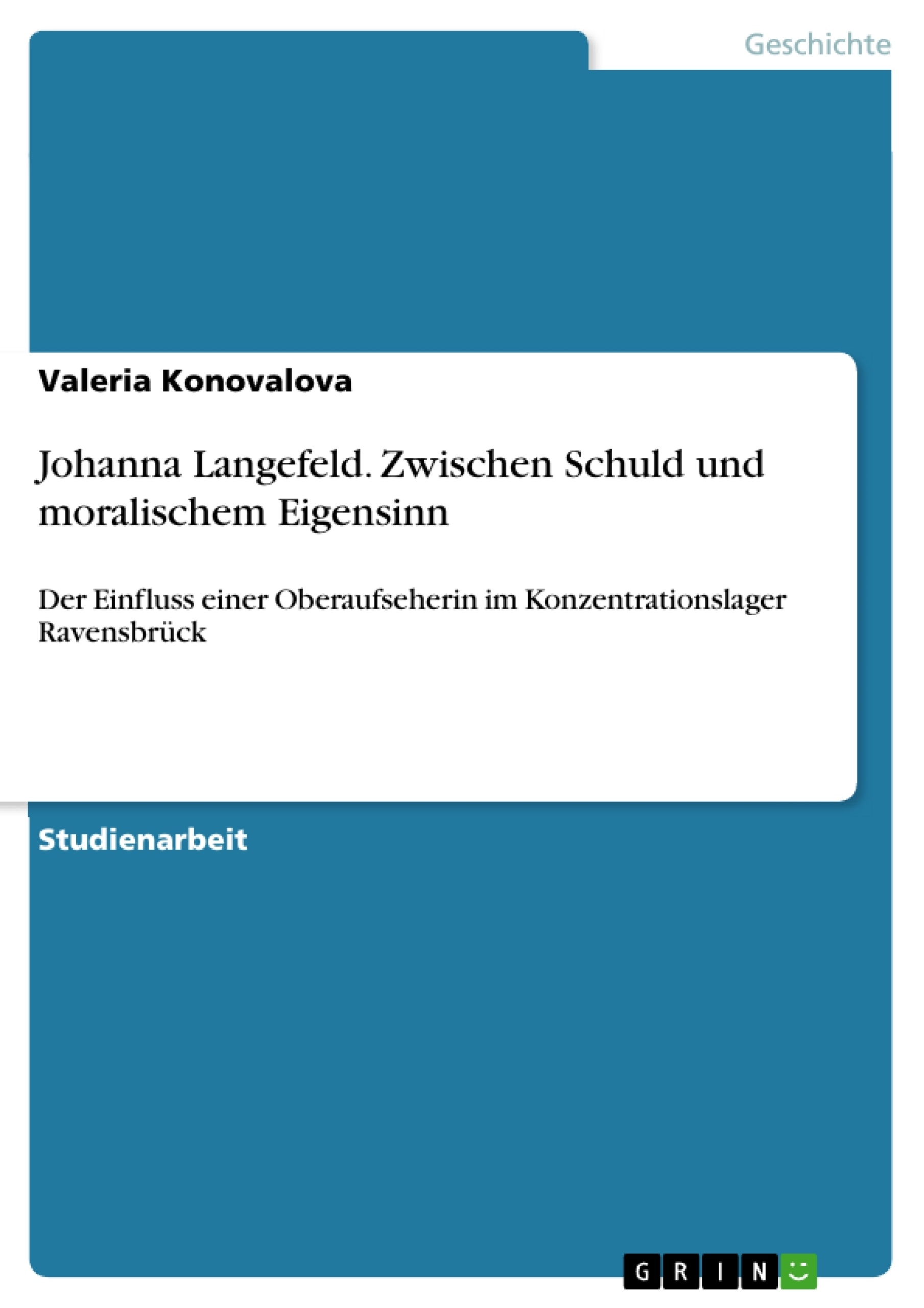Um den Einstieg in die vorliegende Arbeit zu erleichtern, wird zunächst die Person Johanna Langefeld kurz vorgestellt und ihr Weg in das Konzentrationslager Ravensbrück rekonstruiert. Dabei werden die möglichen Motive einer solchen Rekrutierung genannt. Im Anschluss folgt eine Analyse über die Unterschiede Langefelds im Gegensatz zu den anderen Aufseherinnen. Dies wird unternommen, da es einige Anhaltspunkte und Aussagen ehemaliger Insassinnen gibt, die Grund zur Annahme geben, dass sich Johanna Langefeld als Sonderfall darstellt. Als ein solcher Anhaltspunkt gilt auch die Quelle der damaligen persönlichen Sekretärin Langefelds Margarete Buber-Neumann.
Diese lernte die Aufseherin kennen, als sie 1942 als ihre Schreiberin eingeteilt wurde.3 Nach einer kurzen Vorstellung Buber-Neumanns erfolgt eine äußere und innere Quellenkritik, bei der der Entstehungskontext, die Funktion und Reliabilität geklärt werden soll. In einem abschließenden Schlussteil werden die Erkenntnisse des Hauptteils zusammengefasst und mit einem Fazit abgerundet. Dass sie sich ebenso wie ihre Kolleginnen und Kollegen durch ihre abscheulichen und unvergesslichen Taten im Lageralltag der Häftlinge auszeichnete, sollte dabei nicht unerwähnt bleiben. Dennoch nimmt die Aufseherin Langefeld eine gesonderte Rolle in der Erinnerung und Forschung ein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand / Wer war Johanna Langefeld?
- 2.1 Motivation einer Aufseherin
- 3. Quellenkritik
- 4. Schlusswort
- 6. Rezension zu Johannes Schwartz „Weibliche Angelegenheiten“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Oberaufseherin Johanna Langefeld im Konzentrationslager Ravensbrück. Ziel ist es, Langefelds Sonderrolle im Vergleich zu anderen Aufseherinnen zu beleuchten und die Motive ihrer Handlungsweise zu analysieren. Die Arbeit stützt sich auf Zeitzeugenaussagen und historische Dokumente.
- Johanna Langefelds Biografie und Weg nach Ravensbrück
- Motivationen von SS-Aufseherinnen im Allgemeinen
- Vergleich Langefelds mit anderen Aufseherinnen
- Quellenkritik der verwendeten Materialien
- Langefelds Rolle in der Erinnerungskultur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt Johanna Langefeld als eine außergewöhnliche Figur unter den Aufseherinnen in Ravensbrück vor, deren Handlungen und Motive im Fokus der Arbeit stehen. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der von einer kurzen Vorstellung Langefelds über die Analyse ihrer Rolle bis hin zur Quellenkritik reicht. Der besondere Fokus liegt auf dem Vergleich Langefelds mit anderen Aufseherinnen, gestützt auf Aussagen ehemaliger Insassinnen und der Quelle der Sekretärin Margarete Buber-Neumann.
2. Forschungsstand / Wer war Johanna Langefeld?: Dieses Kapitel beleuchtet den bisherigen Forschungsstand zum Thema SS-Aufseherinnen im Allgemeinen und geht auf die späte Beachtung dieses Themas in der Geschichtswissenschaft ein. Es präsentiert eine biografische Skizze Johanna Langefelds, von ihrer Geburt bis zu ihrer Tätigkeit als Oberaufseherin in Ravensbrück. Dabei werden wichtige Stationen ihres Lebens, wie ihre Berufstätigkeit vor dem Krieg und ihr Beitritt zur NSDAP, hervorgehoben, um ihren Weg in das Konzentrationslager nachvollziehbar zu machen.
2.1 Motivation einer Aufseherin: Dieses Kapitel analysiert die vielfältigen Motive, die Frauen dazu bewogen, als Aufseherinnen in Konzentrationslagern zu arbeiten. Es werden Faktoren wie die Werbemethoden der SS, die Aussicht auf Arbeit und sozialen Aufstieg, die finanzielle Absicherung und die Nähe zum Wohnort diskutiert. Im Kontext von Langefelds Fall wird zusätzlich das Motiv der Fortsetzung eines sozialen Berufs und der Wunsch nach Umerziehung der Häftlinge thematisiert. Die Glaubwürdigkeit der verschiedenen Motivationshypothesen wird kritisch hinterfragt.
Schlüsselwörter
Johanna Langefeld, Ravensbrück, SS-Aufseherin, Frauen im Nationalsozialismus, Konzentrationslager, Motivation, Quellenkritik, Margarete Buber-Neumann, Erinnerungskultur, soziale Mobilität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Johanna Langefeld
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Oberaufseherin Johanna Langefeld im Konzentrationslager Ravensbrück. Der Fokus liegt auf der Analyse ihrer Sonderrolle im Vergleich zu anderen Aufseherinnen und der Erforschung ihrer Handlungsmotivationen.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Zeitzeugenaussagen und historische Dokumente. Besonderer Wert wird auf die Quellenkritik gelegt. Die Aussagen ehemaliger Insassinnen und die Quelle der Sekretärin Margarete Buber-Neumann spielen eine wichtige Rolle.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Johanna Langefelds Biografie und Weg nach Ravensbrück; Motivationen von SS-Aufseherinnen im Allgemeinen; Vergleich Langefelds mit anderen Aufseherinnen; Quellenkritik der verwendeten Materialien; Langefelds Rolle in der Erinnerungskultur.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zum Forschungsstand und zu Johanna Langefelds Biografie, ein Kapitel zur Motivation von Aufseherinnen, ein Kapitel zur Quellenkritik und ein Schlusswort. Zusätzlich enthält sie eine Rezension zu Johannes Schwartz „Weibliche Angelegenheiten“.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet die Vorschau?
Die Vorschau bietet Zusammenfassungen der Einleitung (Vorstellung Langefelds und des Arbeitsaufbaus), des Kapitels zum Forschungsstand (biografische Skizze Langefelds und bisherige Forschung zu SS-Aufseherinnen), und des Kapitels zur Motivation einer Aufseherin (Analyse der Motive von Frauen, die als Aufseherinnen arbeiteten).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Johanna Langefeld, Ravensbrück, SS-Aufseherin, Frauen im Nationalsozialismus, Konzentrationslager, Motivation, Quellenkritik, Margarete Buber-Neumann, Erinnerungskultur, soziale Mobilität.
Welches ist das übergeordnete Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, Langefelds Sonderrolle im Vergleich zu anderen Aufseherinnen zu beleuchten und die Motive ihrer Handlungsweise zu analysieren.
Welche Aspekte von Johanna Langefelds Leben werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet Langefelds Biografie, ihren Weg nach Ravensbrück, ihre Berufstätigkeit vor dem Krieg und ihren Beitritt zur NSDAP, um ihren Weg in das Konzentrationslager nachvollziehbar zu machen.
Wie wird die Motivation von SS-Aufseherinnen analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Motivationsfaktoren, wie Werbemethoden der SS, Aussicht auf Arbeit und sozialen Aufstieg, finanzielle Absicherung, Nähe zum Wohnort, Fortsetzung eines sozialen Berufs und Wunsch nach Umerziehung der Häftlinge. Die Glaubwürdigkeit der verschiedenen Hypothesen wird kritisch hinterfragt.
- Quote paper
- Valeria Konovalova (Author), 2020, Johanna Langefeld. Zwischen Schuld und moralischem Eigensinn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/986218