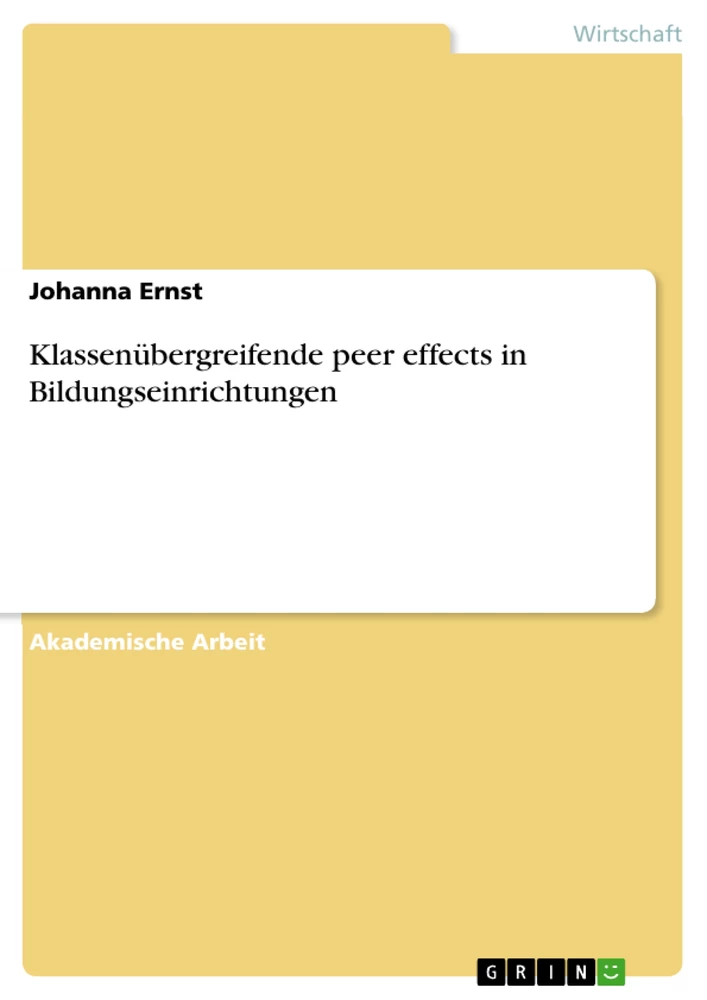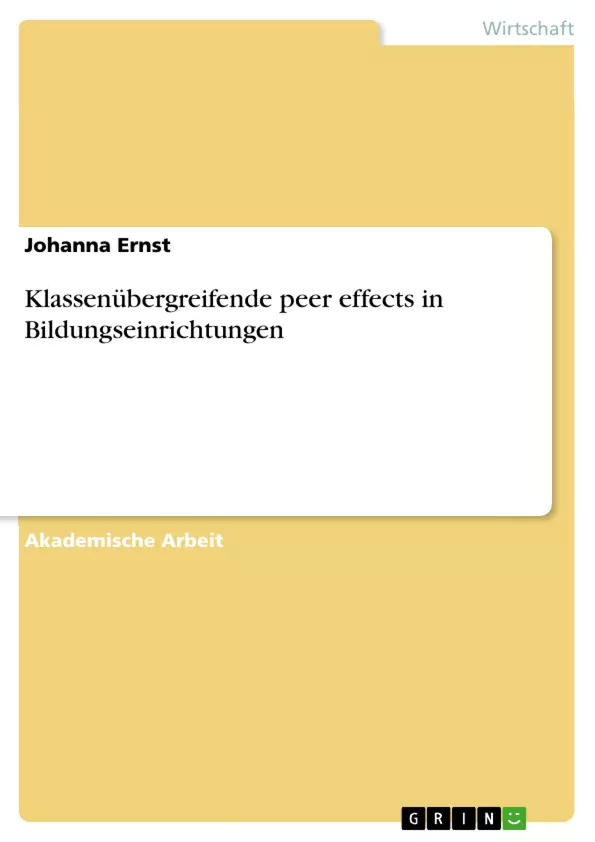Im Folgenden möchte ich drei Studien der empirischen Wirtschaftsforschung vorstellen, welche sich mit den Auswirkungen eines geförderten Kontakts zwischen Mitgliedern unterschiedlicher sozialer und ethnischer Gruppen beschäftigen, und diese im Anschluss miteinander vergleichen.
Vorurteile und Diskriminierung gegenüber Menschen fremder sozialer Lagen und Ethnien bilden auch in der heutigen Zeit ein zentrales gesellschaftliches Problem. Verfechter einer Förderung von Diversität und Integration von Minoritäten betonen die gesellschaftlichen Vorurteile, die sich durch eine erhöhte Nähe und verstärkte Kommunikation mit Menschen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft ergeben. Durch weniger Vorurteile lassen sich Konflikte zwischen unterschiedlichen Gruppen lindern. Außerdem sind interkulturelle Kompetenzen längst zu einer zentralen Anforderung in einer globalisierten Arbeits- und Lebenswelt geworden.
Inhaltsverzeichnis
- Peer effects beeinflussen interkulturelle und gruppenübergreifende Einstellungen
- How do Friendships form: Eine Studie von David Marmaros und Bruce Sacerdote
- Was beeinflusst die Interaktion zwischen Menschen unterschiedlicher und gleicher Herkunft?
- Die Datenerhebung
- Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
- Zusammenfassung und Ausblick
- Empathy or Antipathy? The Impact of Diversity. Eine Studie von Johanne Boisjoly, Greg J. Duncan u.a.
- Beeinflusst das Zusammenwohnen mit Menschen anderer Ethnien die eigenen interkulturellen Einstellungen?
- Die Datenerhebung
- Deskriptive Statistiken
- Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
- Robuste Schätzer
- Zusammenfassung und Ausblick
- Familiarity Does Not Breed Contempt: Generosity, Discrimination an Diversity in Delhi Schools. Eine Studie von Gautam Rao
- Wie beeinflussen ärmere Mitschüler die gruppenübergreifenden Einstellungen von Schülern aus wohlhabenderen Familien?
- Identifikations-Strategien
- Aufbau der Experimente und Interpretation der Ergebnisse
- Zusammenfassung und Ausblick
- Vergleich der drei Studien
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht den Einfluss von Peer-Effekten in Bildungseinrichtungen auf die soziale Interaktion von Menschen unterschiedlicher sozioökonomischer und ethnischer Herkunft sowie auf sozialgerechte und interkulturelle Einstellungen gegenüber Minoritäten.
- Die Auswirkungen von direktem Kontakt und Interaktion auf die Bildung von Vorurteilen und Diskriminierung
- Die Rolle von Peer-Effekten in der Gestaltung sozialer Interaktionen und Einstellungen
- Die Untersuchung der Bedeutung von Ethnizität, familiärem Hintergrund und gemeinsamen Interessen in der Bildung von Beziehungen
- Die Analyse von empirischen Studien zur Untersuchung von Peer-Effekten in verschiedenen Kontexten
- Der Vergleich der Ergebnisse verschiedener Studien zur Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit befasst sich mit drei empirischen Studien, die sich mit dem Einfluss von Peer-Effekten auf interkulturelle und gruppenübergreifende Einstellungen auseinandersetzen.
- How do Friendships form: Eine Studie von David Marmaros und Bruce Sacerdote analysiert die Entstehung sozialer Beziehungen unter College-Mitbewohnern am Dartmouth College, wobei der Fokus auf der Untersuchung der Auswirkungen von Ethnizität, familiärem Hintergrund und gemeinsamen Interessen auf die Bildung von Beziehungen liegt. Die Autoren untersuchen, inwieweit die geographische Nähe, die Ethnie, der familiäre Hintergrund und gemeinsame Interessen die Interaktion von College-Mitbewohnern beeinflussen.
- Empathy or Antipathy? The Impact of Diversity. Eine Studie von Johanne Boisjoly, Greg J. Duncan u.a. untersucht den Einfluss des Zusammenlebens mit Menschen anderer Ethnien auf die eigenen interkulturellen Einstellungen. Die Studie konzentriert sich auf die Frage, ob das Zusammenwohnen mit Menschen anderer Ethnien die interkulturellen Einstellungen beeinflusst. Die Autoren untersuchen die Auswirkungen von Diversität auf die interkulturellen Einstellungen und das Empathie-Verhalten.
- Familiarity Does Not Breed Contempt: Generosity, Discrimination an Diversity in Delhi Schools. Eine Studie von Gautam Rao untersucht den Einfluss von ärmere Mitschüler auf die gruppenübergreifenden Einstellungen von Schülern aus wohlhabenderen Familien. Die Studie befasst sich mit der Frage, wie ärmere Mitschüler die Einstellungen von Schülern aus wohlhabenderen Familien gegenüber anderen Gruppen beeinflussen. Die Autoren untersuchen die Auswirkungen von Diversität auf die Einstellungen von Schülern in Delhi-Schulen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Peer-Effekte, interkulturelle Einstellungen, soziale Interaktion, Diversität, Integration, Diskriminierung, Ethnizität, sozioökonomischer Hintergrund, empirische Wirtschaftsforschung, Studien, Dartmouth College, Delhi Schools.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Peer-Effekte in Bildungseinrichtungen?
Peer-Effekte bezeichnen den Einfluss, den Gleichaltrige (Peers) auf das Verhalten, die Einstellungen und den Bildungserfolg eines Einzelnen innerhalb einer Gruppe oder Klasse haben.
Fördert Diversität in Schulen automatisch die Toleranz?
Studien wie die von Gautam Rao zeigen, dass Kontakt zu Schülern aus anderen sozialen Schichten Vorurteile abbauen und die Großzügigkeit fördern kann, sofern der Kontakt positiv gestaltet wird.
Wie beeinflussen Zimmernachbarn im College die Freundschaftsbildung?
Die Studie von Marmaros und Sacerdote belegt, dass räumliche Nähe (z.B. gemeinsames Wohnen) die Wahrscheinlichkeit für interethnische Freundschaften massiv erhöht, unabhängig von der Herkunft.
Führt mehr Kontakt zu anderen Ethnien zu mehr Empathie?
Die Untersuchung von Boisjoly et al. deutet darauf hin, dass das Zusammenleben mit Personen anderer Ethnien die interkulturelle Kompetenz und das Verständnis für Diversität stärkt.
Können Peer-Effekte Diskriminierung verringern?
Ja, durch gezielte Mischung von sozialen Gruppen in Bildungseinrichtungen können Stereotype durch reale Erfahrungen ersetzt und diskriminierende Einstellungen reduziert werden.
- Quote paper
- Johanna Ernst (Author), 2019, Klassenübergreifende peer effects in Bildungseinrichtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/986266