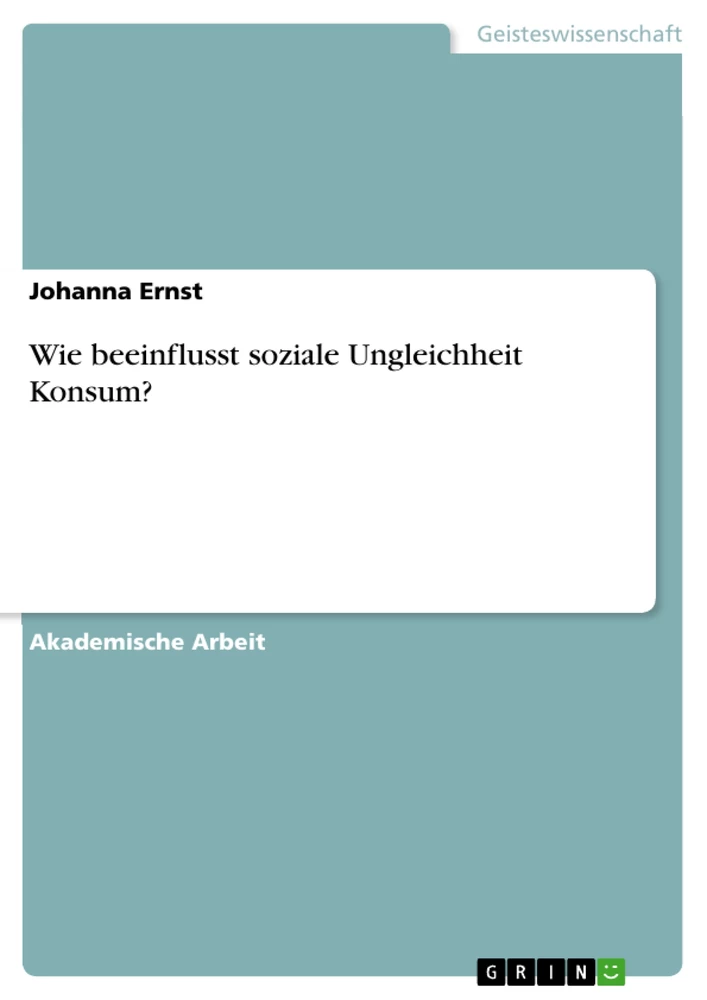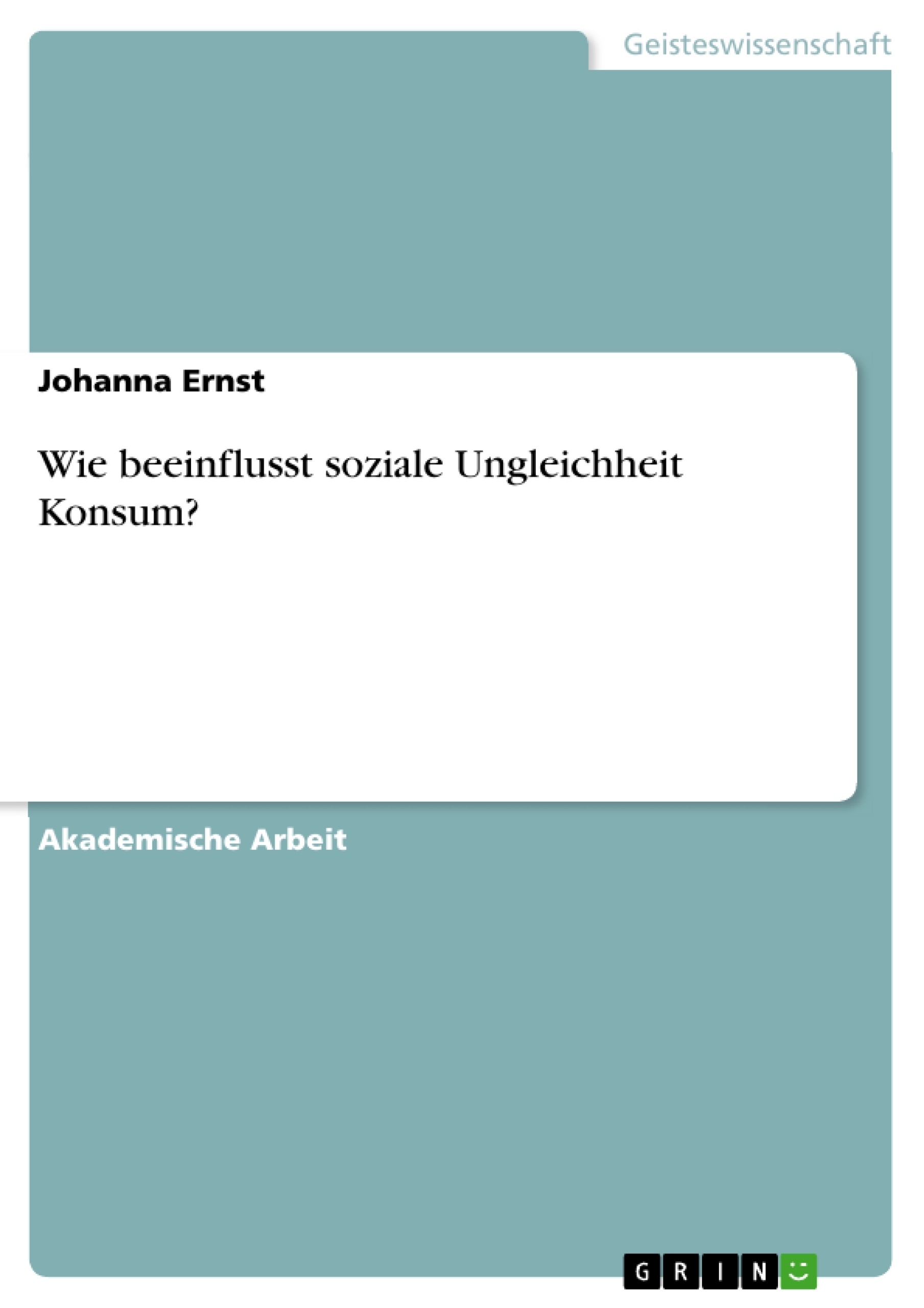In meiner Arbeit soll gezeigt werden, wie sich die Differenzen unterschiedlicher sozialer Gruppen im Konsum seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert verändern konnten.
In unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen wird heute die Erkenntnis vertreten, dass sich die Gesellschaft des 20. Jahrhunderts zu einer Konsumgesellschaft entwickelt hat. Konsum, also der Erwerb sowie die Verwendung und der Gebrauch von Gütern und Dienstleistungen, besitzt eine weitreichende kulturelle, soziale und ökonomische Bedeutung. Die soziale Bedeutung, die Konsum haben kann, zeigt ein Artikel des Motley Fool. Hier wird beschrieben, dass viele Menschen den Besitz teurer Dinge mit Reichtum und einem hohen Status sowie Konsum allgemein mit Wohlstand in Verbindung bringen. Sich selbst und andere messen Menschen häufig daran, was beispielsweise am Körper getragen oder welches Auto gefahren wird. Dass man einem Menschen anhand seiner Besitztümer einen gewissen Status ablesen kann, erklärt Wiswede damit, dass Konsum in gesellschaftliche Rahmenbedingungen eingebettet ist, also spezifische Konsumstile „Ausdruck einer sozialen Prägeform“ sind. Eine der wichtigsten konsumsoziologischen Fragestellungen lautet daher aufzuzeigen, wie sozial-strukturelle Bedingungen und die daraus abgeleiteten Wertvorstellungen – kurz gesagt: die soziale Ungleichheit – Konsumverhalten beeinflussen.
Inhaltsverzeichnis
- Konsum und soziale Ungleichheit.
- Was ist „Soziale Ungleichheit“?
- Entwicklung der Modelle von sozialer Ungleichheit
- Konsum im Zeitalter des Hochkapitalismus.
- Die Diffusion der Konsumstile nach Werner Sombart
- Paul Göhres Phänomenologie des Warenhauses
- Georg Simmel und die Philosophie der Mode.
- Thorstein Veblens „Die Theorie der feinen Leute“.
- Demonstrativer Konsum und Müßiggang als Weg der Differenzierung
- Kritiker Veblens
- David Riesman: Das Standardpaket.
- Das Standardpaket homogenisiert die Lebensstile
- Pierre Bourdieus „Die feinen Unterschiede“.
- Bourdieus Konzept des Habitus
- Die Positionierung im sozialen Raum und dem Raum der Lebensstile
- Unterschiedliche Geschmackstypen.
- Konsum und Klassenkampf.
- Bourdieus Arbeiten - das Erbe Veblens?
- Kritiker Bourdieus
- Heutige Situation und Perspektiven.
- In der „Erlebnisgesellschaft“ wird sozialer Aufstieg unwichtiger.
- Hartmut Lüdtke: Moderne Lebensstile rahmen Konsum...
- Was sind moderne Lebensstile?
- Nutzen von modernem Konsum
- Hartmut Lüdtke über den modernen demonstrativen Konsum
- QVC: Keine klare Abkehr von Status-Orientierung im Konsum
- Kai-Uwe Hellmann: Zwischen Konformismus und Individualität
- Zusammenfassung und Fazit...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Konsum und sozialer Ungleichheit, indem sie die Entwicklung von Konsummustern und -verhalten im Kontext sich verändernder sozialer Strukturen und Ungleichheitsmodelle vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart beleuchtet. Der Fokus liegt darauf, wie unterschiedliche soziale Gruppen Konsum als Mittel zur Differenzierung und Statusabgrenzung einsetzen und wie diese Dynamiken im Laufe der Zeit beeinflusst wurden.
- Die Entwicklung der Modelle von sozialer Ungleichheit und deren Einfluss auf Konsum.
- Der Wandel von Konsummustern im Hochkapitalismus und die Rolle von Prestige und Ansehen.
- Die Bedeutung von „demonstrativem Konsum“ und die Diffusionsdynamiken von Konsumstilen.
- Die Rolle des „Standardpakets“ im Massenkonsum und die homogenisierende Wirkung von Konsumgütern.
- Die Bedeutung von Habitus, Lebensstilen und Klassenkampf für die Konsumbedingungen im 20. Jahrhundert.
Zusammenfassung der Kapitel
- **Kapitel 1: Konsum und soziale Ungleichheit.** Dieses Kapitel legt die Grundlage für die Untersuchung, indem es den Begriff „Soziale Ungleichheit“ definiert und verschiedene Modelle für deren Beschreibung vorstellt, die von unterschiedlichen Theoretikern genutzt werden.
- **Kapitel 2: Konsum im Zeitalter des Hochkapitalismus.** Dieses Kapitel beleuchtet, wie Konsum im frühen 20. Jahrhundert durch den Wunsch nach Prestige und Ansehen geprägt war und welche Rolle dabei die Diffusion von Konsumstilen spielte.
- **Kapitel 3: Thorstein Veblens „Die Theorie der feinen Leute“**. Dieses Kapitel analysiert Veblens Theorie des „demonstrativen Konsums“ und untersucht, wie Individuen durch Konsum nach sozialer Anerkennung streben.
- **Kapitel 4: David Riesman: Das Standardpaket.** Dieses Kapitel zeigt, wie im Massenkonsum der 1950er-Jahre die Ansammlung von Konsumgütern in verschiedenen Gesellschaftsschichten ähnlicher wurde und dem Modell des „Standardpakets“ entsprach.
- **Kapitel 5: Pierre Bourdieus „Die feinen Unterschiede“.** Dieses Kapitel befasst sich mit Bourdieus Konzept des Habitus und seiner Analyse des Konsums als Mittel zur sozialen Positionierung und Distinktion.
- **Kapitel 6: Heutige Situation und Perspektiven.** Dieses Kapitel beleuchtet aktuelle konsumsoziologische Arbeiten und diskutiert die Frage, ob eine Abkehr vom statusorientierten Konsum stattgefunden hat.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Begriffen Konsum, soziale Ungleichheit, Konsumgesellschaft, demonstrativer Konsum, Lebensstil, Habitus, Standardpaket, Klassenkampf, Prestige und Distinktion. Die Analyse greift auf klassische und moderne Theorien der Konsumsoziologie zurück und untersucht die Entwicklung des Konsums im Kontext sozialer Veränderungen und Ungleichheitsstrukturen.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst soziale Ungleichheit den Konsum?
Soziale Ungleichheit prägt Konsumstile als Ausdruck einer sozialen Prägeform. Unterschiedliche soziale Gruppen nutzen Konsum, um Status, Reichtum und Zugehörigkeit zu demonstrieren oder sich abzugrenzen.
Was versteht Thorstein Veblen unter "demonstativem Konsum"?
Veblen beschreibt damit den Erwerb von Gütern primär zur Schaustellung von Wohlstand und zur Erlangung sozialer Anerkennung, anstatt zur Befriedigung praktischer Bedürfnisse.
Welche Rolle spielt Pierre Bourdieus Konzept des Habitus beim Konsum?
Der Habitus bestimmt den Geschmack und die Lebensstile einer Person basierend auf ihrer sozialen Position. Konsum dient laut Bourdieu als Mittel zur Distinktion und sozialen Positionierung.
Was ist das "Standardpaket" nach David Riesman?
Das Standardpaket bezeichnet eine Ansammlung von Konsumgütern, die in den 1950er Jahren über verschiedene Gesellschaftsschichten hinweg ähnlich wurde und so die Lebensstile homogenisierte.
Besteht heute noch ein statusorientierter Konsum?
Trotz Individualisierungstendenzen in der Erlebnisgesellschaft gibt es laut Analysen (z. B. QVC oder Hellmann) keine klare Abkehr von der Statusorientierung; Konsum bleibt ein zentrales Mittel der Identitätsbildung.
- Quote paper
- Johanna Ernst (Author), 2019, Wie beeinflusst soziale Ungleichheit Konsum?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/986272