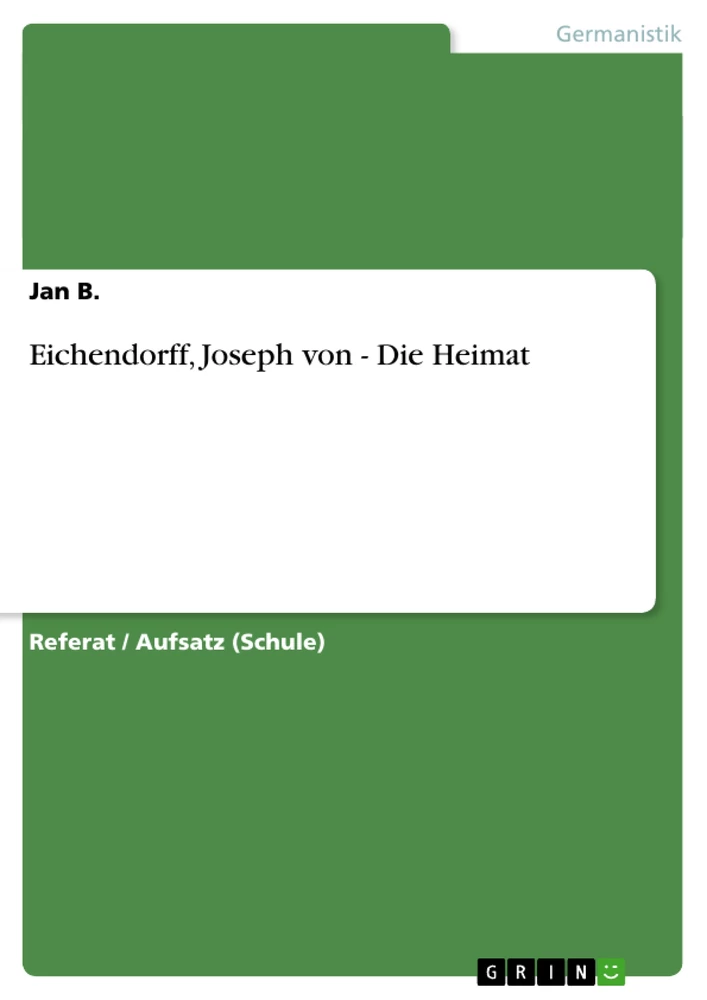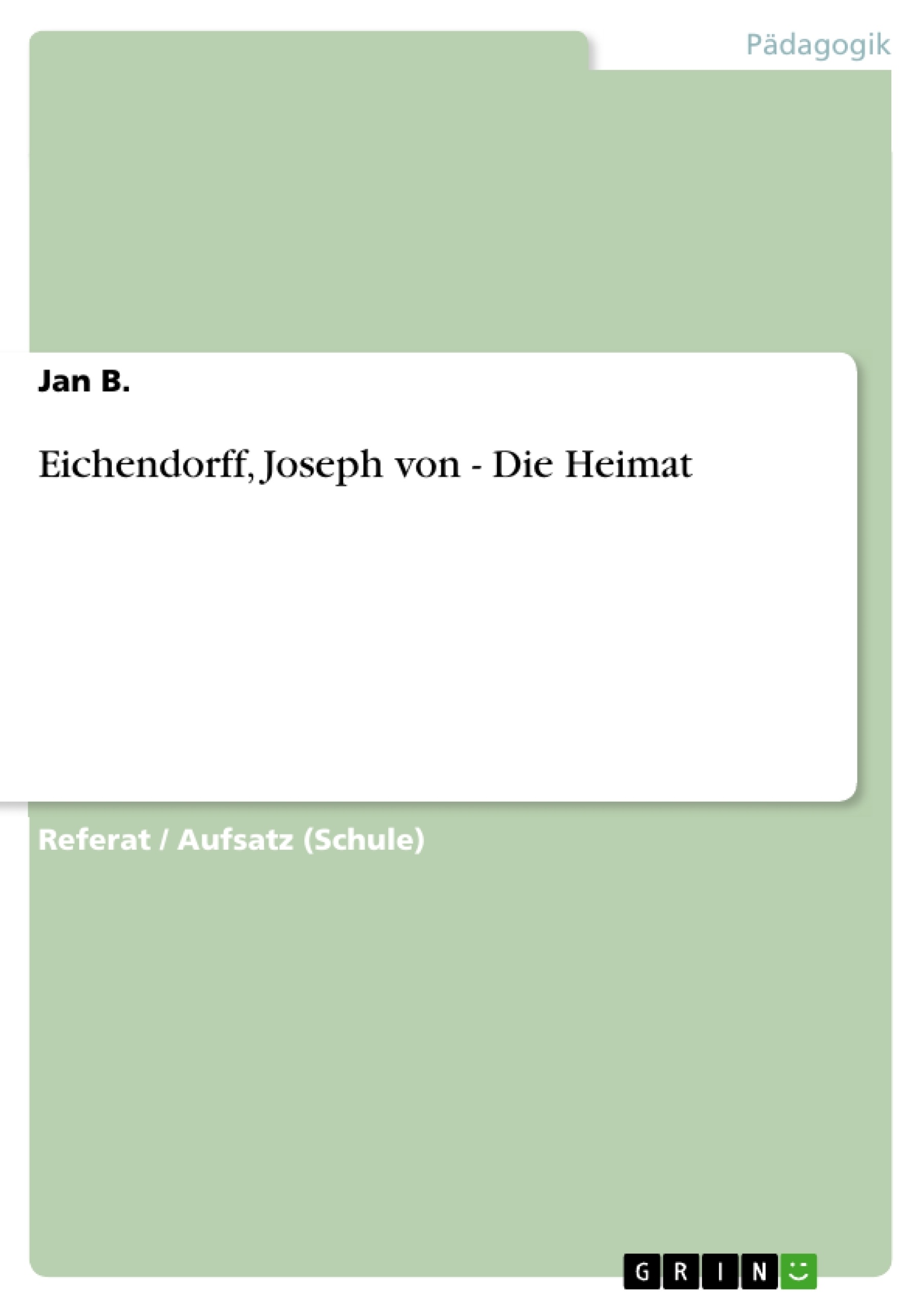Autor: Jan B.
Gedichtinterpretation: Joseph von Eichendorff, ,,Die Heimat" Joseph von Eichendorff, ein deutscher Schriftsteller und zugleich herausragender Vertreter der deutschen Spätromantik, lebte von 1788 bis 1857. In seinem Gedicht ,,Die Heimat" von 1819 befaßt sich Eichendorff mit Erinnerungen seiner Kindheit, die er in Fantasien und Wünschen wiedergibt.
Wie schon eingangs betont, befaßt sich Eichendorff in seinem Gedicht ,,Die Heimat" mit Erinnerungen seiner Kindheit, die sich in dem vorliegenden Gedicht deutlich widerspiegeln. Bevor allerdings der Inhalt des Gedichtes erläutert wird, müssen zunächst historische und zugleich familiäre Aspekte geklärt werden. Joseph von Eichendorff wuchs mit mehreren Geschwistern auf, doch zu seinem Bruder Wilhelm, der zwei Jahre älter als Joseph von Eichendorff war, besaß er ein besonders enges Verhältnis. Erst 1813 trennten sich die Wege. Wilhelm nahm eine Stelle als Kreishauptmann in Südtirol entgegen und Joseph nahm an den Befreiungskriegen teil und erhielt eine Anstellung in Preußen.
Den Mittelpunkt der ersten Strophe stellt ein Schloß ,,auf stiller Höh" dar, das unmittelbar von einem Wald umgeben ist, wobei bereits hier der enge Bezug Eichendorffs an die Natur deutlich wird. An diese Strophe schließt sich inhaltlich die zweite Strophe an, in der der Hauptgedanke auf dem Aufblühen des Lenz liegt. Eichendorff bedient sich hierbei eines jungen Mädchens, das in Stille und Einsamkeit das zuvor erwähnte Aufblühen des Frühlings wahrnimmt, lediglich begleitet von einem ,,Strom von Zauberklängen". In der dritten und zugleich letzten Strophe macht Eichendorff die Allgegenwärtigkeit der Natur grundlegend deutlich, welches besonderen in der zweiten und dritten Verszeile deutlich wird. In diesen betont Eichendorff, das der Mensch als ehrfürchtiger Betrachter Zeit seines Lebens von der Natur umgeben ist. Wobei er die Züge der Natur als etwas sehr kostbares und einzigartiges herausstellt.
Das Verhältnis des Titels zum Inhalt des Gedichtes scheint aus meiner Sicht eindeutig. Dazu trägt die zwischen Titel und Text befindliche Wortgruppe ,,Meinem Bruder" bei. Daher kann der Text einerseits als Erinnerung an Erlebtes in der Kindheit mit seinem Bruder Wilhelm geltend gemacht werden, was im besonderen Maße bei der Klärung der rhetorischen Figuren von Bedeutung ist, andererseits mit dem Verhältnis Eichendorffs zu seiner ,,Heimat" und der Natur.
Das Gedicht ,,Die Heimat" besteht aus drei Strophen, die aus jeweils sechs Verzeilen bestehen. Die Verszeilen sind durch keine reine Reimform miteinander verbunden. Jedoch liegt in jeder Strophe ein umarmender Reim vor, der die Verszeilen drei bis sechs umfaßt. Wobei erwähnt werden muß, daß in jeder Strophe zusätzlich die zweite Verszeile zu der vierten und fünften Verszeile eine lautliche Übereinstimmung bildet. Hierbei könnte zudem der Endreim der ersten und dritten Verszeile der dritten Strophe erwähnt werden.
Im bildlichen Vordergrund steht wie bereits erwähnt die Natur. Diese wird durch Eichendorff durch zahlreiche sprachliche Mittel, wie Metaphern, Vergleichen und Personifikationen, auf eine sehr bildhafte Art und Weise dargestellt. Bereits in der ersten Verszeile der ersten Strophe bedient sich Eichendorff einer stilistischen Figur, nämlich der rhetorischen Frage. Es scheint so als frage Eichendorff seinen Bruder, ob er sich noch an das Schloß, das auf einer Anhöhe liegt, erinnern könne. Es schließt daraufhin eine Personifikation in der zweiten Verszeile an: ,,Das Horn lockt nächtlich dort, als ob's dich riefe ...". Erneut tritt hierbei zugleich das Ansprechen einer zweiten Person auf.
Eichendorff bedient sich in der vierten Verszeile der ersten Strophe erneut eines sprachlichen Bildes, wobei das Verb ,,rauscht" auf die Bewegung durch den Wind zurückzuführen ist. Mit Hilfe der folgenden Aussage in der fünften Verszeile ,,O stille, wecke nicht!" wird die Dringlichkeit nach Ruhe und Stille verdeutlicht. ,,Da drunten ein unnennbarer Weh." führt auf ein sprachliches Bild zurück, wobei der Schmerz Eichendorffs aufgrund von Einsamkeit und Sehnsucht deutlich wird. Die Sehnsüchte können einerseits aus der Sehnsucht nach der Natur, was mit Heimweh gebunden sein kann, andererseits aus der Sehnsucht nach seinem Bruder resultieren.
Die zweite Strophe setzt bezüglich der stilistischen Figuren da an, wo die zweite aufgehört hat, da auf die rhetorische Frage erneut ein sprachlichen Bild folgt. Dieses rührt erneut aus den Erscheinungen der Natur und stellt ein etwas immer wiederkehrendes, wenn auch nicht in der gleichen Art und Weise, dar. So daß zwischen der rhetorischen Frage und dem sprachlichen Bild, das alljährliche Aufblühen des Frühlings, ein enger Zusammenhang besteht. Ich erwähnte bereits das sich Eichendorff in der zweiten Strophe eines jungen Mädchens bedient, die er seine Erinnerungen durchleben läßt und die auf kühlen Gängen, womit die Pfade des Waldes gemeint sind, in Stille und Einsamkeit läuft. Eichendorff nutzt zur Verstärkung seiner Aussage die Inversion, es erfolgt die Umstellung der üblichen Wortfolge, bevor er sich in der vierten Verszeile (,,Und weckt den leisen Strom von Zauberklängen") erneut eines sprachlichen Bildes und in der darauffolgenden Verszeile einem Vergleich sowie einer Personifikation bedient. Anhand dieser läßt sich erneut der Bezug Eichendorffs zur Natur herstellen, die von rascheln und knistern der Blätter und pfeifen des Windes durch die Bäume erfüllt ist und nun euphemistisch dargestellt werden. Und schon werden vergangene Erlebnisse Eichendorffs, hervorgerufen durch das immer Wiederkehren des Frühlings, wach, welches aus der letzten Verszeile der zweiten Strophe, ,,Rings von der alten, schönen Zeit.", hervorgeht. Zuletzt ist die in der dritten Verszeile vorhandene Alliteration ,,Bäume und die Blumen" zu erwähnen.
In der dritten Strophe möchte ich zunächst nur auf die veränderte Strophe eingehen, bevor ich einen Vergleich mit der von Eichendorff handschriftlich verfaßten Strophe vornehme. Diese dritte Strophe beginnt abweichend von der ersten und zweiten Strophe nicht mit einer rhetorischen Frage, sondern mit einer Aufforderung, Wipfel (Baumkrone mit beblätterten Zweigen) und Bronnen (Brunnen) sollten nur rauschen. Die folgenden drei Verszeilen (zwei bis vier) kann man so deuten, daß Eichendorff mit Hilfe sprachlicher Bilder deutlich machen möchte, daß egal wo er oder sein Bruder Wilhelm sich befinden, die genannten Eigenarten der Natur ihr Bewußtsein nie loslassen werden und daher immer die Erinnerungen an ,,Die Heimat" und gemeinsam verbrachte Zeiten hervorrufen werden und sie ,,das geheime Singen" (vierte Verszeile) überall, unabhängig dem Ort, erreichen wird. In der vierten Verszeile nutzt Eichendorff erneut die Inversion. In der fünften Verszeile macht sich durch die Aussage ,,Ach, dieses Bannes wunderbaren Ringen" (sprachliches Bild) Resignation deutlich, welches als Fügen in das Schicksal gedeutet werden kann. Dementsprechend folgt die letzte Verszeile ergeben und gefaßt, da beide Personen in einer besonderen Art und Weise mit der Heimat und der dazugehörigen Natur und ihren gemeinsamen Erlebnissen verbunden sein werden. Im Vergleich der geänderten dritten Strophe zu der Handgeschriebenen Strophe Eichendorffs, werden Veränderungen an drei Stellen deutlich. In der zweiten Verszeile, in der das Wort Flucht zu Lust geändert wird, die fünfte Verszeile wird von ,,In dieses Sees wunderbaren Ringen" zu ,,Ach, dieses Bannes wunderbaren Ringen" und die sechste Verszeile wird von ,,Gehn wir doch unter, ich und du!" zu ,,Entfliehn wir nimmer, ich und du!" geändert. Die
Änderung des Wortes Lust zu Flucht könnte hierbei einen historischen, aus dem Leben von Joseph von Eichendorff resultierenden Aspekt besitzen. Aufgrund der räumlichen Trennung Eichendorffs und seines Bruders von der ,,Heimat", bei Eichendorff speziell die Teilnahme an den Befreiungskriegen. ,,In dieses Sees ..." könnte aus der Fülle der erwähnten Eigenarten der Natur herrühren, ,,Gehen wir unter ..." wird dann in Zusammenhang mit dem Wort ,,See" betrachtet.
Wie ich eingangs betonte, gilt Eichendorff als herausragender Vertreter der deutschen Spätromantik. Auch in diesem Werk ,,Die Heimat" kann der Leser zahlreiche Züge, die charakteristisch für die Romantik sind, feststellen. Neben den Schlagworten ,,Gefühl", das dem Rationalismus entgegengesetzt ist, und ,,Sehnsucht", das im großen Maße ersichtlich ist, muß auch der bereits erwähnte Begriff ,,Natur" genannt werden, dem neben ,,Gefühl" und ,,Sehnsucht" eine besondere Stellung in dem Gedicht ,,Die Heimat" zukommt. Dies ist damit zu begründen, daß in jeder Strophe die besondere Haltung Eichendorffs zur Natur deutlich gemacht wird. Daher kann von der Verbildlichung ungetrübter Landschaftsbilder die Rede sein. Darüber hinaus werden keine Richtlinien in Bezug auf die Form eingehalten, welches im besonderen Maße in dem Reimschema ersichtlich wird. Weitergehend läßt Eichendorff die Grenzen zwischen Traum, Fantasie und Wirklichkeit aufheben, welches beinhaltet, daß keine reine Wirklichkeit vorliegt.
Zusammenfassend ist Eichendorffs Gedicht ,,Die Heimat" daher als Hommage und somit als Huldigung gegenüber der Natur zu verstehen, indem er ihr Achtung und Anerkennung zollt. In diesem Gedicht läßt er daher seinen Erinnerungen, zugleich aber auch Fantasien, in Bezug auf die Natur sowie seinem Bruder freien lauf. Eichendorff ,,durchlebt" in seinem Gedicht und in seinen Gedanken somit Vergangenes und schildert den Idealzustand im Verhältnis Mensch und Natur.