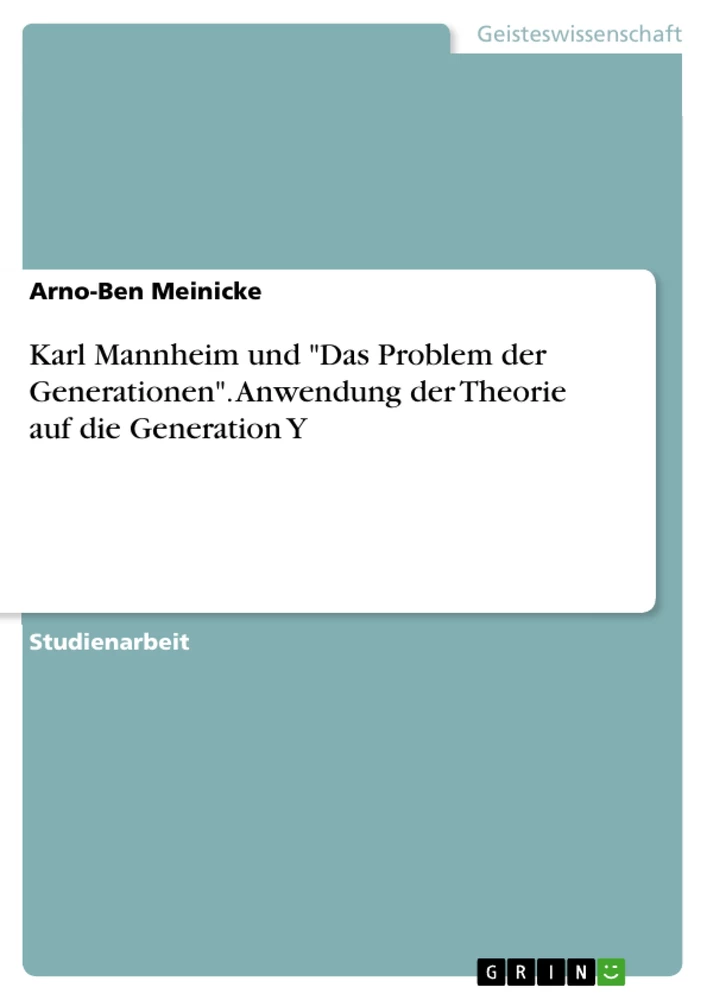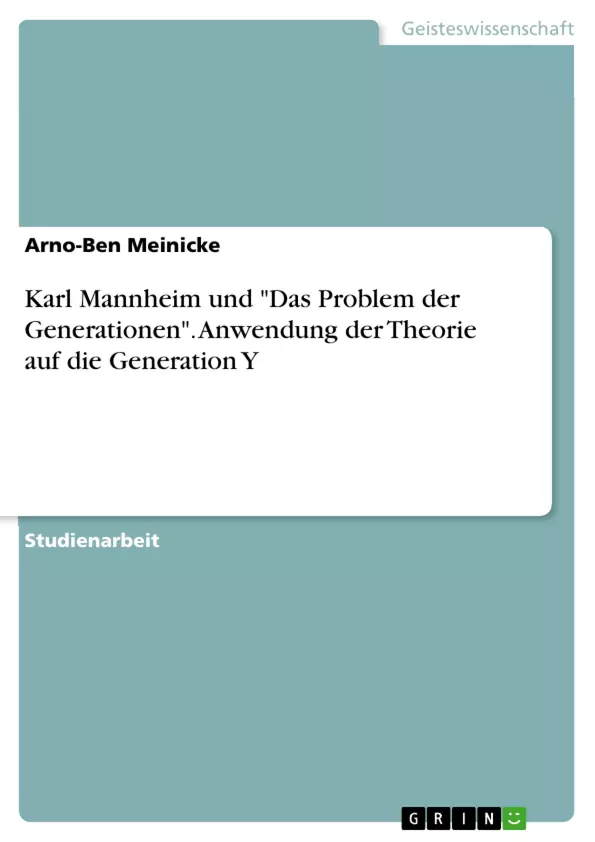Mit dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, ob Mannheims Theorie noch zum Verständnis der aktuellen Generation Y beitragen kann und welche neuartigen Faktoren der Generation Y darauf einen Einfluss haben.
Karl Mannheim war schulgebend für die Soziologie. Sein Werk "Das Problem der Generationen" von 1928 gilt bis heute als das Fundament der Generationentheorie. Mannheim erklärte die gesellschaftliche Erfahrung des Werte- und Kulturwandels, indem er diesen mit der generativen Erneuerung zusammenführte. Mit seiner Theorie verspricht er historischen Wandel und Umwälzungserscheinungen besser erklären und verstehen zu können. In den vergangen fast 90 Jahren gab es einiges an Kritik an Mannheim. Es wurden einige Aspekte seiner Theorie differenziert, sowie neue Konzepte entworfen. Heute ist das Thema Generationen so präsent wie noch nie, besonders wenn es darum geht, die aktuelle Generation der jungen Berufstätigen zu beschreiben, die Generation Y.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Karl Mannheim und das Problem der Generationen
- Mannheims Zugang zum Problem der Generationen
- Mannheims Kritik
- Theorie und Schlüsselbegriffe
- Kritik und Neuzugänge
- Kritik an Mannheim
- Neue Begriffe und Konzepte
- Reflexion der Kritik und der Neuzugänge
- Generation Y
- Karl Mannheim und die Generation Y
- Generation Y aus verschiedenen Perspektiven
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Relevanz von Karl Mannheims Theorie des Generationswandels für das Verständnis der heutigen Generation Y zu beleuchten. Dabei wird untersucht, inwieweit Mannheims Theorie auf die aktuelle Generation anwendbar ist und welche neuen Faktoren zusätzlich berücksichtigt werden müssen.
- Mannheims Theorie des Generationswandels
- Kritik an Mannheims Theorie
- Neue Konzepte und Ansätze in der Generationsforschung
- Die Generation Y und ihre Besonderheiten
- Anwendung von Mannheims Theorie auf die Generation Y
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von Karl Mannheims Theorie für die heutige Generationenforschung dar und gibt einen Überblick über den Inhalt der Arbeit. In Kapitel 2 wird Mannheims Zugang zum Problem der Generationen im Detail beleuchtet. Hier werden die beiden Ansätze des Positivismus und des romantisch-historischen Ansatzes vorgestellt und Mannheims Kritik an diesen Ansätzen analysiert. Außerdem wird Mannheims eigene Theorie und seine Schlüsselbegriffe näher erläutert. Kapitel 3 befasst sich mit Kritik an Mannheims Theorie und neuen Konzepten in der Generationsforschung. In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Perspektiven auf das Problem der Generationen diskutiert und neue Ansätze zur Analyse der Generation Y vorgestellt. Kapitel 4 widmet sich der Generation Y und untersucht, inwieweit Mannheims Theorie auf diese Generation angewendet werden kann. Hier werden die spezifischen Eigenschaften der Generation Y und ihre Besonderheiten im Kontext der heutigen Gesellschaft betrachtet. Schließlich wird in einem Fazit die Relevanz von Mannheims Theorie für das Verständnis der Generation Y zusammengefasst und die Frage nach der Anwendbarkeit seiner Theorie in der heutigen Zeit beantwortet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Generationentheorie, Karl Mannheim, Generationswandel, Generation Y, Wertewandel, Kulturwandel, soziologische Analyse, Kritik, neue Konzepte, Gesellschaft, Jugend, Generationenforschung, soziologische Theorie, Kritik und Relevanz.
- Quote paper
- Arno-Ben Meinicke (Author), 2017, Karl Mannheim und "Das Problem der Generationen". Anwendung der Theorie auf die Generation Y, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/987124