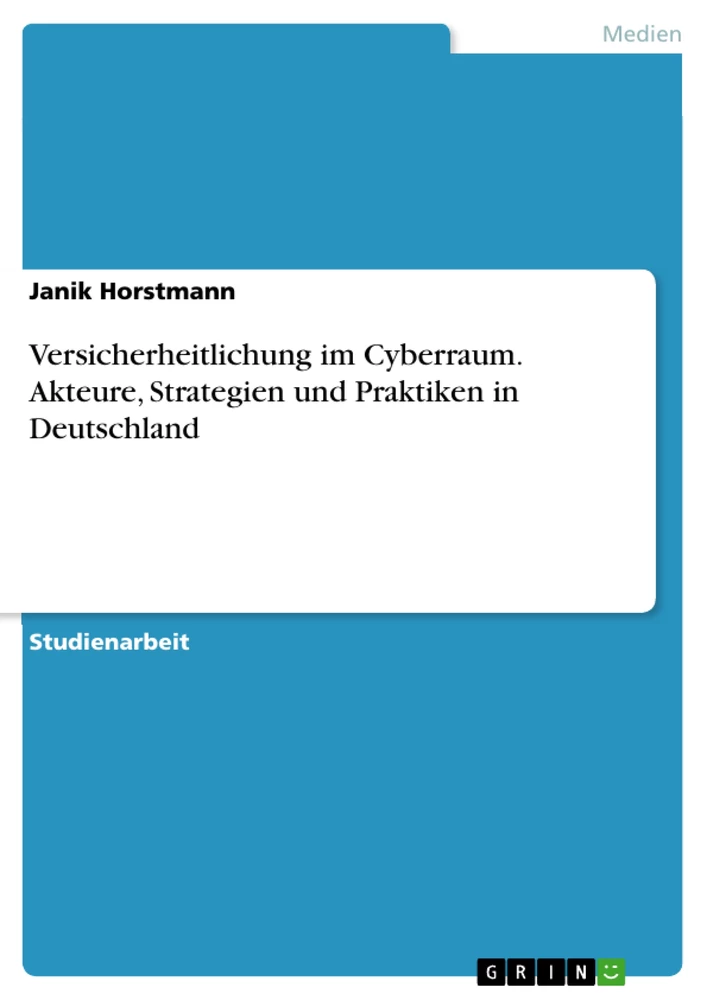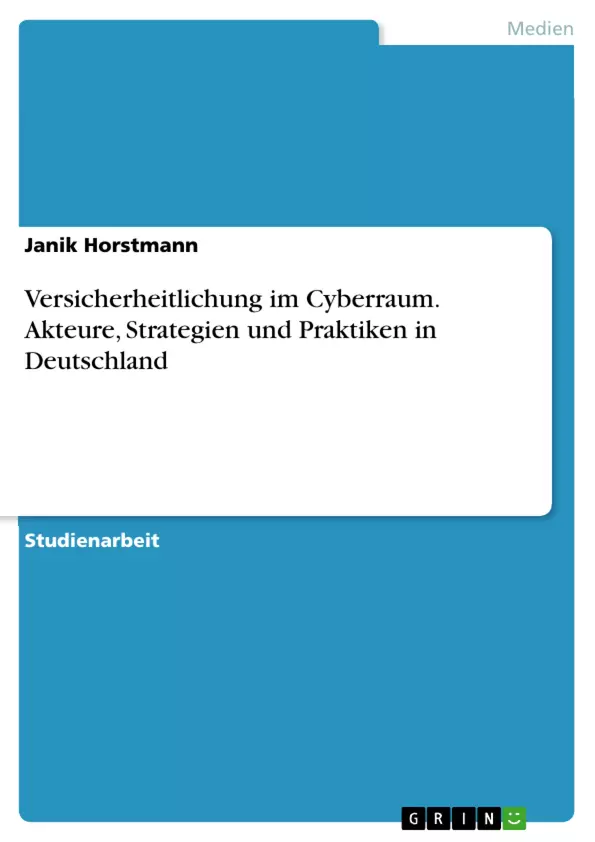In der vorliegenden Arbeit soll auf die Akteure, Strategien und Praktiken in der deutschen Sicherheitspolitik eingegangen werden, um mithilfe der Analyseansätze von Versicherheitlichungsakten der Pariser Schule den Versicherheitlichungsprozess in Deutschland zu untersuchen. Im Fokus steht dabei der Staat als versicherheitlichender Akteur, aber auch private Akteure und ihr zunehmender Einfluss werden berücksichtigt. Darauf aufbauend sollen Präzisierungen der Pariser Schule für das Feld der Cybersicherheit artikuliert werden vor allem aber die Machtlogiken in der deutschen Sicherheitspolitik identifiziert werden und wie diese sich in sozial konstruierten gesellschaftlichen Prozessen widerspiegeln.
Das Vorhaben den Prozess der Versicherheitlichung im Cyberraum in Deutschland nachzuzeichnen und zu analysieren folgt folgenden Gliederungspunkten: Zuerst widmen wir uns dem Begriff "Cyber" und dem damit einhergehenden Cyberraum, welcher unseren Untersuchungsgegenstand bildet. Anschließend folgt die Darstellung, die der Arbeit zugrunde liegenden Theorie der Versicherheiltichung. Dabei steht der Ansatz der Pariser Schule mit Bezug auf Thierry Balzacq (2005) im Mittelpunkt. Im Anschluss erfolgt die Übertragung der Theorie auf den sicherheitspolitischen Operationsraum "Cyber" und damit einhergehend die Identifikation der versicherheitlichenden Akteure in diesem Raum sowie die Analyse der Cybersicherheitspolitik in Deutschland.
Versicherheitlichung im Cyberraum ist ein altes Phänomen in einem relativ neuen und vom Menschen geschaffenen Raum. Hier treffen nationalstaatliche Machtansprüche auf globale Vernetzung und Datenaustausch. Dieses Politikfeld erfährt weltweit zunehmend an Aufmerksamkeit von Regierungen, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft. Dadurch ist es zu einem umkämpften und sich dynamisch verändernden Raum der politischen Auseinandersetzungen geworden, aber auch zu einem in dem internationale Zusammenarbeit besser funktioniert als in vielen anderen Bereichen in denen es nötig wäre, wie beispielsweise dem Klimaschutz. Obwohl es sich beim Cyberraum um einen globalen/transnationalen Ort handelt spielen Nationalstaaten und in Ihnen stattfindende gesellschaftliche Prozesse eine entscheidende Rolle als treibende Kräfte eines voranschreitenden Versicherheitlichungsprozesses. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen äußeren und inneren Sicherheitsthemen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Cyber
- Macht- und Funktionslogik von Cyber
- Cyberraum
- Theorie der Versicherheitlichung
- kritische Sicherheitsforschung – drei verschiedene Ansätze
- Pariser Schule
- Thierry Balzacq - The three Faces of Securitization
- Probleme der Pariser Schule
- Cybersicherheit oder Versicherheitlichung des Cyberraums – Wer? Und wenn, ja. Wie weit?
- Versicherheitlichung im Cyberraum
- Cyberkriminalität
- Nationalstaaten als versicherheitlichende Akteure
- Institutioneller Rahmen - Cybersicherheit in Deutschland
- Nationale Cybersicherheitsstrategie
- Private Akteure
- Analyse des Versicherheitlichungsprozesses in Deutschland
- Schluss/Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Prozess der Versicherheitlichung im Cyberraum in Deutschland. Sie analysiert die Akteure, Strategien und Praktiken, die an diesem Prozess beteiligt sind, und untersucht insbesondere die Rolle des Staates als versicherheitlichender Akteur. Dabei werden auch private Akteure und ihr zunehmender Einfluss berücksichtigt.
- Analyse der Versicherheitlichung im Cyberraum anhand der Pariser Schule
- Identifizierung der versicherheitlichenden Akteure im Cyberraum
- Untersuchung der Machtlogiken in der deutschen Sicherheitspolitik
- Bedeutung des Cyberraums als sozial konstruierter Raum
- Analyse der deutschen Cybersicherheitspolitik und ihrer Akteure
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Begriff „Cyber“ und die Funktionslogik des Cyberraums. Es wird dargestellt, wie der Cyberraum als ein vage umrissenes Referenzobjekt dient, um weitreichende versicherheitlichende Maßnahmen zu rechtfertigen. Kapitel 2.1 beleuchtet die Macht- und Funktionslogik von „Cyber“ und erläutert die Mobilisierungs- und Versicherheitlichungsfunktion des Begriffs. Kapitel 2.2 analysiert den Cyberraum als einen sozial konstruierten Raum, der sowohl emanzipatorisches Potenzial als auch neue Machtkämpfe beherbergt. Kapitel 3 stellt die Theorie der Versicherheitlichung vor, insbesondere den Ansatz der Pariser Schule, und identifiziert die Probleme, die mit diesem Ansatz verbunden sind. Kapitel 4 wendet die Theorie auf den sicherheitspolitischen Operationsraum „Cyber“ an und analysiert die versicherheitlichenden Akteure im Cyberraum, insbesondere Nationalstaaten. Kapitel 5 befasst sich mit dem institutionellen Rahmen der Cybersicherheit in Deutschland, einschließlich der nationalen Cybersicherheitsstrategie, der Rolle privater Akteure und der Analyse des Versicherheitlichungsprozesses in Deutschland. Die Arbeit endet mit einem Schluss/Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Versicherheitlichung, Cyberraum, Cybersicherheit, Pariser Schule, Thierry Balzacq, Nationalstaaten, Private Akteure, Deutsche Sicherheitspolitik, Machtlogiken, Soziale Konstruktion.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Versicherheitlichung (Securitization)?
Versicherheitlichung ist ein Prozess, bei dem ein Thema durch Sprache und Handeln als existenzielle Bedrohung definiert wird, um außergewöhnliche Maßnahmen zu rechtfertigen.
Welche Rolle spielt die Pariser Schule in der Cybersicherheit?
Die Pariser Schule betont die Praktiken und Netzwerke von Akteuren (Polizei, Geheimdienste), die Sicherheit im Alltag konstruieren.
Wer sind die Hauptakteure der Cybersicherheit in Deutschland?
Neben staatlichen Stellen wie dem BSI oder der Bundeswehr spielen auch private Sicherheitsfirmen und die Zivilgesellschaft eine wachsende Rolle.
Ist der Cyberraum ein sozial konstruierter Raum?
Ja, die Arbeit argumentiert, dass die Wahrnehmung von Bedrohungen im Cyberraum stark von gesellschaftlichen Prozessen und Machtlogiken abhängt.
Was ist die Nationale Cybersicherheitsstrategie?
Es ist das zentrale Strategiepapier der Bundesregierung zum Schutz der IT-Infrastruktur und zur Abwehr von Cyberkriminalität und Spionage.
- Quote paper
- Janik Horstmann (Author), 2020, Versicherheitlichung im Cyberraum. Akteure, Strategien und Praktiken in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/987200