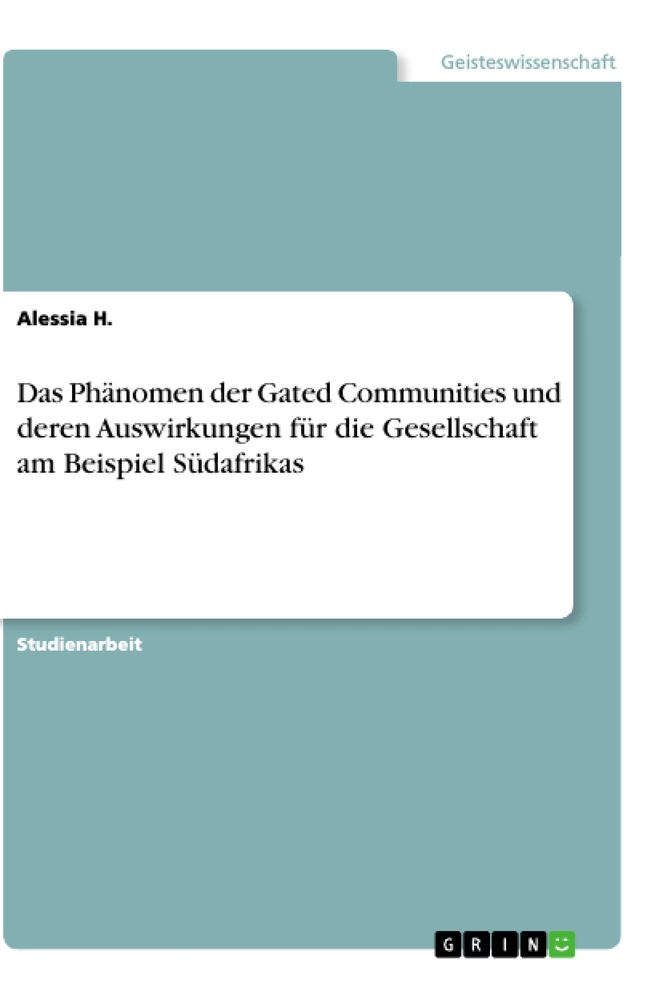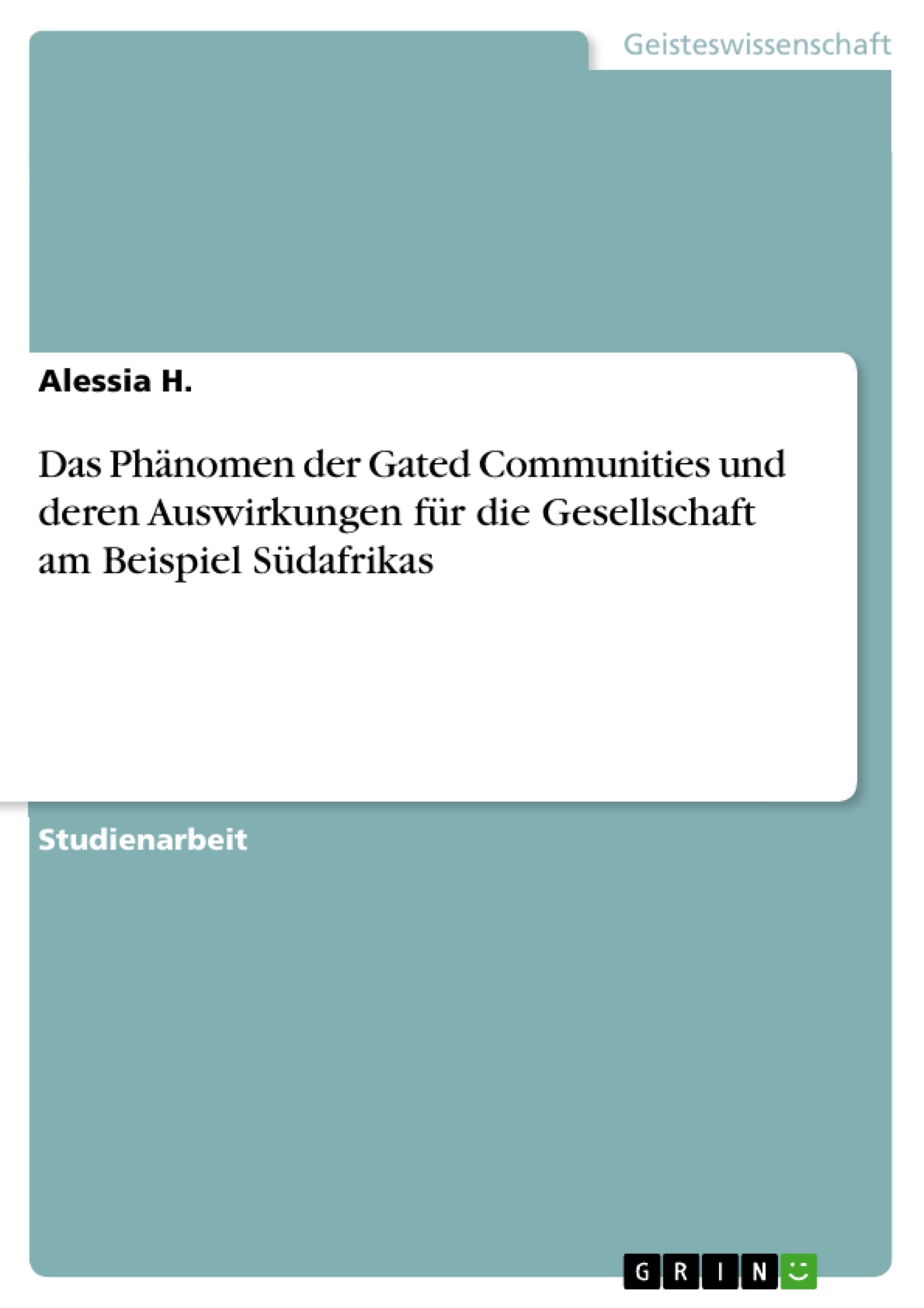Diese Arbeit befasst sich mit der Fragestellung "Das Phänomen der Gated Communities und deren Auswirkungen für die Gesellschaft am Beispiel Südafrikas - Begünstigen verschiedene Aspekte diese Entstehung?". Ein durchaus interessanter Aspekt ist hierbei, welche verschiedenen Aspekte zur Entstehung beitragen. Einer davon ist die Globalisierung. Aufgrund der Ausbreitung und Veränderung der Gesellschaft entsteht eine neue Dimension und Segregation des Sozialen.
Dieses neuere Forschungsgebiet soll näher erläutert werden. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile, da dieses Fachgebiet sehr umfangreich ist. Durch umfassende Recherche wird zunächst ein Überblick über die Entstehung und die Eigenschaften von Gated Communities, sowie über den globalen Wandel dargelegt. Danach wird dargestellt, welche Auswirkungen diese Wohnform auf die Gesellschaft hat und dies im Bezug auf Südafrika erläutert. Leitfragen hierbei sind: Begünstigt der Globale Wandel die Entstehung von Gated Communities? Warum entstehen in Südafrika immer mehr Wohnanlagen, und hat dies bleibende Auswirkungen auf die Gesellschaft?
Ob in Nord- oder Südamerika, Afrika, im arabischen Raum und Europa, auf der ganzen Welt existieren Gated Communities. Seit Ende der 1990er Jahre entstehen auch in Deutschland immer mehr abgegrenzte Wohnsiedlungen bzw. Apartments.
Diese Segregation der Bevölkerung führt zu verschieden Auswirkungen auf die Gesellschaft und müssen näher untersucht werden und welche resultierende Auswirkungen für die jeweilige Gesellschaft entstehen. Durch vermehrtes Erscheinen dieser Wohnform, wird die Trennung der Bevölkerungsgruppen deutlich, soziale Ungleichheit, Diskriminierung und entstehende Homogenitäten stellen ein stark und viel diskutiertes Problem dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einführung Gated Communities
- 2.1 Entstehung von Gated Communities
- 3. Globaler Wandel
- 3.1 Veränderungen im städtischen Raum
- 3.2 Gated Communities und der Globale Wandel
- 4. Erklärung am Beispiel von Gated Communities in Südafrika
- 4.1 Politischer Hintergrund
- 4.2 Erste Anzeichen dieser Wohnformen
- 4.3 Entstehung von Forestdale und Santa Cruz
- 4.4 Schlussfolgerung
- 5. Gated Communities und die Auswirkungen auf die Gesellschaft
- 5.1 Kritik
- 5.2 Zukunftspotential?
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Gated Communities und deren gesellschaftliche Auswirkungen, insbesondere in Südafrika. Ziel ist es, die Entstehung dieser abgeschlossenen Wohnsiedlungen zu beleuchten und deren Einfluss auf die soziale Struktur zu analysieren.
- Entstehung von Gated Communities im historischen und globalen Kontext
- Rolle des globalen Wandels und der Urbanisierung bei der Entwicklung von Gated Communities
- Sozioökonomische und politische Faktoren, die zur Entstehung von Gated Communities in Südafrika beitragen
- Auswirkungen von Gated Communities auf soziale Segregation und räumliche Gerechtigkeit
- Kritische Auseinandersetzung mit den positiven und negativen Aspekten von Gated Communities
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Gated Communities ein und beschreibt deren weltweite Verbreitung, inklusive des zunehmenden Auftretens in Deutschland. Sie formuliert die zentrale Forschungsfrage nach den Aspekten, die zur Entstehung von Gated Communities beitragen, wobei der Fokus auf Südafrika liegt und die Rolle der Globalisierung hervorgehoben wird. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: einen Überblick über die Entstehung und Eigenschaften von Gated Communities sowie deren Auswirkungen auf die Gesellschaft, insbesondere in Südafrika. Die Leitfragen der Arbeit werden formuliert, und die Notwendigkeit der Definition relevanter Begriffe wird betont.
2. Einführung Gated Communities: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Gated Community" als abgeschlossene Wohnkomplexe mit bewussten Abgrenzungen zur übrigen Bevölkerung, die gleichzeitig eine Form der Diskriminierung darstellen können. Es beschreibt charakteristische Merkmale wie bewachte Zugänge und gemeinschaftliche Einrichtungen. Das Kapitel hebt die Ambivalenz dieser Wohnform hervor: Isolation und Abgrenzung von der Gesellschaft einerseits, und die Entstehung neuer Gemeinschaften Gleichgesinnter andererseits.
2.1 Entstehung von Gated Communities: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung von Gated Communities, beginnend mit den Stadtmauern der Antike bis hin zu den modernen, abgeschlossenen Wohnanlagen. Es wird die Entwicklung von der Trennung von Wohn- und Arbeitsbereichen über geschlossene Wohnblöcke bis hin zu den heutigen Gated Communities in Süd- und Nordamerika nachgezeichnet. Die zunehmende Bevölkerungsdichte, Urbanisierung und soziale Ungleichheit werden als wichtige Faktoren für die Entstehung dieser Wohnform genannt. Die Kapitel beschreibt die anfängliche Bevorzugung durch die Oberschicht zur Isolation und Statusdemonstration, und den damit verbundenen Verlust öffentlichen Raums und die Einschränkung individuellen Handelns. verschiedene Arten von Gated Communities werden vorgestellt, wie "Lifestyle Communities", "Elitegemeinschaften" und "Security Zonen", mit ihren jeweiligen Schwerpunkten und Auswirkungen.
3. Globaler Wandel: Dieses Kapitel wird voraussichtlich den Zusammenhang zwischen Globalisierung, Urbanisierung und dem Aufkommen von Gated Communities untersuchen. Es wird wahrscheinlich die Veränderungen im städtischen Raum analysieren und aufzeigen, wie diese Entwicklungen die Entstehung und Ausbreitung von Gated Communities beeinflussen. Die Interaktion zwischen Globalisierungsprozessen und der Entstehung von Gated Communities wird hier wahrscheinlich im Detail dargestellt.
4. Erklärung am Beispiel von Gated Communities in Südafrika: Dieses Kapitel wird sich mit der spezifischen Situation in Südafrika befassen. Es werden der politische Hintergrund, die ersten Anzeichen dieser Wohnformen und die Entstehung konkreter Beispiele wie Forestdale und Santa Cruz analysiert. Die Kapitel wird die spezifischen sozioökonomischen und politischen Faktoren beleuchten, die zur Entstehung von Gated Communities in Südafrika beigetragen haben und deren Auswirkungen auf die südafrikanische Gesellschaft im Detail analysieren.
5. Gated Communities und die Auswirkungen auf die Gesellschaft: Dieses Kapitel wird die gesellschaftlichen Folgen von Gated Communities kritisch beleuchten und deren Zukunftspotential bewerten. Es wird die Kritik an diesen Wohnformen im Detail darstellen und die langfristigen Auswirkungen auf die soziale Struktur und den öffentlichen Raum untersuchen. Eine Einschätzung des Potentials für zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich wird erwartet.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gated Communities in Südafrika
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Gated Communities und deren gesellschaftliche Auswirkungen, insbesondere in Südafrika. Der Fokus liegt auf der Entstehung dieser abgeschlossenen Wohnsiedlungen und deren Einfluss auf die soziale Struktur.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung von Gated Communities im historischen und globalen Kontext, die Rolle des globalen Wandels und der Urbanisierung, sozioökonomische und politische Faktoren in Südafrika, Auswirkungen auf soziale Segregation und räumliche Gerechtigkeit sowie eine kritische Auseinandersetzung mit positiven und negativen Aspekten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Einführung in Gated Communities (inklusive deren Entstehung), Globalem Wandel, einer Fallstudie zu Gated Communities in Südafrika (mit den Beispielen Forestdale und Santa Cruz), den Auswirkungen auf die Gesellschaft und einem Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was sind Gated Communities?
Gated Communities werden als abgeschlossene Wohnkomplexe mit bewussten Abgrenzungen zur übrigen Bevölkerung definiert. Sie weisen charakteristische Merkmale wie bewachte Zugänge und gemeinschaftliche Einrichtungen auf und bergen eine Ambivalenz: Isolation und Abgrenzung einerseits, und die Entstehung neuer Gemeinschaften Gleichgesinnter andererseits.
Welche historischen Aspekte werden betrachtet?
Die historische Entwicklung von Gated Communities wird von den Stadtmauern der Antike bis hin zu modernen Wohnanlagen nachgezeichnet. Es wird die Entwicklung von der Trennung von Wohn- und Arbeitsbereichen über geschlossene Wohnblöcke bis hin zu den heutigen Formen in Süd- und Nordamerika betrachtet.
Welche Rolle spielt der globale Wandel?
Der Zusammenhang zwischen Globalisierung, Urbanisierung und dem Aufkommen von Gated Communities wird untersucht. Die Arbeit analysiert die Veränderungen im städtischen Raum und wie diese die Entstehung und Ausbreitung von Gated Communities beeinflussen.
Wie wird Südafrika als Fallbeispiel behandelt?
Die spezifische Situation in Südafrika wird anhand des politischen Hintergrunds, erster Anzeichen dieser Wohnformen und der Entstehung konkreter Beispiele wie Forestdale und Santa Cruz analysiert. Sozioökonomische und politische Faktoren, die zur Entstehung beigetragen haben, und deren Auswirkungen auf die südafrikanische Gesellschaft werden detailliert untersucht.
Welche gesellschaftlichen Auswirkungen werden diskutiert?
Die gesellschaftlichen Folgen von Gated Communities werden kritisch beleuchtet, inklusive Kritik an diesen Wohnformen und deren langfristigen Auswirkungen auf die soziale Struktur und den öffentlichen Raum. Die Arbeit bewertet auch das Zukunftspotential dieser Entwicklung.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Welche Aspekte tragen zur Entstehung von Gated Communities bei? Der Fokus liegt dabei auf Südafrika und der Rolle der Globalisierung.
Welche Arten von Gated Communities werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Arten von Gated Communities, wie "Lifestyle Communities", "Elitegemeinschaften" und "Security Zonen", mit ihren jeweiligen Schwerpunkten und Auswirkungen.
- Citar trabajo
- Alessia H. (Autor), 2018, Das Phänomen der Gated Communities und deren Auswirkungen für die Gesellschaft am Beispiel Südafrikas, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/987239