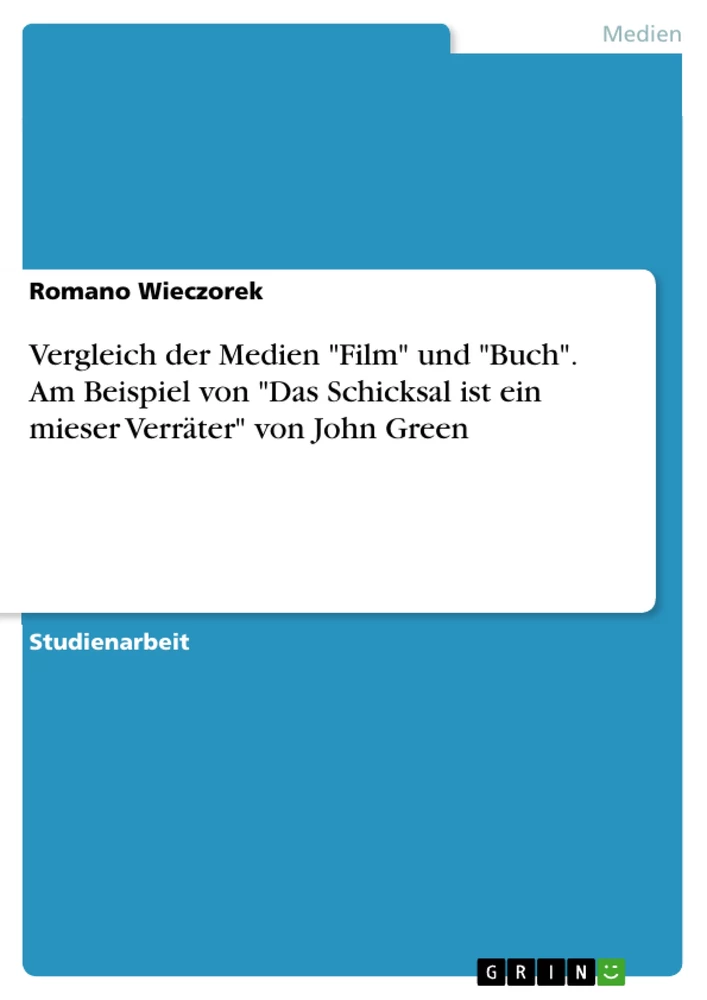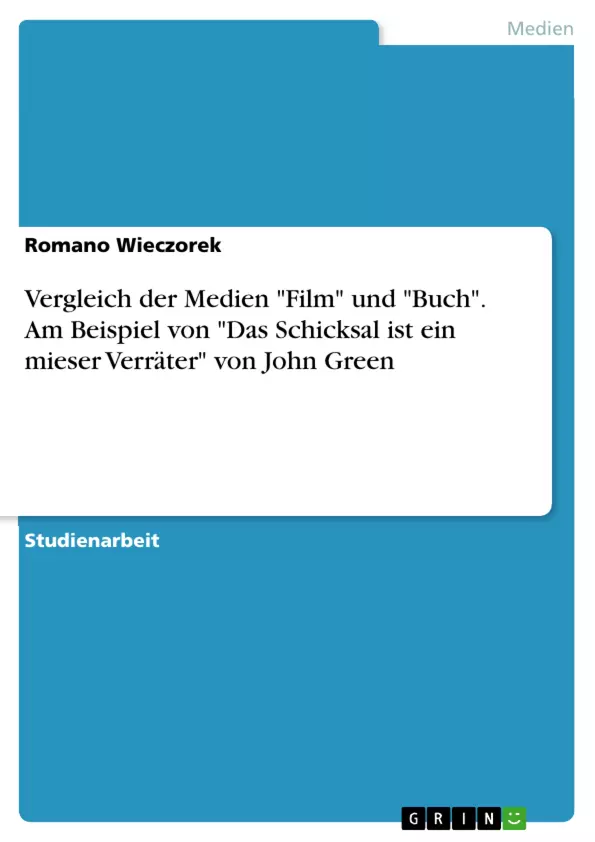In dieser Arbeit geht es um den Vergleich der Medien Buch und Film. Nach einer Auseinandersetzung mit beiden Medien befasst sich die Arbeit mit dem Thema Literaturverfilmungen und skizziert dies am Beispiel des Romans "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" von John Green aus dem Jahre 2012 und geht hierbei auf Unterschiede und Wirkungsweise ein.
Während es die Literatur schon seit Jahrtausenden gibt, ist das Medium Film ein vergleichbar sehr junges Medium. Erst innerhalb des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelte sich der Film zu einem der dominierenden Medien und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Das Buch rückt im Laufe der wechselnden Generationen vermehrt in den Hintergrund. Gerade für den Zweck der Unterhaltung greifen die jüngeren Generationen nur noch selten zum Buch und bevorzugen stattdessen die Massenmedien Film und Fernsehen.
Da heutzutage viele Bestseller- Romane verfilmt werden, wird häufig auf das Lesen dieser verzichtet und stattdessen die Form des Films bevorzugt. Gerade beim Konsumieren des Films durch den Gang ins Kino steht hierbei gar nicht zwangsweise nur der Inhalt des Films im Vordergrund. Es geht hierbei auch um die gemeinsame Freizeitaktivität, wogegen beim Lesen eines Buches ausschließlich der Inhalt dessen entscheidend ist. Gerade bei Literaturverfilmungen sind jedoch diejenigen Kinobesucher, die sowohl die Literatur als auch den Film rezipiert haben oftmals enttäuscht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Das Medium Buch
- 2.2 Das Medium Film
- 2.3 Literaturverfilmung
- 3. Inhaltsangabe Roman
- 4. Vergleich Buch und Film
- 4.1 Hauptcharaktere im Vergleich
- 4.1.1 Hazel Grace Lancaster
- 4.1.2 Augustus Waters
- 4.2 Unterschiede in den Handlungen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die vergleichende Wirkung des Mediums Film im Vergleich zum Medium Buch auf den Rezipienten, insbesondere hinsichtlich der Atmosphäre und der Inneneinsicht in die Charaktere. Die Arbeit analysiert den Roman "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" von John Green und seine Verfilmung.
- Vergleich der Medien Buch und Film
- Analyse der Charakterentwicklung im Buch und Film
- Untersuchung der Unterschiede in Handlung und Atmosphäre
- Wirkung der unterschiedlichen Medien auf den Rezipienten
- Die Bedeutung von Literaturverfilmungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung vergleicht die lange Geschichte des Buches mit dem vergleichsweise jungen Medium Film und hebt die zunehmende Bevorzugung von Filmen gegenüber Büchern, insbesondere bei jüngeren Generationen, hervor. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der vergleichbaren Wirkung von Buch und Film auf den Rezipienten in Bezug auf Atmosphäre und Charaktere dar und benennt den Roman "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" und seine Verfilmung als Untersuchungsgegenstand.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für den Vergleich von Buch und Film. Es beleuchtet die historische Entwicklung und die Bedeutung des Buches als Medium für Wissensvermittlung und Unterhaltung, unter Berücksichtigung der Entwicklung des Buchdrucks und des Lesens als Kompetenz. Weiterhin beschreibt es die Entwicklung des Films als Medium, seine technischen Voraussetzungen und seine Entwicklung von der Unterhaltung auf Rummelplätzen zu einem bedeutenden Ort des Geschichtenerzählens. Es werden die Unterschiede zwischen sekundären (Buch) und tertiären (Film) Medien herausgestellt.
Schlüsselwörter
Buch, Film, Literaturverfilmung, "Das Schicksal ist ein mieser Verräter", John Green, Medienvergleich, Rezeption, Atmosphäre, Charaktere, Wirkung, Medienentwicklung.
Häufig gestellte Fragen zu "Das Schicksal ist ein mieser Verräter": Buch vs. Film
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit vergleicht die Wirkung des Romans "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" von John Green und seiner Verfilmung auf den Rezipienten. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Atmosphäre und der Darstellung der Charaktere in beiden Medien.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich der Medien Buch und Film, Analyse der Charakterentwicklung, Untersuchung der Unterschiede in Handlung und Atmosphäre, Wirkung der unterschiedlichen Medien auf den Rezipienten und die Bedeutung von Literaturverfilmungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen (inkl. Medium Buch, Medium Film und Literaturverfilmung), Inhaltsangabe Roman, Vergleich Buch und Film (inkl. Vergleich der Hauptcharaktere Hazel Grace Lancaster und Augustus Waters und Unterschiede in den Handlungen), und Fazit.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung und Bedeutung des Buches und des Films als Medien. Sie hebt die Unterschiede zwischen sekundären (Buch) und tertiären (Film) Medien hervor und betrachtet die Entwicklung des Lesens und des Films als Geschichtenerzählen.
Wie werden Buch und Film verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf die Hauptcharaktere, die Handlung und die Atmosphäre. Es wird untersucht, wie die Unterschiede in den Medien die Wirkung auf den Rezipienten beeinflussen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die vergleichende Wirkung von Buch und Film auf den Rezipienten, insbesondere hinsichtlich der Atmosphäre und der Inneneinsicht in die Charaktere.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Buch, Film, Literaturverfilmung, "Das Schicksal ist ein mieser Verräter", John Green, Medienvergleich, Rezeption, Atmosphäre, Charaktere, Wirkung, Medienentwicklung.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie wirkt sich der Unterschied zwischen Buch und Film auf die Rezeption von Atmosphäre und Charakteren beim Rezipienten aus?
- Arbeit zitieren
- Romano Wieczorek (Autor:in), 2019, Vergleich der Medien "Film" und "Buch". Am Beispiel von "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" von John Green, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/988198