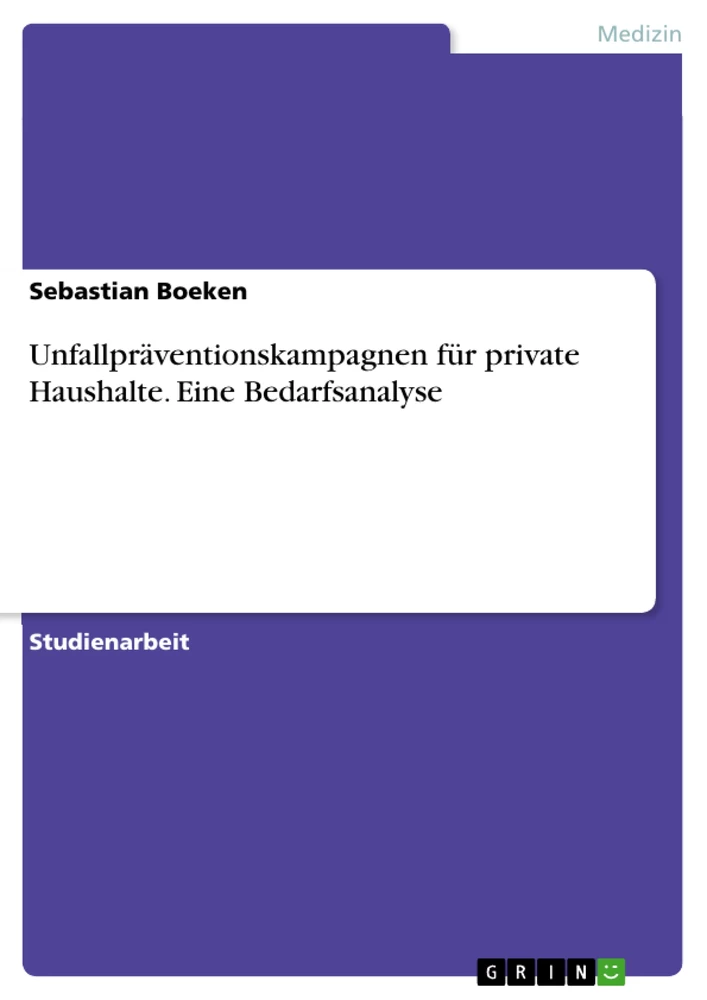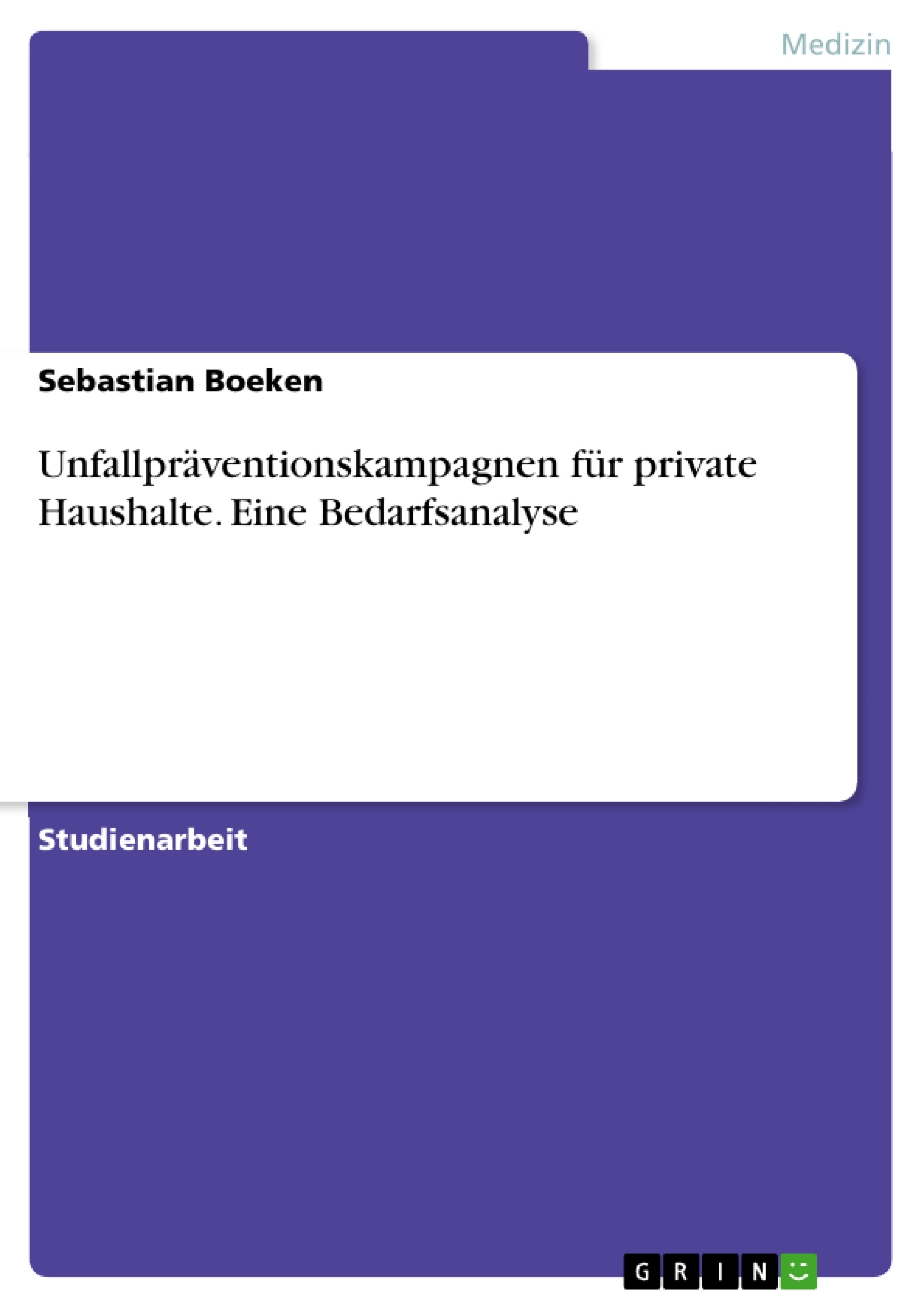Im Rahmen dieser Hausarbeit wird folgende Forschungsfrage untersucht: Sind Unfallpräventionskampagnen für alle Untergruppen der privaten Haushalte vorhanden? Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen werden vorhandene Interventionskampagnen betrachtet und die Zielgruppenerreichbarkeit kritisch hinterfragt. Die Bedarfsanalyse schließt mit konkreten Handlungsempfehlungen.
Unfälle stellen einen bedeutsamen Kostenfaktor für das Gesundheitssystem dar und verursachen hohes persönliches und finanzielles Leid. Die BAUA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) veröffentlichte aus dem Jahre 2015 die Verteilung der Unfälle nach Kategorien. Hiernach stehen 3,15 Millionen Unfallverletzten und 9,816 Unfalltoten aus dem häuslichen Umfeld lediglich 0,99 Millionen Unfallverletzte und 480 Unfalltote im Betrieb gegenüber. Im Jahre 2014 hatten circa 11 % aller Männer und 7 % aller deutschen Frauen aus Deutschland einen Unfall. Im Alter von 18 - 29 Jahren sind die Unfallzahlen geschlechterübergreifend am höchsten (m: 18,1 %, w: 9,8 %) und nehmen im Folgenden stetig ab.
Auch in Prävention und Gesundheitsförderung sind Ressourcen limitiert und somit zu schonen. Ziel der Hausarbeit ist die Grundlagenarbeit. Auf dieser Grundlage könnten ressourcenschonend Interventionskampagnen für relevante Schwerpunktthemen auf Mikro- und Meso-Ebene (Personen direkt und Settings/Lebenswelten) erstellt werden. Leodolter hält hierzu fest, dass in der Unfallverhütung ganzheitliche und integrative Interventionsmodelle angewendet werden müssen, bei dem die Menschen eigenverantwortlich die vorhandenen Sicherheitsvorkehrungen auch nutzen.
Die Anwendung von Marketing-Techniken zur Erstellung und Optimierung von Präventionsinterventionen sowie zur Erreichung der Zielgruppe stellt eine moderne Herangehensweise dar. Im Rahmen der Leistungspolitik (Produktpolitik) werden u.a. Situationsanalysen der Zielgruppe(n) herangezogen, um Präventionsinterventionen zu designen. Somit empfiehlt sich zumindest anteilig die Verwendung des sog. Familienlebenszyklus zur weiteren Unterteilung der Individuen des Settings privater Haushalt. Der Familienlebenszyklus beschreibt die realen Lebensumstände besser als z.B. die sog. A und E Segmentierung (Alter und Einkommen). Der Familienlebenszyklus wird in Kapitel 2.5 näher beschrieben, ebenso eine für diese Hausarbeit notwendige Modifizierung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1. Unfälle & Public Health
- 2.2. Unfallstatistik in Deutschland
- 2.3. Besonderheiten und rechtliche Rahmenbedingungen
- 2.4. Das DALY-Konzept als Beispiel einer Kennzahl
- 2.5. Der Familienlebenszyklus
- 3. Methodisches Vorgehen
- 4. Ergebnisse
- 4.1. Zielgruppenorientierte Interventionskampagnen
- 4.1.1. Zielgruppen
- 4.1.2. Tabellarische Übersicht der Rechercheergebnisse
- 4.1.3. Beschreibung von 5 Kampagnen
- 4.1.3.1. Die Aktion „Das sichere Haus“
- 4.1.3.2. AXA Kindersicherheit
- 4.1.3.3. VDEK
- 4.1.3.4. BIVA
- 4.1.3.5. BFR Bundesinstitut für Risikobewertung
- 4.1.3.6. Exkurs: DGUV - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
- 4.2. Sturzprävention als besonderer Schwerpunkt
- 5. Diskussion
- 5.1. Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5.2. Zielgruppenerreichbarkeit/Präventionsdilemma
- 5.3. Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Verfügbarkeit von Unfallpräventionskampagnen für private Haushalte in Deutschland. Ziel ist die Grundlagenarbeit für die Entwicklung ressourcenschonender Interventionskampagnen auf Mikro- und Meso-Ebene. Die Arbeit analysiert den Bedarf an solchen Kampagnen und betrachtet die Herausforderungen bei der Zielgruppenansprache.
- Analyse der Unfallstatistik in privaten Haushalten und deren Besonderheiten
- Bewertung bestehender Unfallpräventionskampagnen
- Untersuchung der Zielgruppenerreichbarkeit und des Präventionsdilemmas
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für zukünftige Kampagnen
- Bedeutung des Familienlebenszyklus für die Gestaltung von Präventionsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und betont die hohen Kosten und das Leid, die durch Unfälle in privaten Haushalten entstehen. Sie verweist auf die Diskrepanz zwischen der hohen Unfallhäufigkeit im häuslichen Bereich im Vergleich zu Arbeitsunfällen und stellt die Forschungsfrage nach der Existenz von Unfallpräventionskampagnen für alle Untergruppen privater Haushalte. Die Arbeit fokussiert auf die Entwicklung ressourcenschonender Interventionskampagnen, die ganzheitliche und integrative Modelle verwenden und die Eigenverantwortung der Menschen betonen. Die Anwendung von Marketing-Techniken zur Optimierung von Präventionsinterventionen wird als moderne Herangehensweise hervorgehoben, wobei der Familienlebenszyklus als hilfreiches Instrument zur Zielgruppendefinition genannt wird.
2. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Aspekte des Themas. Zuerst wird der Zusammenhang zwischen Unfällen und Public Health thematisiert, wobei die steigende Anzahl häuslicher Unfälle in Industrieländern im Vergleich zu Verkehrsunfällen hervorgehoben wird. Anschließend wird die unzureichende systematische Erfassung von häuslichen Unfällen in Deutschland kritisiert, die fehlende Altersdifferenzierung in den Daten wird bemängelt und auf die Kritik der Bundesärztekammer an der fehlenden nationalen Unfallprävention hingewiesen. Der Abschnitt zur Unfallstatistik verdeutlicht die mangelnde Datenlage und die Bedeutung von Studien wie GEDA zur Ergänzung vorhandener Statistiken. Schließlich werden Besonderheiten und rechtliche Rahmenbedingungen behandelt, die die Herausforderungen bei der Datenbeschaffung und der Präventionsarbeit verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Unfallprävention, private Haushalte, Unfallstatistik Deutschland, Interventionskampagnen, Zielgruppen, Familienlebenszyklus, Präventionsdilemma, Ressourcen, Marketing-Techniken, Gesundheitsförderung, Public Health, GEDA, DALY.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Unfallpräventionskampagnen in privaten Haushalten
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Verfügbarkeit von Unfallpräventionskampagnen für private Haushalte in Deutschland und analysiert den Bedarf an solchen Kampagnen sowie die Herausforderungen bei der Zielgruppenansprache. Ein zentrales Ziel ist die Grundlagenarbeit für die Entwicklung ressourcenschonender Interventionskampagnen auf Mikro- und Meso-Ebene.
Welche Aspekte werden im theoretischen Hintergrund behandelt?
Der theoretische Teil beleuchtet den Zusammenhang zwischen Unfällen und Public Health, kritisiert die unzureichende Unfallstatistik in Deutschland, insbesondere die fehlende Altersdifferenzierung, und diskutiert Besonderheiten und rechtliche Rahmenbedingungen der Unfallprävention. Das DALY-Konzept und der Familienlebenszyklus werden als relevante Konzepte vorgestellt.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Methodik der Hausarbeit wird im Kapitel 3 detailliert beschrieben (im vorliegenden Auszug nicht enthalten). Es ist anzunehmen, dass die Analyse bestehender Unfallpräventionskampagnen und die Untersuchung der Zielgruppenerreichbarkeit zentrale methodische Bestandteile darstellen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen eine Analyse zielgruppenorientierter Interventionskampagnen, darunter die Beschreibung von fünf konkreten Kampagnen ("Das sichere Haus", AXA Kindersicherheit, VDEK, BIVA, BFR Bundesinstitut für Risikobewertung) sowie ein Exkurs zur DGUV. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Sturzprävention. Die Ergebnisse werden in tabellarischer Form aufbereitet.
Welche Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Diskussion fasst die Ergebnisse zusammen, analysiert die Zielgruppenerreichbarkeit und das Präventionsdilemma. Sie enthält Handlungsempfehlungen für zukünftige Kampagnen, die auf einer ganzheitlichen und integrativen Herangehensweise basieren und die Eigenverantwortung der Menschen betonen. Die Bedeutung des Familienlebenszyklus für die Gestaltung von Präventionsmaßnahmen wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Unfallprävention, private Haushalte, Unfallstatistik Deutschland, Interventionskampagnen, Zielgruppen, Familienlebenszyklus, Präventionsdilemma, Ressourcen, Marketing-Techniken, Gesundheitsförderung, Public Health, GEDA, DALY.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund (mit Unterkapiteln zu Unfällen & Public Health, Unfallstatistik in Deutschland, Besonderheiten und rechtliche Rahmenbedingungen, DALY-Konzept und Familienlebenszyklus), Methodisches Vorgehen, Ergebnisse (mit Unterkapiteln zu zielgruppenorientierten Interventionskampagnen und Sturzprävention), und Diskussion (mit Unterkapiteln zur Zusammenfassung der Ergebnisse, Zielgruppenerreichbarkeit/Präventionsdilemma und Handlungsempfehlungen).
- Citation du texte
- Sebastian Boeken (Auteur), 2019, Unfallpräventionskampagnen für private Haushalte. Eine Bedarfsanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/988322