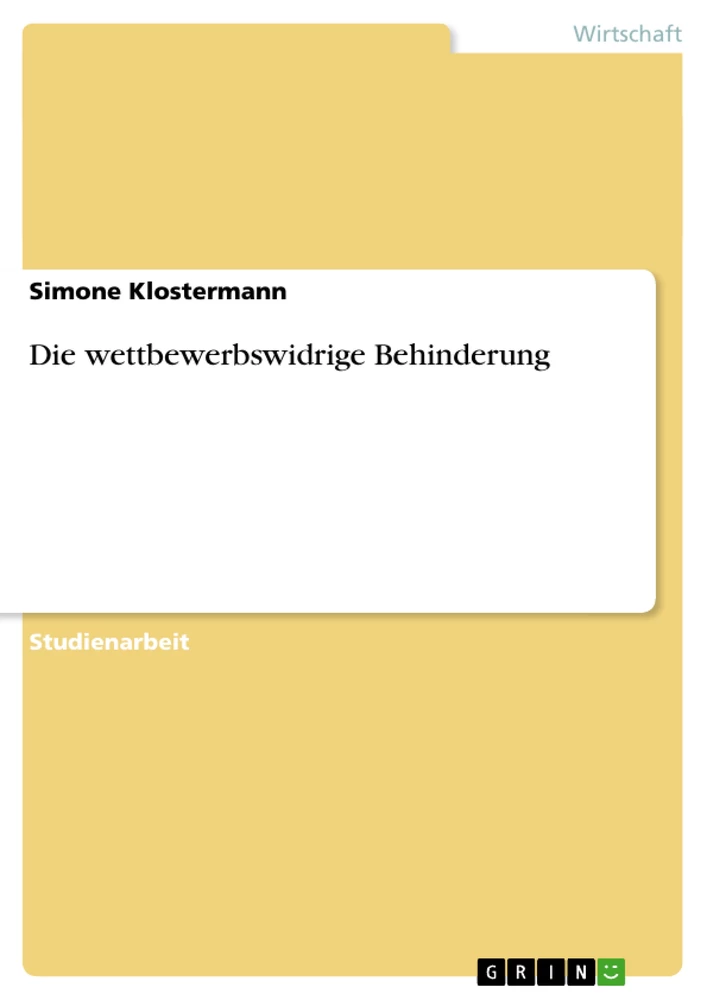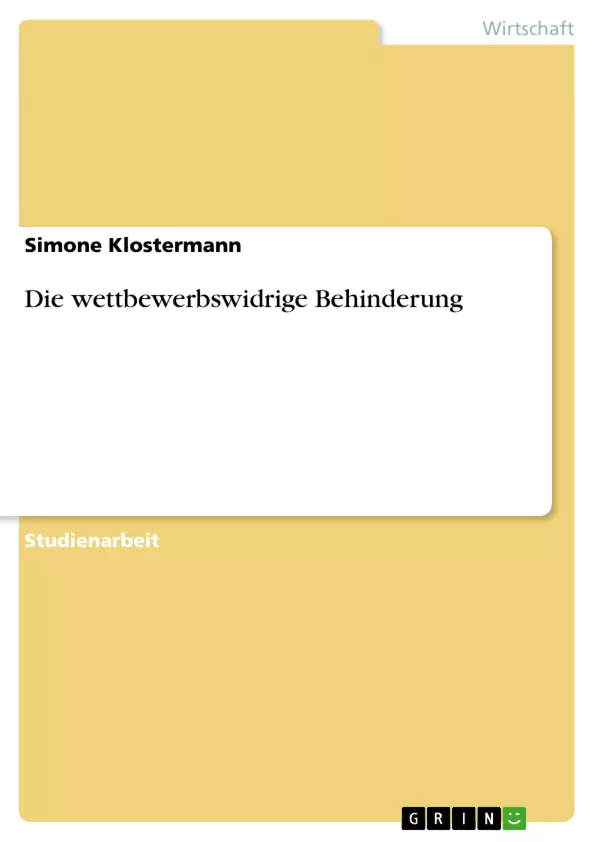Inhaltsverzeichnis
1.Die Behinderung als Form der Sittenwidrigkeit im § 1 UWG
2.Konkrete Idee der Behinderung
3.Einzelne Fälle der Behinderung
3.1 Absatz- und Bezugsbehinderung
3.1.1 Abfangen als Absatzbehinderung
3.1.2 Gegenwerbung als Absatzbehinderung
3.1.3 Aufkauf von Konkurrenzware als Absatzbehinderung
3.1.4 Marktverstopfung als Absatzbehinderung
3.1.5 Bezugsbehinderung
3.2 Werbebehinderung
3.3 Betriebsstörung
3.3.1 Entfernung von Kontrollnummern oder -zeichen
3.3.2 Störung des Arbeits- oder Betriebsfriedens
3.3.3 Sperre durch Zeichenerwerb
3.4 Preisunterbietung
3.5 Boykott und Diskriminierung
3.5.1 Der Boykott
3.5.2 Die Diskriminierung
3.6 Geschäftsehrverletzung und Anschwärzung
3.7 Vergleichende Werbung
4. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Ackermann, Brunhilde, Wettbewerbsrecht, Unter Berücksichtigungeuroparechtlicher Bezüge, Springer Verlag, Berlin 1997, 1. Auflage
Baumbach, Adolf und Hefermehl, Wolfgang, Wettbewerbsrecht, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1998, 20. Auflage
Emmerich, Volker, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1998, 5. Auflage
Heße, Manfred, Wettbewerbsrecht, Eine Einführung in das Recht gegen den
unlauteren Wettbewerb und das Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Fortis Verlag FH, Köln 1998, 1. Auflage
Köhler, Helmut und Piper, Henning, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1995, 1. Auflage
Marshall, Hans, Unlauterer Wettbewerb, Materielles Recht und Verfahren in Wettbewerbssachen, Jehle-Rehm-Verlag, 1993, 1. Auflage
Nordemann, Wilhelm; Nordemann, Axel und Nordemann, Jan Bernd, Wettbewerbsund Markenrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1996, 8. Auflage
Piper, Henning, Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Wettbewerbsrecht, RWS Verlag, Köln 1996, 2. Auflage
Rittner, Fritz, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Eine systematische Darstellung des deutschen und europäischen Rechts für Studium und Praxis, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 1999,
6. Auflage
Vogt, Stefan, Lexikon des Wettbewerbsrechts, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1996, 1. Auflage
1. Die Behinderung als Form der Sittenwidrigkeit im § 1 UWG
Diese Arbeit soll dem Leser einen Eindruck vermitteln, was mit wettbewerbswidrigerBehinderungimSinnedes § 1UWGgemeintist.FürdieBewertungeinerWettbewerbshandlung verweist die Generalklausel des § 1 UWG auf den Maßstab der „gutenSitten“. Es ist daher zunächst erforderlich den Begriff der Sittenwidrigkeit genauer zubetrachten und gleichzeitig den übergeordneten Schutzzweck des UWG zu erläutern.Allgemein gesagt wendet sich der §1 UWG gegen ein wettbewerbswidriges Verhalten, dasbestimmte Mitbewerber daran hindert, ihre Leistungen auf dem Markt zur Geltung zu bringenoder den Bestand des Wettbewerbs auf einem bestimmten Markt gefährdet.1
Für die Prüfung einer Wettbewerbshandlung muß der Maßstab der guten Sitten im Einklang stehen mit dem Sinngehalt des Wettbewerbs, der Wettbewerbsfreiheit voraussetzt und manifestiert2. Sittenwidrig und somit wettbewerbswidrig sind Handlungen, die dieser Intention des Wettbewerbs nicht entsprechen.
Sinngehalt des UWG ist die Idee des Leistungswettbewerbs. Der Gewerbetreibende soll mit der Qualität der angebotenen Leistungen oder Produkte werben, nicht aber die potentiellen Abnehmer mit unlauteren Methoden beeinflussen.3
Vielmehr besteht der Leistungswettbewerb darin, daß die jeweiligen Konkurrenten mit derPreiswürdigkeit, der Qualität und sonstigen Vorzügen ihrer Produkte auf dem Markt um dieKunden kämpfen. Es ist durchaus systemimmament, von der Wirtschaftsordnung letztlichgebilligt und somit nicht wettbewerbswidrig, daß die Vergrößerung des eigenen Marktanteilsbis zur Verdrängung von Mitbewerbern führen kann. Behinderungen, die auf diese Weise imRahmen des freien Leistungswettbewerbs eintreten, muß daher jeder Marktteilnehmerhinnehmen.4
Es soll sich demnach die Leistung auf dem Markt durchsetzten, die nach Meinung desvergleichendenKundennachPreis,QualitätundKundendienstdiebessereist.Voraussetzung für einen Leistungsvergleich ist, daß jeder Wettbewerber seine Leistung aufdem Markt frei anbieten und jeder Nachfrager die ihm zusagende Leistung frei wählen kann.Für die Prüfung einer Wettbewerbshandlung am Maßstab der guten Sitten ist es demnach
erheblich, ob zu Wettbewerbszwecken Mittel verwendet werden, die geeignet sind, den Leistungsvergleich zu verfälschen. 5
§1 UWG ist eine Generalklausel,die in der vergangenen Zeit durch Literatur und Rechtsprechung mit Inhalt erfüllt wurde.Dadurch und durch das Herausbilden von Fallgruppen -wie z.B.Kundenfang,Behinderung,Ausbeutung,VorsprungdurchRechtsbruch, Marktstörung -wurden die Grenzen dieser Norm gezogen. Die Fallgruppendienen dabei nur einer gewissen Einordnung. Für die Wettbewerbswidrigkeit eines Verhaltensist es nicht erforderlich, daß dieses Verhalten in eine Fallgruppe einordnenbar ist.6 Sie sollenprimär zur Gewinnung von Wertungsgesichtspunkten dienen und sind nicht erschöpfend.7
2. Konkrete Idee der Behinderung
Die Behinderung ist eine dieser Fallgruppe zur Präzisierung des Begriffs „gute Sitten“ im § 1UWG. Aufgrund des Leitbildes des freien Leistungswettbewerbes, ist der Einsatz derbesseren Leistung grundsätzlich wettbewerbsgerecht, selbst wenn er zur Behinderung odergar zur völligen Aussschaltung des Mitbewerbers führt. Folgerichtig ist grundsätzlich dieBehinderung oder Ausschaltung der Konkurrenz auf andere Weise als durch Leistungunzulässig 8.
In diesem Sinne bezeichnet man als Behinderungswettbewerb ein Marktverhalten, bei dem ein “Behinderer” sein Produkt nicht mehr durch den günstigeren Preis, die höhere Qualität und die sonstigen Vorzüge fördert, sondern durch die Verdrängung oder Beseitigung des Wettbewerbs.DiesesVerhaltenstehtimGegensatzzudenPrinzipiendesfreien Leistungswettbewerbs und ist unlauter im Sinne von § 1 UWG.9
Unter der Fallgruppe Behinderung werden die Wettbewerbshandlungen erfaßt, die denMitbewerber daran hindern, dem Kunden seine Leistung zum Vergleich mit den Leistungenanderer Mitbewerber zu stellen, und ihn dadurch vom Leistungswettbewerb auszuschalten.10
In diesem Falle ist die Beeinträchtigung oder die Verdrängung des Mitbewerbers vom Markt nicht eine wesenseigene Folge des Wettbewerbs, sondern die Folge der Ausschaltung des Mitbewerbers vom Leistungsvergleich. Der Wettbewerber fördert sein Unternehmen nichtdurch die bessere Leistung, sondern durch Beseitigung des Mitbewerbers11. Von vorneherein wettbewerbswidrig ist demnach eine Maßnahme, die ausschließlich bezweckt,denMitbewerber an seiner wettbewerblichen Entfaltung zu hindern oder ihn gar zu vernichten. 12
Die Behinderung ist also gezielt gegen einen oder mehrere Mitbewerber gerichtet. Dabei bedient sie sich verschiedener wettbewerbswidriger Methothen, so z.B. der Absatz- und Bezugsbehinderung, der Werbebehinderung, der Betriebsstörung, der Preisunterbietung, des Boykotts und der Diskriminierung oder der vergleichenden Werbung. Geschützt wird der betreffende Mitbewerber nicht um seiner selbst willen, sondern weil und soweit die Mittel mit einem Wettbewerb gemäß den “guten Sitten” nicht vereinbar sind.13
Die folgenden Ausführungen sollen den Tatbestand der sittenwidrigen Behinderung anhand derobengenanntenUnterfallgruppenexemplarischerläutern,sindaberkeineswegs erschöpfend.VielmehrsollderLesereinGefühldafürbekommen,wasunterder wettbewerbswidrigen Behinderung im Sinne des § 1 UWG zu verstehen ist.
3. Einzelne Fälle der Behinderung
3.1 Die Absatz- und Bezugsbehinderung
3.1.1Abfangen als Absatzbehinderung
Eine Möglichkeit, den Wettbewerber im Bereich des Absatzes zu behindern, ist das Abfangenvon Kunden. Das Eindringen in einen fremden Kundenkreis, liegt an sich im Wesen desWettbewerbs und ist, auch wenn der Mitbewerber vom Markt verdrängt wird, noch nichtunlauter14.
Eine unlautere Behinderung des Mitbewerbers durch Einwirkung auf (potentielle) Kunden liegterst dann vor, wenn diese am (möglichen) Erwerb der Ware oder Leistung gehindert werden(sollen).15
Dassogenannte“Abfangen”vonKundenisteinBeispielfüreinekundenbezogeneAbsatzbehinderung,beidemsichjemandbeispielsweisevordemGeschäftseinesMitbewerbers aufstellt, um Kunden zu werben. Dies läßt in der Regel nur den Schluß zu, erwolle gerade die Kunden des Mitbewerbers abfangen, ihn also absichtlich behindern oder garausschalten16.
Der BGH hat in seiner Entscheidung zum Fall “Kfz-Nummernschilder” festgestellt, daß die Werbung in der unmittelbaren Nähe oder vor dem Geschäft des Mitbewerbers, z.B. durch Ansprechen,VerteilenvonWerbezettelnoderAufstellenvonVerkaufswagen wettbewerbswidrig sein kann, wenn es dem Mitbewerber dadurch unmöglich gemacht wird, seine Leistung dem Kunden anzubieten und durch das Dazwischenschieben ein sachlicher Leistungsvergleich für den Kunden ausgeschlossen wird.17
Als wettbewerbswidrig angesehen wurde in diesem Fall, wenn ein Hersteller von Kfz- Nummernschildern sich vor dem Ausgang des Polizeipräsidiums postiert, um die mit einemroten Kennzeichenzettel herauskommenden Personen persönlich anzusprechen, und dadurchzu verhindern, daß diese ein auf der anderen Straßenseite befindliches Konkurrenzgeschäftaufsuchen.18
Das gezielte Abfangen von Kunden eines Mitbewerbers in unmittelbarer Nähe seines Geschäfts ist - wie in diesem Fall - demnach wettbewerbswidrig, wenn es einen sachlichen Leistungsvergleich mit dessen Angebot vereitelt.19
Unter dem Gesichtspunkt des Abfangens von Kunden wurde das vorübergehende Verteilenvon Handzetteln in einer geschäftsreichen Großstadtstraße als zulässig angesehen, auchwenn ein Konkurrenzgeschäft in der Nähe ist.20Ebenfalls als zulässig beurteilt wurde dasVerteilen von Handzetteln in der Nähe eines privaten Automarkts, wenn für eine mehrereTage später stattfindende Konkurrenzveranstaltung geworben wird, da der Kunden dieMöglichkeit hat, in Ruhe und frei von Übereilung die konkurrierenden Angebote zuvergleichen.21
Hinweisschilder in der Nähe des anderen Geschäfts können, wenn für sie ein besondererAnlaßbestehtebenfallszulässigsein.22AuchläßtsichausderAufstellungvonFirmenfahrzeugen vor dem benachbarten Betrieb des Konkurrenten, wenn es keine andereParkmöglichkeit gibt, nicht auf eine Schädigungsabsicht schließen, sie ist daher zulässig.23
3.1.2 Gegenwerbung als Absatzbehinderung
Eine weitere Variante der Absatzbehinderung ist die unzulässige Gegenwerbung. So ist es beispielsweise wettbewerbswidrig, mit einem Inserat im Fernsprechbuch auf der Seite eines Mitbewerbers zu werben, obwohl die Firma des Werbenden mit einem anderen Buchstaben anfängt24. Aus Bequemlichkeit wird dann der Kunde oft beim Inserenten anrufen und nicht erst den im Kleindruck verzeichneten Mitbewerber heraussuchen. Auf diese Weise wird dieser vom Leistungsvergleich ausgeschlossen.25
3.1.3Aufkauf von Konkurrenzware als Absatzbehinderung
Auch der Aufkauf von Konkurrenzware kann eine Absatzbehinderung darstellen. Obwohl es einem Wettbewerber nicht grundsätzlich verwehrt ist, Konkurrenzware zu kaufen oder zu übernehmen26, kann diese Handlung bei Hinzukommen bestimmter Unlauterkeitsmerkmale eine wettbewerbswidrige Behinderung darstellen.
Unzulässig ist, wenn ein Wettbewerber die Ware eines Mitbewerbers aufkauft, um ihn als lieferunfähig hinzustellen oder um durch Herausziehen der Konkurrenzware vom Markt freie Bahn für den Absatz der eigenen Ware zu gewinnen. So kauft man beispielsweise die Konkurrenzware beim Groß- oder Einzelhändler auf oder nimmt sie von diesem gegen Lieferung der eigenen Ware in Zahlung. Die Verdrängung des Mitbewerbers vom Markt ist hier eine Folge des Aufkaufs, nicht aber eines Leistungsvergleichs.27
3.1.4Marktverstopfung als Absatzbehinderung
Eine gegen § 1 UWG verstoßende Absatzbehinderung ist auch die Marktverstopfung.Davon spricht man, wenn ein Wettbewerbsverhalten dazu geeignet ist, alle anderenMitbewerber vom Markt zu verdrängen. Sie ist eine Störung des Wettbewerbs, die darauf abzielt, das Spiel der freien Kräfte von Angebot und Nachfrage zu beseitigen und dadurchMitbewerber vom Markt zu verdrängen, den man dann anschließend allein für sich hat28.
So kann beispielsweise massenweises Verschenken von Originalware unter § 1 UWG fallen, wenn sie anderen Mitbewerbern die Möglichkeit nimmt, am Wettbewerb teilzunehmen und dadurch der Leistungswettbewerb in seinem Bestand gefährdet wird.29Der Werbende deckt so zumindest zeitweise den Bedarf des Aktionsgebietes und macht es seinen Mitbewerbern unmöglich, mit ihm in Konkurrenz zu treten. Die Ausschaltung der Mitbewerber hat mit ihrem Leistungsvermögen nichts mehr zu tun, daher widerspricht diese Behinderung dem Prinzip des freien Leistungswettbewerbs und ist unzulässig.30
Das Verschenken von waren zu Werbezwecken verstößt jedoch nicht schlechthin gegen dieguten Sitten im Sinne des § 1 UWG. Die Ausschaltung des Leistungswettbewerbs istbeispielsweise nicht gegeben, wenn es sich um ein neues Produkt handelt, dessenmassenweisesVerschenkendenMarktersterschließensoll.HierwirdderLeistungswettbewerbnichtbehindert,sonderngeradeerstermöglicht.WirdkeineOriginalware, sondern nur eigens hergestellte Proben verschenkt, besteht die Gefahr derMarktverstopfung ebenfalls nicht.31
3.1.5 Bezugsbehinderung
Eine wettbewerbswidrige Behinderung kann auch beim Einkauf benötigter Einsatzstoffeauftreten.
Die Gewerbetreibenden stehen beim Einkauf der benötigten Rohstoffe zwar im Wettbewerbmit anderen Nachfragern, jedoch scheidet bei normalen Marktverhältnissen eine Behinderungaus. Doch auch bei einer Rohstoffknappheit ist es nicht wettbewerbsfremd, wenn einWettbewerber seinen Mitbewerbern zuvorkommt und sämtliche auf dem Markt befindlichenRohstoffe für sich aufkauft.32
Unlauter ist es allerdings, wenn ein Unternehmer mehr oder andere Ware bezieht, als er denUmständen nach für seine eigenen Zwecke benötigt, und die Maßnahme daher nur den Zweck haben kann, den Bezug für den Mitbewerber unmöglich zu machen oder zu verteuern.33
Entsprechendes gilt für den Erwerb sonstiger, vom Mitbewerber benötigter Wirtschaftsgüter(Betriebsgrundstücke, Werbeflächen)34oder das wettbewerbswidrige “Ausmieten”, wobei nachden gleichen Grundsätzen wie der Rohstoffaufkauf zu beurteilen ist. Ein Wettbewerber mietet,um einen Mitbewerber zu schädigen, Geschäftsräume, die er überhaupt nicht verwendenkann.35
3.3 Werbebehinderung
Grundsätzlich wettbewerbswidrig ist es, die Werbung eines Mitbewerbers dadurch zu vereiteln, daß man seine Werbeplakate oder Aufdrucke zerstört, überklebt oder überdeckt. Wettbewerbswidrig ist es auch in einem Branchenfernsprechbuch in der Form zu werben, daß ein Gutschein auszuschneiden ist, wodurch die sich auf der Rückseite befindliche Werbung eines Mitbewebers, wertlos gemacht wird.36
In gleicher Weise wird die Werbung der Konkurrenz ausgeschaltet, wenn ein Kaufmann kostenlos Schutzumschläge für das amtliche Fernsprechbuch auf dessen Heftumschlag der Konkurrent wirbt, in großem Umfang verteilt oder Telefonkarten, die fremde Werbung enthalten, überdruckt.37
Das Entfernen von Kennzeichen, Marken oder einer besonderen Aussstattung der Ware,durch einen Wettbewerber ist ebenfalls eine Werbebehinderung. Diese Kennzeichnung wurdenämlich angebracht, um eine Werbewirkung für die betreffenden Waren und für den Betriebzu entfalten, was für dessen zukünftigen Absatz von entscheidender Bedeutung sein kann.Diese Funktion einer Werbewirkung können die Waren nach der Beseitigung nicht mehrentfalten.38
Man wird jedoch immer auf den Einzelfall abzustellen haben. Wenn besondere Umständeergeben, daß die Kennzeichenbeseitigung den Zweck hat und dazu geeignet ist, denHersteller in seiner Werbung zu behindern oder gar auszuschalten, wird man von unlautererBehinderung sprechen können. Das trifft bei Beseitigung in großem Umfange zu, die auch im Verhältnis zum Gesamtumsatz des Herstellers ins Gewicht fällt. Dafür reichen wenige EinzelhändlerinverschiedenenOrtenkeineswegsaus.Andererseitskommtder Gesichtspunkt der Irreführung des Verbrauchers über die Herkunft der Ware in Betracht, doch gehört dieser Bereich in die Fallgruppe Kundenfang. Bei Kontrollzeichen, die keinerlei Werbefunktion haben, scheidet eine unlautere Werbebehinderung aus.39
3.4 Betriebsstörung
Diese Untergruppe der Behinderung wird hier exemplarisch dargestellt an den Fallgruppen Entfernen von Kontrollnummern/-zeichen, Störung des Arbeits- und Betriebsfriedens und Sperre durch Zeichenerwerb.
3.4.1 Entfernen von Kontrollnummern - oder Zeichen
Ein Unternehmer kann weiter durch die Entfernung von Kontrollzeichen von seinen Waren behindert werden. Dieser Aspekt wird hier unter dem Gesichtspunkt der Betriebsstörung behandelt. Die Zuordnung geschieht aber in der Literatur z.T. anders. So betrachten z.B. KöhlerundPiper40dieEntfernungvonKontrollnummernunterderFallgruppe Absatzbehinderung. Dies ändert aber nichts an der Beurteilung der Wettbewerbswidrigkeit, die unter bestimmten Voraussetzungen gegeben ist.
Hersteller bringen oft Kontrollnummern oder -zeichen an der Ware oder Verpackung an, umihrselektivesVertriebssystemzuüberwachen.41DieseauchCodenummernoderCodierungengenanntenZeichenhabenvorrangigdieAufgabe,eineKontrollederVertriebswege zu ermöglichen. Der Hersteller kann damit feststellen, ob sich seine Abnehmeran etwaige Vertriebsbindungen halten und, wenn die Ware bei “Außenseitern” oder auf dem“grauen” Markt auftaucht, aus welcher Quelle diese vermutlich beliefert worden sind. 42
Händler, die am “grauen” Vertrieb ineressiert sind, entfernen nun diese Kontrollnummern vonZeit zu Zeit. Besteht keine rechtswirksame vertragliche Vetriebsbindung, liegt in dieserBeseitigung von Kontrollnummern, mit denen der Hersteller den Vertriebsweg seiner Ware verfolgt, um die ihm nicht genehmen Händler vom Warenbezug auszuschließen sucht, keine wettbewerbswidrige Behinderung des Herstellers. 43
Die Entfernung der Kontrollnummern ist deshalb nicht wettbewerbswidrig,weil das Vertriebssystem seinerseits als nicht schutzwürdig gesehen wird, da es geeignet ist, die kartellrechtlichen Schrankenfür ein Vertriebssystem zu unterlaufen44.Ein Kontrollnummernsystem kann dagegen schutzwürdig sein, wenn es dazu dient z.B. dieFunktionfähigkeit und Betriebsfähigkeit von Geräten zu überwachen oder ihren Rückruf zugewährleisten und die Kontrolle damit im allgemeinen Interesse liegt. Dies gilt nur hinsichtlichernster Gefahren wie sie z.B. durch die Verwendung gefährlicher Maschinen auftreten45. 46.
3.4.2 Störung des Arbeits- oder Betriebsfriedens
Die gewaltsame Einwirkung auf persönliche oder sächliche Betriebsmittel ist stets wettbewerbswidrig. Das gleiche gilt für Drohungen, die den Betrieb stören. Wettbewerbswidrig ist es auch, Arbeiter und Angestellte des Mitbewerbers zur Illoyalität, Verweigerung derTreuepflicht, Leistung schlechterer Dienste oder Stellung höherer Ansprüche aufzufordern, umdurch eine solche versteckte Behinderung des Mitbewerbers den eigenen Wettbewerb zufördern. Ein solches Handeln hat auch dann, wenn die Lage der Aufgehetzten tatsächlichverbesserungsbedürftig ist, nichts mit sozialer Einstellung zu tun, sondern ist eine aufeigennützige Beweggründe zurückzuführende Störung des Arbeitsfriedens.47
DasAuskundschaftenvonBetriebsvorgängen(Betriebsspionage)istgrundsätzlich wettbewerbswidrig, selbst wenn es sich nicht um “Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse” im Sinne der §§ 17-20a UWG handelt.48
Macht eine Testperson in einem Ladengeschäft zur Überprüfung einer Unterlassungsverpflichtung Aufnahmen, kann dies wettbewerbswidrig sein. Mit der Öffnungdes Verkaufsgeschäfts räumt der Inhaber dem Publikum das Recht ein, das Geschäft zubetreten, nicht jedoch dort zu fotografieren. Der Anbieter von Waren muß zwar dieAnwesenheit von Testpersonen hinnehmen, jedoch nur, solange sie sich wie normaleKaufinteressenten verhalten. Das Fotografieren gehört nicht dazu und bringt die Gefahr einer Störung des Betriebsfriedens und der Beeinträchtigung des guten Rufs mit sich.49
3.4.3 Sperre durch Zeichenerwerb / Markenerwerb
Die Anmeldung einer Marke kann unter Vorliegen besonderer Umstände unter dem Aspektder Betriebsstörung wettbewerbswidrig sein. Grundsätzlich hat der Vorbenutzer einerverwechslungsfähigen,nichtalsMarkegeschütztenBezeichnungkeinVor-oderWeiterbenutzungsrecht50. Vielmehr muß er seinerseits die Benutzung unterlassen, sofern der“neue Besitzer”, der die Marke hat eintragen lassen, Unterlassungsansprüche geltendmacht51.
Bei Vorliegen besonderer Umstände kann die Berufung auf das Markenrecht gegenüber demVorbenutzer jedoch wettbewerbswidrig sein. Hierzu einige Beispiele: Wettbewerbswidrig istes, wenn der Anmelder die Anmeldung ohne hinreichenden Grund vornimmt, obwohl er weiß,daßderVorbenutzerfürdiegleichebzw. verwechselbare, aber nicht eingetrageneBezeichnung einen wertvollen Besitzstand erworben hat52. Es ist ebenfalls wettbewerbswidrig,wenn mit der Markenanmeldung lediglich der Vorbenutzer an der Weiternutzung gehindertwerden soll. 53
Ferner ist die Anmeldung einer ausländischen Marke, die Weltgeltung besitzt unzulässig.Weltgeltung bedeutet, daß eine Marke im Inland noch nicht oder kaum benutzt worden ist,aber im Ausland eine überragende, auch inländischen Fachkreisen bekannte Verkehrsgeltungbesitzt. Diese begründet einen wettbewerblichen Besitzstand, ein schutzwürdiges Interesseund darf auf dem betreffenden Gebiet aufgrund eines formalen Zeichenrechts nicht verhindertwerden54. 55
Die Wettbewerbswidrigkeit der Anmeldung einer Marke kann auch dadurch begründet werden, daß auf diese Weise ausländische Unternehmen gezwungen werden sollen, dem Anmelder ein Alleinvertriebsrecht einzuräumen.56
Sind die Voraussetzungen der wettbewerbsrechtlichen Behinderung erfüllt, kann ein Anmelderdazu gezwungen werden, seine Anmeldung zurückzunehmen. Bei einer bereits eingetragenenMarke besteht bei Vorliegen der Behinderungsabsicht sogar Löschungsanspruch.57
3.4 Preisunterbietung
Der Preis ist im marktwirtschaftlichen System eine zentrale Größe. Vom Preis hängt es letztendlich ab, ob es zu einem Geschäftsabschluß kommt oder nicht. Da liegt es nahe, daß es gerade in diesem Bereich zu Wettbewerbsverstößen kommen kann, die sich meist in Form der Preisunterbietung darstellen.
Unser System des freien Wettbewerbs lebt davon, daß die Preisbildung frei ist, damit dieUnternehmen elastisch auf die sich ändernden Marktdaten reagieren können.58AusführlichergesagtistdiePreisgestaltungsfreiheiteineFolgederWettbewerbsfreiheitunddiePreisunterbietung zu Wettbewerbszwecken ist grundsätzlich erlaubt. Es entspricht derIntention des Leistungswettbewerbs, daß die bessere Leistung den Ausschlag gibt, wobei derPreis eines der wichtigsten Leistungsmerkmale ist, zu dem eine Ware im Verkehr angebotenwird.59
Vogt geht sogar soweit zu sagen, daß der Preiskampf um den Kunden, der mit den Mitteln der Preisunterbietung geführt wird geradezu das Wesen des freien Leistungswettbewerbs verkörpert.60Allerdings können zur Preisunterbietung unlautere Begleitumstände hinzutreten, die auf einen Verdrängungs- oder Vernichtungswettbewerb schließen lassen.
Wenn vorübergehend einzelne Waren unter dem Einstandspreis abgegeben werden, ist derPreiswettbewerb grundsätzlich noch nicht zu beanstanden61. Denn es ist zu berücksichtigen,daß es viele vernünftige Gründe gibt, die einen Kaufmann veranlassen können, seineEinstandspreise kurz- oder langfristig zu unterschreiten, so daß eine Prüfung des Einzelfallsunerläßlich ist. Für einen Händler kommt es letztlich allein darauf an, ob er insgesamt seineKosten decken kann. 62
Wettbewerbswidrig ist der Preiswettbewerb, bei Vorliegen einer auf Dauer angelegten, nicht kostendeckenden Preiskalkulation in Verdrängungsabsicht. Sie stellt eine mißbräuchliche Ausnutzung von Marktmacht und Wettbewerbsfreiheit dar und ist nach § 1 UWG als sittenwidrige Behinderung zu beanstanden.63
FürVorliegenderWettbewerbswidrigkeitmußdieMaßnahmedesVerkaufsunter Selbstkosten geeignet sein, einzelne Mitbewerber zu verdrängen oder zu vernichten und dies muß auch bezweckt sein.64
Ist der Verkauf auf längere Sicht angelegt, ist i. d. R. eine Eignung zur Verdrängung gegeben65. Der Verdrängungszweck ist jeweils an den objektiven Umständen des Einzelfalls zuprüfen.Dabeiistinsbesonderefestzustellen,obinderPreisgestaltungeine betriebswirtschaftlichvernünftige,jedenfallsnachkaufmännischenGrundsätzennoch vertretbare Kalkulation erkennbar ist.66
3.5 Der Boykott und Diskriminierung
3.5.1 Der Boykott
Das Kampfmittel des Boykotts ist eine wettbewerbswidrige Behinderung, die auf dieorganisierte Absperrung eines bestimmten Gegners vom üblichen Geschäftsverkehr (Absatz,Material, Beförderung, Kredit, etc.) gerichtet ist, in der Form, daß keine Beziehungengeschäftlicher oder sonstiger Art mit ihm angebahnt oder schon bestehende Beziehungenabgebrochen werden sollen. Zum Boykott wird eine Absperrung erst dann, wenn derjenige,der die Sperre durchführt, auf Veranlassung eines Dritten handelt.67Der Boykott setzt alsostets drei Personen, den Verrufer, den Adressaten und den Boykottierten, voraus.68
Köhler definiert Boykott folgendermaßen: “Unter Boykott ist die Aufforderung zu einer Lieferoder Bezugssperre zu verstehen” und nennt als Beispiele die Aufforderung an einen Verleger, keine Inserate eines Mitbewerbers anzunehmen oder die Aufforderung von Fachhändlern an einen Hersteller, keine Verbrauchermärkte zu beliefern.69
Als Wettbewerbsmaßnahme verstößt der Boykott grundsätzlich gegen § 1 UWG, weil der Verrufer seinen Einfluß ausnutzt, um lästige Mitbewerber zu behindern. Allein unter sehr engen Vorraussetzungen können Ausnahmen zugelassen werden (so z.B. der Abwehrboykott und Meinungs- und Pressefreiheit).70
Der Adressat muß in seiner Entscheidung über die Durchführung der Sperre frei sein; er darf also keinem Weisungsrecht des Auffordernden unterliegen. Daher erfüllen Weisungen, etwa an Tochterunternehmen71, Arbeitnehmer, Handelsvertreter oder sonstige weisungsgebundene Vertragspartner den Boykottatbestand nicht.72
Unlauter ist die Handlung weiterhin nur, wenn der Auffordernde zu Wettbewerbszwecken handelt. Die Absicht, fremden Wettbewerb zu fördern, genügt.73Bei Presseäußerungen ist eine Wettbewerbsabsicht nicht zu vermuten.74
Die Aufforderung zum Boykott muß eine Einflußnahme darstellen, subjektiv auf eineBeeinflussung der freien Willensentscheidung des Adressaten gerichtet und objektiv auchdazu geeignet sein. Dabei müssen die Adressaten und die zu Sperrenden hinreichendbestimmt sein.75Für die hinreichende Bestimmung reicht eine nähere Bezeichnung nach Gruppen- Tätigkeits- oder Organisationsmerkmalen (z.B. Elektrofachhandel; Verbrauchermärkte; ausländische Lieferanten) aus.76
VieleBoykottaufrufeliegenaberaußerhalbdesWettbewerbsrechts,dasieideelle Beweggründe haben und nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG geschützt sind. Sie sind rechtmäßig, wenn sie als Mittel des geistigen Meinungskampfes in einer der Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage eingesetzt werden. Zur Durchsetzung darf beispielsweise keine soziale oder wirtschaftliche Abhängigkeit ausgenutzt werden und der Aufruf darf keine unrichtigen Tatsachenbehauptungen enthalten, ansonsten ist er unzulässig.77
3.5.2 Die Diskriminierung
Unter einer Diskriminierung ist die, sachlich nicht gerechtfertigte, unterschiedliche Behandlung von Personen im geschäftlichen Verkehr zu verstehen. Diskriminiert werden kann durch den Preis, die Rabatte und Konditionen, durch die Ablehnung von Vertragsabschlüssen gegenüber Abnehmern (Liefersperren) oder Lieferanten (Bezugssperren).78
Die Diskriminierung setzt im Gegensatz zum Boykott nur zwei Beteiligte voraus, den Diskriminierenden und den Diskriminierten79und ist definitionsgemäß jede unterschiedliche Behandlung anderer im geschäftlichen Verkehr, die sachlich nicht gerechtfertigt ist. Doch darf man daraus keinesfalls einen prinzipiellen Kontrahierungszwang entnehmen; ein solcher würde das Ende einer privatautonomen marktwirtschaftlichen Ordnung bedeuten. Vielmehr steht es jedem Unternehmen grundsätzlich frei, seine potentiellen Kunden - durch Abschluß, bei Preisen, bei Mengen usw - unterschiedlich zu behandeln.80
Eine Diskriminierung im Sinne des § 1 UWG kann- trotz grundsätzlicher Zulässigkeit der Preisdiskriminierung - vorliegen, wenn die Preisdiskriminierung gezielt vorgenommen wird, um bestimmte Mitbewerber vom Markt zu verdrängen.81
3.6 Geschäftsehrverletzung und Anschwärzung
Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung berühren das Wettbewerbsrecht nur, wenn sie den eigenen oder fremden Wettbewerb fördern sollen, also Wettbewerbszwecken dienen. Man kann dies im Gegensatz zur privaten Ehrenkränkung Geschäftsehrverletzung nennen. Wer seinen Mitbewerber in der Geschäftsehre herabsetzt, erschwert ihm seine Leistung dem Kunden zum Vergleich zu stellen und strebt die Förderung des eigenen Wettbewerbs ausschließlich durch Behinderung des Mitbewerbers an.82
Das UWG enthält in den §§ 14, 15 UWG dazu Sondervorschriften, die sich jedoch nur auf denFall beziehen, daß unwahre oder nicht erweislich wahre Tatsachen über das Geschäft desMitbewerbers behauptet werden (Anschwärzung). Mitbewerber können jedoch durch wahre ebenso wie durch unwahre Behauptungen oder auch durch abfällige Werturteile herabgesetztwerden. Wettbewerbswidrigkeit gemäß § 1 UWG kann demnach auch vorliegen, wenn diegeschäftsschädigende Behauptung wahr ist. Das Hineinzerren der persönlichen Verhältnissedes Mitbewerbers in den Wettbewerb widerspricht dem Sinn des Leistungswettbewerbs.83
Auch wer zu Wettbewerbszwecken in die Persönlichkeitssphäre eines Mitbewerbers eingreift, insbesondere dessen Ehre und Würde mißachtet, handelt wettbewerbswidrig.84Reine Werturteile sind dann unzulässig, wenn sie darauf zielen, den Mitbewerber, seine Waren oder sein Unternehmen herabzusetzen. Maßgeblich ist, ob ein hinreichender Anlaß besteht und sich die Kritik nach Art und Maß im Rahmen des Erforderlichen hält.85
3.7 Vergleichende Werbung
Die vergleichende Werbung, die ebenfalls zur Fallgruppe der Behinderung gehört, wird in derZukunft geprägt sein von der vom Ministerrat der EU beschlossenen Richtlinie übervergleichende Werbung. Bisher wurde die Richtlinie 97/95 von der Bundesregierung nichtumgesetzt. Der BGH bezieht sie aber schon heute ein in die Auslegung des Begriffs derSittenwidrigkeit des § 1 UWG. Eine ausführliche Behandlung dieser Untergruppe würde denRahmen dieser Arbeit sprengen, darum soll an dieser Stelle nur sehr kurz auf die europäischeRichtlinie eingegangen werden.
Die Richtlinie 97/55 läßt die vergleichende Werbung grundsätzlich zu, knüpft sie jedoch aneine Reihe von Voraussetzungen. um Mißbräuchen vorzubeugen. 86Beispielsweise darf dievergleichende Werbung nicht irreführend sein, nur Waren oder Dienstleistungen für dengleichen Bedarf oder Zweck vergleichen, nur erhebliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften objektiv miteinander vergleichen und den Mitbewerber, Marken, Handelsnamen etc.nicht herabsetzen oder verunglimpfen. Weiterhin darf sie auf dem Markt keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und Mitbewerber oder zwischen Marken,Handelsnamen etc. hervorrufen und keinen unlauteren Vorteil aus dem Ruf einer Marke, einesHandelsnamens etc. ziehen.Bei Waren mit Ursprungsbezeichnung muß sie sich in jedem Fallauf Waren mit der gleichen Bezeichnung beziehen.87
4. Zusammenfassung / Fazit
Zur Präzisierung des Begriffs der guten Sitten im § 1 UWG hat die Rechtssprechung und einschlägige Literatur Fallgruppen herausgbildet. Eine davon ist die Behinderung, die sich wiederum in Untergruppen gliedern läßt. Jede dieser Gruppen charakterisiert eine andere Art der unlauteren Behinderung.
Sie kann in Form der Absatz- und Bezugsbehinderung, Werbebehinderung, Betriebsstörung,Preisunterbietung, Boykott und Diskriminierung, Geschäftsehrverletzung und Anschwärzungoder vergleichenden Werbung auftreten. Für das Vorliegen der Sittenwidrigkeit unter demAspekt der Behinderung muß eine Wettbewerbshandlung jedoch nicht zwingend in eine dieserGruppen eingegliedert werden können. Alle zu beurteilenden Wettbewerbshandlungenmüssen vielmehr daran gemessen werden, ob sie dem Sinn des Leistungswettbewerbsgerecht werden, ansonsten sind sie sittenwidrig. Die Fallgruppen und Unterfallgruppen dienendabei nur der Systematisierung.
Eine wettbewerbswidrige Behinderung wird, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer derUnterfallgruppen, dadurch gekennzeichnet, daß der Wettbewerber ohne eine echte eigeneLeistungausderwettbewerbswidrigenBehinderungdesMitbewerbers,diedenLeistungsvergleich verfälscht oder ausschließt, Vorteile auf dem Markt zu erzielen sucht88.
So wird durch das Abfangen von Kunden, die Werbebehinderung, der Aufkauf vonRohstoffen, die Anmeldung einer Marke etc. der Mitbewerber durch den Wettbewerber darangehindert,demKundenseineLeistungzumVergleichmitdenLeistungenandererMitbewerber zu stellen, und dadurch vom Leistungswettbewerb ausgeschlossen.
Die sittenwidrige Behinderung kann in vielerlei Formen auftreten, von denen hier die wichtigstenFälledargestelltwurden.MaßgeblichfürdieBeurteilungeiner Wettbewerbshandlung ist letztendlich jedoch immer der Maßstab der guten Sitten des § 1 UWG, der im Sinne des Leistungswettbewerbs ausgelegt wird.
[...]
1Baumbach/Hefermehl, S. 597
2Baumbach/Hefermehl, S. 212
3Vogt, S. 190
4 Vogt, S. 36, 37
5Ackermann, 43
6Marshall, S. 15, 16
7Ackermann, S.48
8Nordemann, S.145
9Vogt, S. 36, 37
10 Baumbach/Hefermehl, S. 596
11Baumbach/Hefermehl, S. 595
12Köhler/Piper, S. 184,185
13Rittner, S. 47,48
14Piper, S.69
15 Köhler/Piper, S. 186,187
16Nordemann, S. 152
17Ackermann, S. 140; BGH, GRUR 1960, 431, 433 (Kfz-Nummernschilder)
18Baumbach/Hefermehl, S. 598; BGH, GRUR 60, 431, 433 (Kfz-Nummernschilder)
19Piper, S. 69; BGH, GRUR 60, 431,433 (Kfz-Nummernschilder)
20Köhler/Piper, S. 187; KR, GRUR, 1984, 601,602
21 Köhler/Piper, S. 187; GRUR 1986, 547,548 (Handzettelwerbung)
22Nordemann, S. 152; OLG Hamm, WRP 1973, 538ff
23Nordemann, S. 152; OLG Düsseldorf, WRP 1985, 217, 219
24Bamberg, NJW-RR 93, 50
25Baumbach/Hefermehl, S. 599
26Baumbach/Hefermehl, S.599
27 Baumbach/Hefermehl, S. 599
28Marshall, S. 24
29Heße, S. 47
30Nordemann, S. 163-164
31BGH, GRUR 1969, 295, 297
32 Baumbach/Hefermehl, S. 606
33Köhler/Piper, S. 193
34Köhler/Piper, S. 193
35Baumbach/Hefermehl, S. 606
36Ackermann, S. 143
37Nordemann, S. 168; OLG Köln WRP 1984, 506
38 Marshall, S. 28
39Nordemann, S. 168f
40Köhler/Piper, a.a.O
41Köhler/Piper, S. 191
42 Emmerich, S.89
43Piper, S. 74
44BGH, GRUR 1988, 823 (Entfernung von Kontrollnummern I)
45BGH, GRUR 1978, 364, 367
46Piper, S. 74; Ackermann S. 145
47Baumbach/Hefermehl, S. 611, 612
48 Ackermann, S. 144
49Ackermann, S.144; BGH, WRP 1996, 1099 (Testphotos II)
50Baumbach/Hefermehl, S. 608
51Ackermann, S. 147
52BGH, GRUR, 1967, 490 „Pudelzeichen“
53Baumbach/Hefermehl, S. 608
54BGH, GRUR 1967, 298 (Modess)
55Ackermann, S. 148
56 BGH, GRUR 1980, 110 (Torch)
57Ackermann, S. 150
58Emmerich, S. 56
59Ackermann, S.152
60Vogt, S. 237
61Piper, S. 71
62 Emmerich, S. 58
63Piper, S. 71; BGH, GRUR 1990, 685, 686 (Anzeigenpreis I)
64BGH GRUR 1990, 687 688 (Anzeigenpreis II)
65BGH, GRUR 1990, 685, 686 (Anzeigenpreis I)
66Köhler/Piper, S. 226-228; BGH, GRUR 1986, 397, 399 (Abwehrblatt II)
67Baumbach/Hefermehl, S. 623
68Rittner, S. 48
69 Köhler, S. 201
70Rittner, S. 48
71BGH, GRUR 1973, 277 (Ersatzteile für Registrierkassen)
72Köhler/Piper, S. 201,202
73Köhler/Piper, S. 202
74BGH, GRUR 1984, 461, 462 (Kundenboykott)
75Köhler/Piper, S. 202,203
76BGH, GRUR 1980, 242, 244 (Denkzettelaktion)
77 Nordemann, S. 161
78Baumbach/Hefermehl, S. 633
79Baumbach/Hefermehl, S. 633
80Rittner, S. 49; BGH, GRUR 1958, 487 „Antibiotika“
81Ackermann, S. 157, 158
82 Baumbach/Hefermehl, S.638
83Ackermann, S. 159, 160
84Baumbach/Hefermehl, S. 639
85Ackermann, S. 160
86ganzer Absatz Rittner, S. 50
87 Ackermann, S. 162
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieser Arbeit über Wettbewerbsrecht?
Diese Arbeit soll dem Leser einen Eindruck vermitteln, was mit wettbewerbswidriger Behinderung im Sinne des § 1 UWG gemeint ist. Sie erläutert den Begriff der Sittenwidrigkeit im Wettbewerbsrecht und den Schutzzweck des UWG.
Was versteht man unter "Behinderung" im Wettbewerbsrecht?
Behinderungswettbewerb liegt vor, wenn ein Unternehmen sein Produkt nicht mehr durch Leistung (Preis, Qualität) fördert, sondern durch Verdrängung oder Beseitigung des Wettbewerbs. Dies widerspricht dem freien Leistungswettbewerb.
Welche Arten der Behinderung werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Formen der Behinderung, darunter Absatz- und Bezugsbehinderung, Werbebehinderung, Betriebsstörung, Preisunterbietung, Boykott und Diskriminierung, Geschäftsehrverletzung und Anschwärzung sowie vergleichende Werbung.
Was ist Absatzbehinderung?
Absatzbehinderung liegt vor, wenn Mitbewerber daran gehindert werden, ihre Leistungen dem Kunden zum Vergleich anzubieten. Beispiele sind das Abfangen von Kunden, unzulässige Gegenwerbung und der Aufkauf von Konkurrenzware.
Was ist Bezugsbehinderung?
Bezugsbehinderung tritt auf, wenn ein Unternehmen mehr Rohstoffe oder Waren bezieht, als es für eigene Zwecke benötigt, um den Bezug für Mitbewerber zu erschweren oder zu verteuern.
Wie wird Werbebehinderung definiert?
Werbebehinderung umfasst Handlungen, die die Werbung eines Mitbewerbers vereiteln, wie z.B. die Zerstörung von Werbeplakaten, die Verbreitung von Gutscheinen, die die Werbung des Mitbewerbers entwerten, oder das Entfernen von Kennzeichen, Marken oder einer besonderen Ausstattung der Ware.
Was versteht man unter Betriebsstörung?
Betriebsstörung kann durch verschiedene Handlungen verursacht werden, wie z.B. das Entfernen von Kontrollnummern oder -zeichen, die Störung des Arbeits- oder Betriebsfriedens (z.B. durch Anstiftung zur Illoyalität) oder die Sperre durch Zeichenerwerb (Markenanmeldung in wettbewerbswidriger Absicht).
Wann ist Preisunterbietung wettbewerbswidrig?
Preisunterbietung ist grundsätzlich erlaubt, aber sie kann wettbewerbswidrig sein, wenn sie auf Dauer angelegt ist, nicht kostendeckend ist und in Verdrängungsabsicht erfolgt.
Was sind Boykott und Diskriminierung im Wettbewerbsrecht?
Boykott ist die organisierte Absperrung eines Gegners vom Geschäftsverkehr. Diskriminierung ist die sachlich nicht gerechtfertigte unterschiedliche Behandlung von Personen im geschäftlichen Verkehr (z.B. durch Preisdiskriminierung, Ablehnung von Vertragsabschlüssen).
Was ist Geschäftsehrverletzung und Anschwärzung?
Geschäftsehrverletzung und Anschwärzung umfassen beleidigende, üble Nachrede oder verleumderische Aussagen über das Geschäft des Mitbewerbers, die den Wettbewerb fördern sollen. Wettbewerbswidrigkeit kann auch vorliegen, wenn die geschäftsschädigende Behauptung wahr ist.
Wie wird vergleichende Werbung behandelt?
Vergleichende Werbung ist grundsätzlich zulässig, aber an Bedingungen geknüpft. Sie darf nicht irreführend sein, muss objektiv und vergleichbar sein und darf Mitbewerber nicht herabsetzen.
Was ist die Zusammenfassung der Arbeit?
Die Arbeit fasst zusammen, dass wettbewerbswidrige Behinderung vorliegt, wenn ein Wettbewerber ohne eigene Leistung aus der unlauteren Behinderung des Mitbewerbers Vorteile ziehen will. Entscheidend ist immer der Maßstab der guten Sitten des § 1 UWG im Sinne des Leistungswettbewerbs.
- Quote paper
- Simone Klostermann (Author), 2000, Die wettbewerbswidrige Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98841