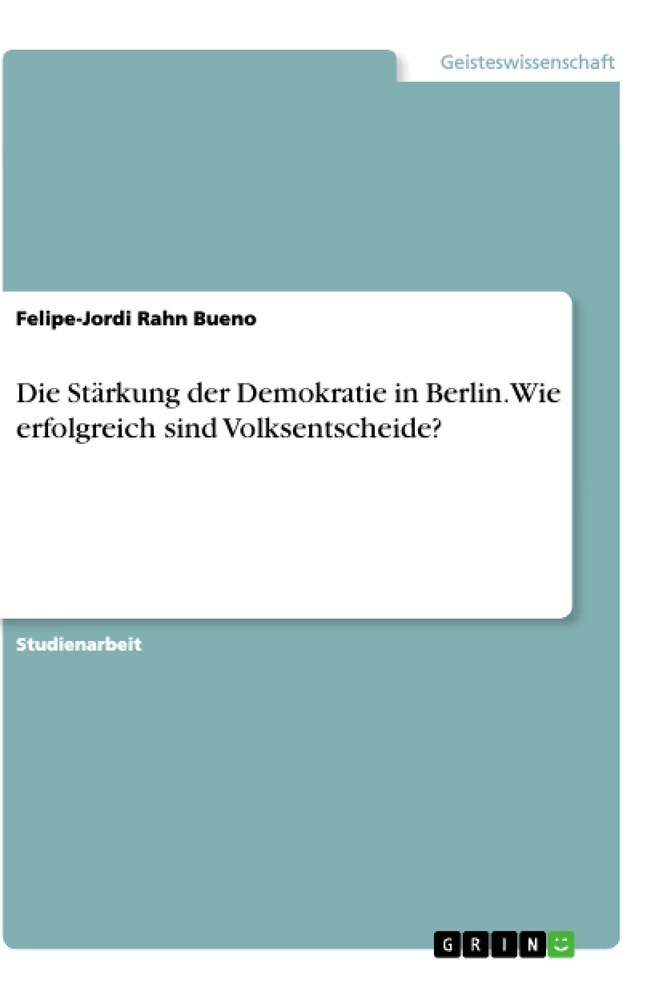Die Arbeit untersucht, ob Volksentscheide generell sinnvoll sind und wie ein Volksentscheid im Land Berlin zum Erfolg geführt werden kann, um die Demokratie zu stärken. Nicht zuletzt ist ein Volksentscheid auch immer mit viel Arbeits- und Kapitaleinsatz verbunden.
Die ersten beiden Kapitel dieser Arbeit setzen sich dafür mit den Vor- und Nachteilen von Volksentscheiden und direktdemokratischen Entscheidungsprozessen auseinander. Das darauffolgende Kapitel befasst sich mit Erfolgen von direktdemokratischen Entscheidungsprozessen. Im Anschluss beschäftigt sich diese Arbeit mit dem direktdemokratischen Entscheidungsprozess im Land Berlin, bevor die bisherigen Erfahrungen mit Volksentscheiden in Berlin zusammengefasst werden. Abschließend werden die Informationen der vorangegangenen Kapitel im Fazit miteinander verknüpft und die Forschungsfrage beantwortet.
In der noch jungen Geschichte der direkten Demokratie des Landes Berlin kam es seit 1996 zu sechs Volksentscheiden. Aus diesen sechs wurden lediglich drei angenommen und letztendlich nur zwei umgesetzt. Gerade im Rahmen der Diskussion um den Volksentscheid zur Offenlegung Tegels wurde die Sinnhaftigkeit von Volksentscheiden debattiert.
Nachdem der Berliner Senat 2018 ankündigte, den angenommenen Volksentscheid nicht umzusetzen, gab es großen Unmut über die Handlungsweise des Senats. 64 Prozent aller Berliner gaben an, nicht damit einverstanden zu sein. Diese Ablehnung zog sich durch Anhänger aller Parteien inklusive der Wähler der Grünen, die für die Schließung des Flughafens warben.
Inhalt
Einleitung
Was spricht für Volksentscheide?
Welche Gefahren und Nachteile bergen Volksentscheide?
Erfahrungen aus direktdemokratischen Entscheidungsprozessen
Wie funktioniert der direktdemokratische Gesetzgebungsprozess in Berlin?
Welche Erfahrungen wurden im Land Berlin mit Volksentscheiden erlangt?
Fazit
Quellen- und Literaturverzeichnis
Einleitung
In der noch jungen Geschichte der direkten Demokratie des Landes Berlin kam es seit 1996 zu sechs Volksentscheiden. Aus diesen sechs wurden lediglich drei angenommen und letztendlich nur zwei umgesetzt. Gerade im Rahmen der Diskussion um den Volksentscheid zur Offenlegung Tegels wurde die Sinnhaftigkeit von Volksentscheiden debattiert.
Nachdem der Berliner Senat 2018 angekündigte, den angenommenen Volksentscheid nicht umzusetzen, gab es großen Unmut über die Handlungsweise des Senats. 64 Prozent aller Berliner gaben an, nicht damit einverstanden zu sein (Schmidt 2018). Diese Ablehnung zog sich durch Anhänger aller Parteien inklusive der Wähler der Grünen, die für die Schließung des Flughafens warben (ebenda).
Der Anlass dieser Arbeit ist, zu untersuchen, ob Volksentscheide generell sinnvoll sind und wie ein Volksentscheid im Land Berlin zum Erfolg geführt werden kann, um die Demokratie zu stärken. Letztendlich ist ein Volksentscheid auch immer mit viel Arbeits- und Kapitaleinsatz verbunden.
Die ersten beiden Kapitel dieser Arbeit setzen sich dafür mit den Vor- und Nachteilen von Volksentscheiden und direktdemokratischen Entscheidungsprozessen auseinander. Das folgende Kapitel befasst sich mit Erfolgen von direktdemokratischen Entscheidungsprozessen. Im Anschluss beschäftigt sich diese Arbeit mit dem direktdemokratischen Entscheidungsprozess im Land Berlin, bevor die bisherigen Erfahrungen mit Volksentscheiden in Berlin zusammengefasst werden. Abschließend werden die Informationen der vorangegangenen Kapitel im Fazit miteinander verknüpft und die Forschungsfrage beantwortet.
Obwohl zum direktdemokratischen Entscheidungsprozess im Land Berlin auch das Volksbegehren zählt und diese Stufe auch Eingang in die Arbeit findet, würde es den Rahmen dieser Arbeit übersteigen im Detail auf diesen Abschnitt einzugehen. Deshalb fokussiert sich die Analyse auf die Volksentscheide, seine Umstände und Ergebnisse.
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit das generische Maskulinum verwendet. Es sind selbstverständlich sämtliche Geschlechter und Geschlechtsidentitäten relevant und gemeint.
Was spricht für Volksentscheide?
In einer Demokratie geht die Macht vom Volke aus. Es ist daher zwingend notwendig, dass die Bürger mit Volksentscheiden eine Kontroll- bzw. Vetoinstanz gegenüber den regierenden Personen haben (von Allemann 2011: 210). Damit diese Demokratie lebhaft bleibt, müssen die in ihr lebenden Bürger kritisch und entscheidungswillig sein (Kumpf 2011: 15f.). Dafür muss die Demokratie erlebbar sein und die Bürger müssen das Gefühl haben, mit ihren Entscheidungen auch Einfluss auf das politische Geschehen haben zu können (Kumpf 2011: 17; Kleer 2016: 31). Gross (2011: 128f.) verspricht sich von direkter Demokratie gar mehr Nähe zwischen dem wählenden Volk und den Angehörigen der politischen Klasse. Dies ist auch für von Allemann (2011: 202) schlüssig, da die Teilnehmer direktdemokratischer Verfahren eher das Gefühl hätten, mitbestimmen zu können und nicht einfach nur regiert zu werden. In der Konsequenz führt dies dann zu mehr Identifikation und Zufriedenheit mit dem Staat und die Repräsentation des Volkswillens wird gesteigert (Gross 2011: 128f.). Zusätzlich steigert sich das Vertrauen in Parteien und Politik (Merkel 2011: 11).
Gleichzeitig sind Entscheidungen aus Volksentscheiden meist mit einer höheren Legitimation assoziiert als Entscheidungen des Parlaments (Kumpf 2011: 18). Gerade unterhalb der Bundesebene gestalten sich Volksentscheide besonders gut, da die Bürger direkt informiert werden und die Entscheidungen somit auch direkt von den betroffenen Menschen getroffen werden können (von Allemann 2011: 211).
Dies ist auf Gemeindeebene besser umsetzbar als auf Landesebene (ebd.). Darüber hinaus können Entscheidungsblockaden überwunden und die -findung beschleunigt werden (Merkel 2011: 11). Gerade bei kontroversen politischen Entscheidungen können Volksentscheide nützlich sein, da das parlamentarische Wechselspiel entfällt und vorherige Kompromissfindungen nicht als Druckmittel genutzt werden können, um eine Entscheidung durchzusetzen (Vatter und Danaci 2010: 209).
Welche Gefahren und Nachteile bergen Volksentscheide?
Doch trotz ihrer belebenden Wirkung für die Demokratie, bergen Volksentscheide auch Risiken. Allen voran ist der fehlende Minderheitenschutz eine Gefahr (Vatter & Danaci 2010: 207f.), da der parlamentarische Entscheidungsprozess ausgeklammert wird, bei dem Minderheiten eine größere Beachtung finden (Vatter & Danaci 2010: 206) und Wähler bei Volksentscheiden am ehesten den Rational-Choice-Ansatz verfolgen (Vatter & Danaci 2010: 209). Darüber hinaus fällt der parlamentarische Entscheidungsdruck weg (ebd.). Thürer (2007: 21) folgend, kann die Stärkung der Volksrechte auch Rassismus und Fremdenhass fördern (Thürer 2007: 10).
Des Weiteren sind finanzielle Ressourcen ein wichtiger Faktor, um einen Volksentscheid zum Erfolg zu bringen. Wenn die Möglichkeit besteht kommerzielle Unterschriftensammler zu beschäftigen, so ist es quasi garantiert, dass es zum Volksentscheid kommt (Heusner 2009: 47). Hat jedoch die Gegenseite ebenfalls starke finanzielle Ressourcen, so ist es nahezu unmöglich den Volksentscheid zu gewinnen (ebd.).
Reiche Personen und Gruppen können ihre Ressourcen dazu nutzen, Fernsehspots und Werbekampagnen einzukaufen und damit das Meinungsbild zu verändern (Gross 2011: 219). Somit kann das Parlament durch Volksentscheide theoretisch an Macht verlieren oder gar komplett blockiert werden (ebd.).
Vor allem in der direkten Demokratie spielen Netzwerkeffekte eine große Rolle. Wenn Menschen besser vernetzt sind, so ist es leichter die nötige Finanzierung zu gewinnen und sein eigenes Anliegen voranzubringen (Kumpf 2011: 16f.; Merkel 2011: 12). Dies ist für Menschen mit Migrationshintergrund, sozial schwächere Menschen, sowie junge Menschen, eine zusätzliche Hürde auf dem Weg zum Erfolg im Volksentscheid beziehungsweise bei der Repräsentation in eben jenem (ebd.).
Geld ist außerdem in vielerlei Hinsicht relevant, da die Initiatoren von Volksentscheiden die Kosten selbst decken müssen und diese auch bei Erfolg nicht zurückerstattet bekommen (von Allemann 2011: 208), dies führt in der Folge dazu, dass tendenziell eher finanzstärkere Menschen einen Volksgesetzgebungsprozess beginnen.
Dies ist besonders ärgerlich, wenn juristisches Know-How fehlt. Volksentscheide im Land Berlin beziehen sich auf die Berliner Ebene und können nur Gesetze annehmen, die durch das Land umsetzbar wären. Allerdings könnten diese Gesetze internationales oder nationales Recht brechen, was ein Dilemma auftun würde: wenn der Gesetzgeber sich weigert, das Gesetz umzusetzen, geht das gegen den demokratischen Gedanken, aber sollte es in Kraft treten, können Klagen das Gesetz ungültig machen und es würden Zeit und Ressourcen verschwendet (Gross 2011: 130).
Des Weiteren können sehr aktive Interessensgruppen Ihren Willen gegen das Wohl der Mehrheit durchsetzen (Merkel 2011: 11).
Gegner von Volksentscheiden setzen den Befürwortern außerdem entgegen, dass das Volk bei Volksentscheiden nicht fair abgebildet wird. So nehmen bildungsferne und einkommensschwächere Schichten seltener an Volksentscheiden als an Wahlen teil (Merkel 2011: 11f.; Kleer 2016: 44). Die folgende Unterrepräsentation sorgt im schlechtesten Fall für Ergebnisse, die die soziale Kluft weiter auseinandertreiben (ebd.). Die Ergebnisse von Volksentscheiden bringen dazu meist fiskalkonservative Ergebnisse heraus und die Umverteilung wird erschwert (Merkel 2011: 12). Dies ist weitestgehend logisch, wenn die Hauptträger der Finanzierung sich eher an Volksentscheiden beteiligen (ebd.).
Dadurch, dass das Wahlvolk mehrheitlich nicht hauptberuflich politisch tätig ist, fehlt den Abstimmenden darüber hinaus politische Sachkompetenz und kompletter Zugang zu Information (Thürer 2007: 10). Die Information der Abstimmenden geschieht dann meist durch die Kampagnen, die allerdings nur Ihre jeweiligen Hauptargumente zur Sprache bringen und im Zweifelsfall einige Argumente unbeachtet bleiben (ebd.).
Letztlich leiden Volksentscheide jedoch oft unter Legitimationsproblemen, da die Beteiligung allgemein weit unter der von Wahlen liegt (Merkel 2011: 13).
Erfahrungen aus direktdemokratischen Entscheidungsprozessen
In der Realität zeigt sich das folgende Bild. Volksentscheide bremsen den Wandel aus, weil sie von Natur aus eine Veto- und Kontrollfunktion der herrschenden Personen ausüben (Kranenpohl 2006: 26). Dies erhöht im Gegenzug jedoch die Qualität der parlamentarischen Arbeit, weil die Entscheidungen einem Volksentscheid standhalten müssen (ebd.).
Ein Blick in die USA offenbart, dass auch dort Volksentscheide keine große Erfolgsgeschichte sind. Gerade einmal 41 Prozent aller Volksentscheide führen zum Erfolg (Heusner 2006: 42). Die Initiativen aus dem Volk bringen es immerhin auf 55 Prozent (ebd.). In Deutschland sind es im Zeitraum 1990-2005 immerhin sieben aus elf Volksentscheiden, die angenommen wurden (Eder 2010: 43). Sowohl in Deutschland als auch in den USA gibt es nicht die Möglichkeit sich die Kosten zurückerstatten zu lassen (Heusner 2006: 41). In beiden Staaten haben Gruppen oder Personen also sehr viel Geld ausgegeben, um ihr demokratisches Recht zu nutzen.
In den USA führt die Volksgesetzgebung unter anderem dazu, dass die Staaten, die sie nutzen, in Bildungsvergleichen schlechter abschneiden (Heusner 2006: 45). Dies hängt mit der fiskalkonservativen Einstellung des Volkes zu tun, welches sich selbst Spargrenzen auferlegt. Dies führt dazu, dass das Bildungssystem weniger Geld zur Verfügung hat (Heusner 2006: 45). In diesen Staaten sind jedoch eine höhere Debattierbereitschaft und Wahlbeteiligung sowie mehr zivilgesellschaftliches Engagement zu erkennen (Heusner 2006: 50). Ebenso zeigt sich in den USA die Bedeutung der ersten Kampagne, die oft mit großem Finanzaufwand zu einem großen Teil den Erfolg bestimmt (Heusner 2006: 48).
Volksentscheide in Deutschland zeigen bestimmte Erfolgsmuster auf. Eders (2010: 63) zeigt, dass Volksentscheide dann erfolgreich sind, wenn das Volk bereits Erfahrung mit Volksentscheiden hat und das Quorum hoch ist. Alternativ führt ein niedriges Quorum zum Erfolg, wenn die Opposition die Initiative unterstützt und Erfahrung mit Volksentscheiden vorliegt (Eder 2010: 64). In jedem Fall nimmt das Volk gern die Vetorolle ein und votiert tendenziell eher pro Initiative aus dem Volk, wenn die Regierung einen Gegenvorschlag zur Abstimmung stellt (Eder 2010: 63). Dies ist auch logisch, da die Regierung im Vorfeld die Chance hatte, ein eigenes Gesetz auf den Weg zu bringen, dass den Volkswillen ausreichend abbildet, jedoch auf diese Chance bis dahin verzichtet hat (Eder 2010: 55). Sie ist damit immer der Gegner der Volksentscheide.
Wird der Blick nun wieder auf die USA gerichtet, so wird erkennbar, dass unterprivilegierte Schichten tatsächlich seltener an Volksentscheiden teilnehmen (Heusner 2006: 42). Darüberhinaus verschieben sich die Ausgaben vom Staat eher auf die kommunale Ebene und es gibt weniger Steuern und damit verbundene Einnahmen, dafür allerdings mehr Gebühren (Heusner 2006: 44). Ein weiterer Kritikpunkt bestätigt sich in den USA ebenfalls. Volksentscheide, die sich gegen Minderheiten richten, haben mit 78 Prozent die höchste Erfolgsquote (Heusner 2006: 48). Wenn ein Volksentscheid jedoch aktiv die Rechte von Minderheiten gefährdet, so ist die Erfolgschance mit 27 Prozent die niedrigste (ebd.).
Wie funktioniert der direktdemokratische Gesetzgebungsprozess in Berlin?
Nachdem die Volksinitiative im geforderten Zeitraum genügend Unterschriften gesammelt hat, werden diese geprüft, sowie die Zulässigkeit eines Volksentscheides durch den Präsidenten des Abgeordnetenhauses evaluiert (§8 Abs. 1 Satz 1&2, Abs.2 Satz 1-3 AbstG). Es folgt das Volksbegehren. Dieses muss einen Gesetzesvorschlag, die Änderung oder Aufhebung eines Gesetzes zum Gegenstand haben oder einen konkreten Beschluss fordern (§11 Abs. 1 Satz 1 & 2 AbstG). Ist das anschließende Volksbegehren ebenfalls erfolgreich, muss innerhalb von vier Monaten ein Volksentscheid organisiert werden (§29 Abs.1 Satz 1 AbstG).
Dieser ist gelungen, wenn bei diesem Volksentscheid mindestens 50% der Abstimmenden und darüber hinaus mindestens 25% aller stimmberechtigten Berliner mit „Ja“ votieren (§36 Abs. 1 Satz 1 AbstG). Alle Personen, die am Tag des Volksentscheides auch für die Wahl des Abgeordnetenhauses stimmberechtigt wären, dürfen auch beim Volksentscheid Ihre Stimme abgeben (§33 Abs.1 Satz 1 AbstG). Um Transparenz und Unabhängigkeit zu wahren, müssen Geld- oder Sachspenden, die einen Wert von 5000 Euro überschreiten mit Namen und Adresse angezeigt werden (§40b Abs. 1 Satz 1 AbstG). Des Weiteren dürfen weder Fraktionen des Parlamentes noch andere politische Vertretungen oder öffentliche Unternehmen ab einer Beteiligung von 25% als Spender auftreten (§40c Abs. 1 Satz 1 AbstG).
Welche Erfahrungen wurden im Land Berlin mit Volksentscheiden erlangt?
Das Land Berlin lässt seit 1996 Volksgesetzgebung zu (Eder 2010: 44). Seitdem gab es sechs Volksentscheide, von denen drei vom wahlberechtigten Volk angenommen wurden, zwei unecht gescheitert sind und einer gar abgelehnt wurde. Von den drei angenommenen Volksentscheiden wurden jedoch nur zwei umgesetzt, da der Volksentscheid zur Offenhaltung Tegels – mangels eines konkreten Gesetzes zur Abstimmung und fehlender alleiniger Kompetenz des Berliner Senats - rechtlich nicht bindend war. Die sechs Volksentscheide eint jedoch alle die niedrige Abstimmungsbeteiligung (Landesabstimmungsleiter Berlin 2008; Landesabstimmungsleiter Berlin 2009; Landesabstimmungsleiterin Berlin 2011; Landesabstimmungsleiterin Berlin 2013; Landesabstimmungsleiterin Berlin 2014). Die höchsten Beteiligungen konnten der Volksentscheid zum Flughafen Tegel (Landesabstimmungsleiterin Berlin 2017) mit 71 % und der Volksentscheid zur Bebauung des Tempelhofer Feldes (Landesabstimmungsleiterin Berlin 2014) mit 46,1% aller Abstimmungsberechtigten erzielen. Es wird hier – mit Ausnahme des Tegel-Volksentscheids - eine klare Kluft zur Wahlbeteiligung bei Wahlen zum Abgeordnetenhaus sichtbar.
Es zeigt sich außerdem, dass es in den Abstimmungen fast immer ein Cluster gibt. Oft wird ein Ost-West-Gefälle bei der Abstimmung sichtbar. Dies war beispielsweise bei den Volksentscheiden zur Einführung des Wahlpflichtfachs Religion (Landesabstimmungsleiter 2009: 4) und zum Erhalt des Tempelhofer Flughafens als Verkehrsflughafen (Landesabstimmungsleiter 2008: 4) der Fall. Dies lässt sich relativ einfach mit der Handhabung von Religion im ehemaligen Ost- und West-Berlin, sowie der historischen Bedeutung des Flughafens Tempelhof während der sowjetischen Blockade West-Berlins von 1948 bis 1949 erklären. Doch die lokalen Unterschiede im Abstimmungsverhalten spielen auch in anderen Berliner Volksentscheiden eine Rolle. Die Beteiligung zum Volksentscheid zur Offenlegung der Berliner Wasserverträge war beispielsweise in den Bezirken mit den größten Wasseransammlungen in Berlin besonders groß (Landesabstimmungsleiterin 2011: 4). Die starke Beteiligung dieser Bezirke war in diesem Volksentscheid auch besonders kritisch, da eine sehr dominante Mehrheit von 98,2 Prozent berlinweit für die Offenlegung votierte, der Volksentscheid mit einer gesamten Beteiligung von 27 Prozent jedoch fast an der benötigten Teilnehmerzahl scheiterte (Landesabstimmungsleiterin 2011: 3).
Auch beim Volksentscheid zum Erhalt des Tempelhofer Feldes wird ein leichtes Ost-West-Gefälle erkennbar. Die östlicheren und nördlicheren Bezirke votierten tendenziell eher pro Bebauungspläne des Abgeordnetenhauses, während der Süden und allen voran der Südwesten sich eher für einen Erhalt des Tempelhofer Feldes als Naherholungsgebiet aussprach (Landesabstimmungsleiterin 2014: 7f.). Dies lässt sich darauf zurückführen, dass das Tempelhofer Feld aus dem Süden und Südwesten einfacher zu erreichen ist und die Bebauung des Feldes, den Wohnungsmarkt Berlins entspannt hätte, wodurch mehr zentraler Wohnraum geschaffen worden wäre, der vor allem Menschen nützlich gewesen wäre, die noch nicht im Zentrum wohnen.
Lediglich die Volksentscheide zur Rekommunalisierung der Energieversorgung sowie zur Offenlegung der Wasserverträge hatten ein überschwänglich positives Votum hervorrufen können. Diese Entscheidung betraf alle Berliner gleich. Erstaunlicherweise war hier jedoch die Beteiligung jeweils sehr niedrig.
Fazit
Grundsätzlich sind Volksentscheide auch in Berlin zu befürworten. Mit den Transparenzregelungen und dem Verbot der Finanzierung durch politische Parteien ist das Rahmenwerk für einen fairen Wettbewerb im Volksentscheid gelegt. Angesichts von nur zwei aus sechs umgesetzten Volksentscheiden, obwohl fünf eine Mehrheit errungen, gibt es noch Verbesserungsbedarf in der direkten Demokratie in Berlin.
Es sollte im Grunde einfach sein, das politische Reserverecht zu nutzen und Gesetze eigenständig auf den Weg zu bringen. Doch in Berlin haben Volksentscheide niedrige Beteiligungswerte und damit nicht nur ein Legitimationsproblem, sondern auch ein Umsetzungsproblem.
Damit dennoch Entscheidungen umgesetzt werden können, wurde ein System geschaffen, in welchem theoretisch lediglich 25 Prozent der Stimmberechtigten reichen würden, sofern es eine einstimmige Mehrheit gäbe. So könnten auch Volksentscheide, die nur lokale Relevanz in Berlin haben umgesetzt werden, wenn sich die nicht betroffenen Menschen der Abstimmung enthalten. Da die Ergebnisse dieser lokalen Volksentscheide jedoch von der Gesamtheit der Berliner finanziell getragen werden, ist es schwierig auch nicht betroffene Menschen von einer Enthaltung oder gar einem Ja-Votum zu überzeugen. Es ist daher wichtig, dass Volksentscheide für alle Berliner relevant sind. Alternativ könnte es helfen, die Möglichkeit von Volksentscheiden auf Bezirksebene zu prüfen, um den Menschen Demokratie erlebbar zu machen.
Es ist wichtig, dass Volksentscheide auch umgesetzt werden können. Träger müssen also vorher prüfen, ob sie einen konkreten Beschluss oder Gesetzesentwurf zur Abstimmung stellen und Berlin auch die Gesetzgebungskompetenz hat. Wenn Volksentscheide nicht umgesetzt werden, schwindet damit auch der Glaube daran, durch diese etwas verändern zu können.
Gleichzeitig gilt es, die finanziellen Hürden eines Volksentscheides herunterzuschrauben, sodass nicht nur die Interessen von finanziell besser gestellten Menschen angehört werden. Hier könnte eine Teilfinanzierung durch das Land Berlin helfen, nachdem die Volksinitiative erfolgreich war. Zusätzlich sollten Kosten steuerlich absetzbar sein. Dieser Schritt würde den Gestaltungswillen und Demokratiegeist fördern. Wenn Eders Argumentation berücksichtigt wird, so scheint Erfahrung mit Volksentscheiden der gemeinsame Faktor zu sein, der Volksentscheide zum Erfolg führt. Es fehlt anscheinend an der Praxis, die erfolgreiche Volksentscheide ermöglicht. Schließlich ist das Instrument noch nicht sehr lange verfügbar und wurde wenig genutzt. Ein Bereich, der für das Wohl der Gesellschaft hingegen besser unberührt bleiben sollte, wäre mit Blick auf die USA die Finanzierung des Bildungssystems.
Da gerade unterprivilegierte Schichten seltener an Volksentscheiden teilnehmen, gilt es diese zu mobilisieren. Dafür müssen natürlich nicht nur die Themen eines Volksentscheides ansprechend für sozial schlechter gestellte Menschen sein, sondern auch die Informationen und Vorteile klar kommuniziert werden. Die Kosten für die Information dieser Menschen mag eventuell höher liegen, jedoch verschafft sich der Träger des Volksentscheids damit auch eine höhere Beteiligung. Da die Beteiligung an Volksentscheiden in der Vergangenheit oft der Grund des Scheiterns war, würden die Träger mit guten Informationskampagnen und gesamtgesellschaftlich relevanten Themen Volksentscheide erfolgreich gestalten. Damit würde auch die Demokratie und ihre Instrumente gestärkt werden.
Quellen- und Literaturverzeichnis
Beck, K. (2011). Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung – Neue Chancen für die Demokratie. In K. Beck & J. Ziekow (Hrsg.), Mehr Bürgerbeteiligung wagen (S. 21–30). Wiesbaden, Deutschland: VS Verlag für Sozialwissenschaften GmbH.
Der Landesabstimmungsleiter Berlin. (2008). Volksentscheid „Tempelhof bleibt Verkehrsflughafen!“ am 27. April 2008. Berlin, Deutschland: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.
Der Landesabstimmungsleiter Berlin. (2009). Volksentscheid über die Einführung des Wahlpflichtbereichs Ethik/Religion am 26. April 2009. Berlin, Deutschland: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.
Die Landesabstimmungsleiterin Berlin. (2011). Volksentscheid über die Offenlegung der Teilprivatisierungsverträge bei den Berliner Wasserbetrieben am 13. Februar 2011. Berlin, Deutschland: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.
Die Landesabstimmungsleiterin Berlin. (2013). Volksentscheid über die Rekommunalisierung der Berliner Energieversorgung am 3. November 2013. Berlin, Deutschland: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.
Die Landesabstimmungsleiterin Berlin. (2014). Volksentscheid über den Erhalt des Tempelhofer Feldes am 25. Mai 2014. Berlin, Deutschland: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.
Die Landesabstimmungsleiterin Berlin. (2017). Volksentscheid über den Weiterbetrieb des Flughafens Berlin-Tegel „Otto-Lilienthal“ (TXL) am 24. September 2017. Berlin, Deutschland: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.
Eder, C. (2010). Ein Schlüssel zum Erfolg? Gibt es ein Patentrezept für Volksentscheide in den deutschen Bundesländern? Politische Vierteljahresschrift, Vol. 51 (1), 43–67. https://doi.org/10.1007/s11615-010-0003-2
Gross, A. (2011). Die doppelte Krise der europäischen Demokratien und die Bedeutung der Direkten Demokratie zu deren Überwindung. In K. Beck & J. Ziekow (Hrsg.), Mehr Bürgerbeteiligung wagen (S. 127–134). Wiesbaden, Deutschland: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Heusner, H. K. (2006). Aktive Bürgergesellschaft durch bundesweite Volksentscheide? Erfahrungen aus dem Ausland: Das Beispiel USA. In G. Hirscher & R. Huber (Hrsg.), Aktive Bürgergesellschaft durch bundesweite Volksentscheide? (S. 37–60). München, Deutschland: Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
Kleer, B. P. (2016). Mehr Inklusion durch Volksentscheide?: Ein Vergleich direkter und indirekter Mitbestimmungsformen. Marburg, Deutschland: Tectum Verlag.
Kranenpohl, U. (2006). Aktivierung der Bürgergesellschaft durch bundesweite Volksentscheide? In G. Hirscher & R. Huber (Hrsg.), Aktive Bürgergesellschaft durch bundesweite Volksentscheide? (S. 25–36). München, Deutschland: Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
Kumpf, U. (2011). Mehr direkte Demokratie wagen! In K. Beck & J. Ziekow (Hrsg.), Mehr Bürgerbeteiligung wagen (S. 15–19). Wiesbaden, Deutschland: VS Verlag fur Sozialwissenschaften GmbH.
Merkel, W. (2011). Entmachten Volksentscheide das Volk? Anmerkungen zu einem demokratischen Paradoxon. WZB-Mitteilungen, (131), 10–13. Abgerufen von https://www.wzb.eu/system/files/docs/sv/iuk/10-13.pdf
Schmidt, F. (2018, November 9). Unmut über die Schließung von Flughafen Tegel wächst. Abgerufen 12. März 2020, von https://www.morgenpost.de/berlin/article215751745/Unmut-ueber-die-Schliessung-von-Flughafen-Tegel-waechst.html
Thürer, D. (2007). Direkte Demokratie in Deutschland. In Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier (Hrsg.), Rechtspolitisches Forum (Bd. 40, S. 1–23). Trier, Deutschland: Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier.
Vatter, A. & Danaci, D. (2010). Mehrheitstyrannei durch Volksentscheide? Zum Spannungsverhältnis zwischen direkter Demokratie und Minderheitenschutz. Politische Vierteljahresschrift, Vol. 51 (2), 205–222. https://doi.org/10.1007/s11615-010-0019-7 von Alemann, U. (2011). 40 Jahre Bürgerbeteiligung – Demokratie als Wagnis. In K. Beck & J. Ziekow (Hrsg.), Mehr Bürgerbeteiligung wagen (S. 201–212). Wiesbaden, Deutschland: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen dieses Dokuments über Volksentscheide?
Dieses Dokument behandelt die Vor- und Nachteile von Volksentscheiden, Erfahrungen aus direktdemokratischen Entscheidungsprozessen, die Funktionsweise des direktdemokratischen Gesetzgebungsprozesses in Berlin und die bisherigen Erfahrungen mit Volksentscheiden in Berlin. Es untersucht die Sinnhaftigkeit von Volksentscheiden und wie ein Volksentscheid im Land Berlin zum Erfolg geführt werden kann.
Welche Argumente sprechen für Volksentscheide?
Volksentscheide stärken die Demokratie, geben Bürgern eine Kontrollinstanz, erhöhen die Legitimation von Entscheidungen, beschleunigen die Entscheidungsfindung, fördern die Nähe zwischen Volk und Politikern, steigern das Vertrauen in Parteien und Politik und ermöglichen eine direktere Mitbestimmung.
Welche Gefahren und Nachteile bergen Volksentscheide?
Zu den Risiken gehören der fehlende Minderheitenschutz, der Einfluss finanzieller Ressourcen, die Möglichkeit, dass Interessensgruppen ihren Willen gegen das Wohl der Mehrheit durchsetzen, die Unterrepräsentation bildungsferner und einkommensschwacher Schichten, fehlende politische Sachkompetenz und Legitimitätsprobleme aufgrund geringer Beteiligung.
Was zeigen Erfahrungen aus direktdemokratischen Entscheidungsprozessen?
Volksentscheide können den Wandel ausbremsen, aber auch die Qualität der parlamentarischen Arbeit erhöhen. In den USA führen sie teilweise zu schlechteren Ergebnissen im Bildungsbereich. Erfolgsmuster zeigen, dass Volksentscheide dann erfolgreich sind, wenn das Volk bereits Erfahrung damit hat und die Opposition die Initiative unterstützt.
Wie funktioniert der direktdemokratische Gesetzgebungsprozess in Berlin?
Der Prozess umfasst die Volksinitiative, das Volksbegehren und den Volksentscheid. Nach erfolgreicher Sammlung von Unterschriften und Zulässigkeitsprüfung wird ein Volksentscheid organisiert. Dieser ist erfolgreich, wenn mindestens 50% der Abstimmenden und mindestens 25% aller Stimmberechtigten mit "Ja" votieren.
Welche Erfahrungen wurden im Land Berlin mit Volksentscheiden erlangt?
Seit 1996 gab es sechs Volksentscheide, von denen drei angenommen und nur zwei umgesetzt wurden. Alle Volksentscheide eint die niedrige Abstimmungsbeteiligung. Es gibt oft ein Ost-West-Gefälle bei der Abstimmung und lokale Unterschiede im Abstimmungsverhalten.
Was ist das Fazit des Dokuments?
Volksentscheide sind grundsätzlich auch in Berlin zu befürworten, aber es gibt Verbesserungsbedarf. Es gilt, die finanziellen Hürden herunterzuschrauben, unterprivilegierte Schichten zu mobilisieren und sicherzustellen, dass Volksentscheide auch umgesetzt werden können.
- Quote paper
- Felipe-Jordi Rahn Bueno (Author), 2020, Die Stärkung der Demokratie in Berlin. Wie erfolgreich sind Volksentscheide?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/988791