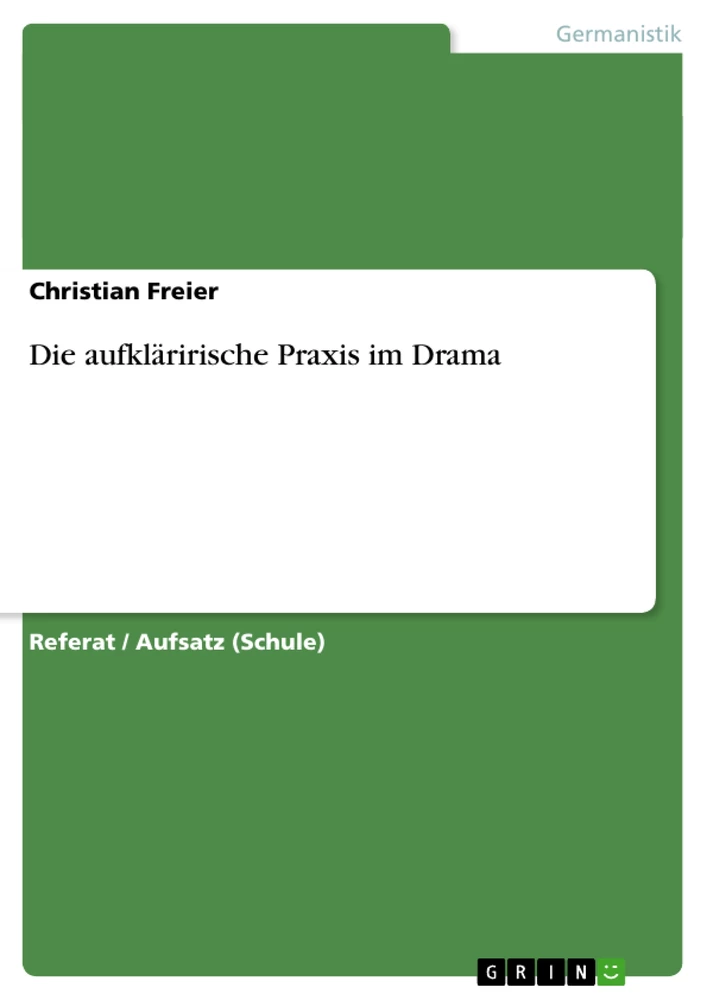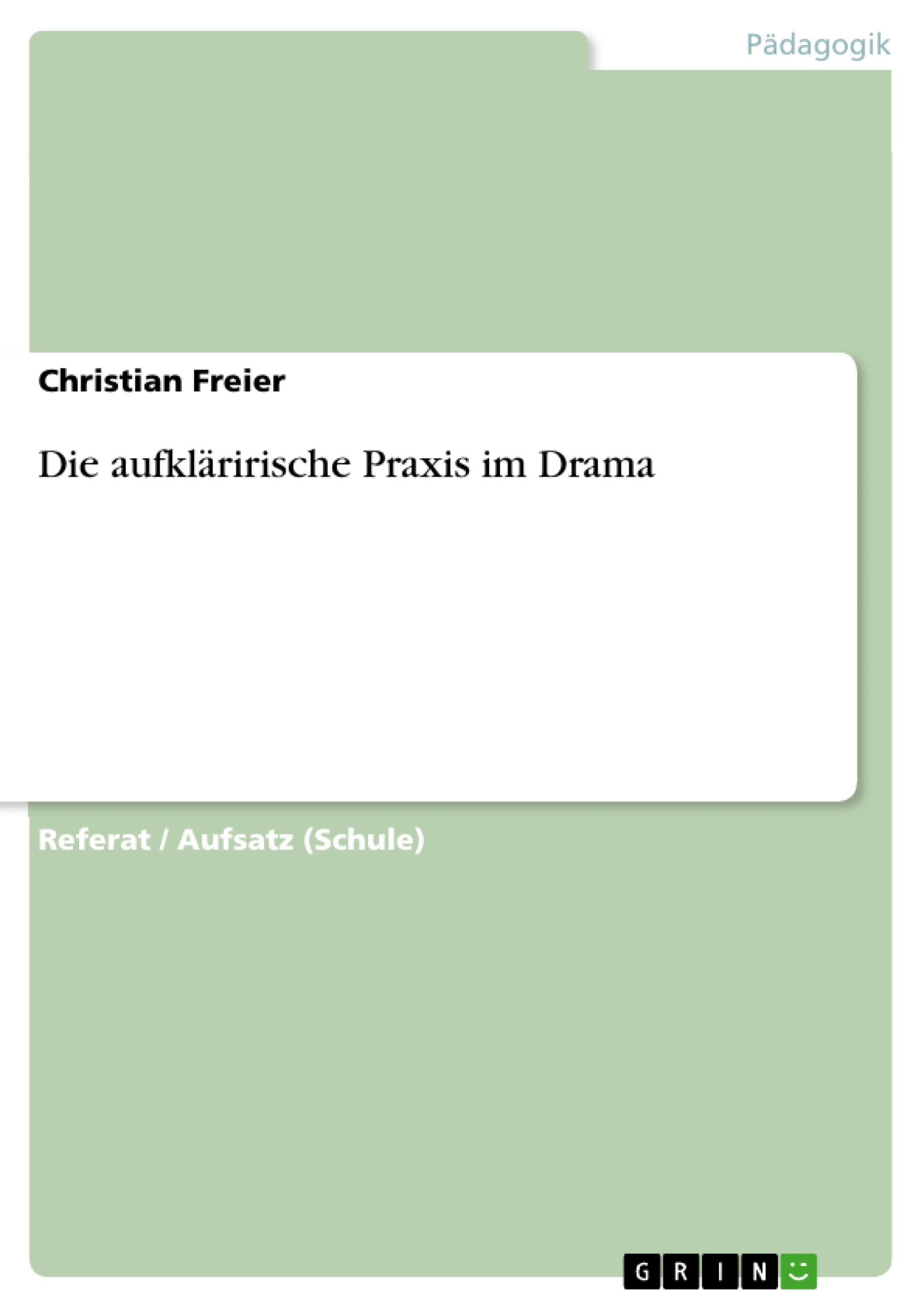Was bedeutet Aufklärung wirklich, wenn sie auf der Bühne inszeniert wird? Diese fesselnde Analyse des aufklärerischen Dramas, insbesondere bei Lessing und seinen Zeitgenossen, enthüllt, wie bürgerliche Ideale mit den Zwängen einer feudalen Gesellschaft kollidierten. Entdecken Sie, wie das Theater im 18. Jahrhundert zum Schauplatz moralischer und gesellschaftlicher Kämpfe wurde, in denen Tugend, Freiheit und Selbstbestimmung auf dem Spiel standen. Christian Freier beleuchtet die zentralen Themen und Konflikte, die das bürgerliche Trauerspiel prägten, von der Instrumentalisierung weiblicher Tugend bis zur Zerrissenheit der Familie. Erfahren Sie, wie Lessings Emilia Galotti, Minna von Barnhelm und Nathan der Weise, sowie Schillers Kabale und Liebe, die Konventionen des klassischen Dramas herausforderten und neue Wege der gesellschaftlichen Kritik eröffneten. Die aufklärerische Praxis im Drama ist eine tiefgreifende Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Literatur, Theater und sozialem Wandel im Zeitalter der Aufklärung. Untersuchen Sie, wie die Dramen von Lessing und Schiller die Spannungen zwischen Adel und Bürgertum, Vernunft und Gefühl, öffentlicher und privater Sphäre verhandelten. Die Analyse zeigt, wie die Bühne zum Spiegelbild einer Gesellschaft im Umbruch wurde, in der traditionelle Machtstrukturen in Frage gestellt und neue Werte verhandelt wurden. Das Buch untersucht die Rolle der Frau im bürgerlichen Drama und zeigt, wie Heldinnen wie Emilia Galotti und Luise Miller zu Symbolfiguren des Kampfes gegen feudale Willkür und moralische Korruption wurden. Dabei wird deutlich, dass die Tragödien des 18. Jahrhunderts nicht nur literarische Werke waren, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Debatte über die Gestaltung einer gerechteren und freieren Gesellschaft. Dieses Werk ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Literaturgeschichte, Theaterwissenschaft und die Epoche der Aufklärung interessieren. Es bietet neue Einblicke in die Bedeutung des Dramas als Instrument der Aufklärung und zeigt, wie die Konflikte und Themen dieser Zeit bis heute relevant sind. Ein Muss für jeden, der die Wurzeln unserer modernen Gesellschaft verstehen möchte. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Intrigen, Leidenschaft und moralischer Dilemmata, und entdecken Sie die revolutionäre Kraft des aufklärerischen Dramas.
Christian Freier
Die aufklärirische Praxis im Drama
Im aufklärerischen Selbstverständnis nahm das Drama eine bevorzugte Stellung ein. Ihm wurde stärker als den anderen literarischen Gattungen eine erzieherische, gesellschaftsverändernde Kraft zugemessen. Das Theater wurde in nur wenigen Jahren zum wichtigsten Erziehungs- und Bildungsinstitut. Weder vorher noch nachher hat das Theater jemals wieder eine solche Hochschätzung und eine solche Blütezeit erfahren wie im 18. Jahrhundert. Gottsched bezog sich auf die Wanderbühnen, die so genannten Pöbeltheater. Daneben gab es noch das angesehene und privilegierte Hoftheater, das der Unterhaltung der aristokratischen Hofgesellschaft dienste und von fest engagierten französischen und italienischen Schauspieltruppen getragen wurde. Beide Theaterformen, - das sogenannte Pöbeltheater ebensowenig wie das feudale Hoftheater - waren mit dem aufklärerischen Literaturprogramm nicht zu vereinbaren. Maßstab für Gottscheds Reformbemühungen war das klassizistische französische Drama, das er mit eigenen ,,regelmäßigen" Schauspielen, d.h. Schauspielen, die den Regeln entsprachen (gebundene Rede, feste Aktzahl, Einhaltung der drei Einheiten von Ort, Zeit und Raum, Ständelklausel, etc.) umzusetzen suchte.
Gegen die starre Regeldogmatik Gottscheds und seiner einer Freunde regte sich daher schon bald Widerspruch. Lessing ging so weit, Gottsched alle Verdienste an der Schaffung eines deutschen Theaters abzusprechen und beklagte die vorgefundene Theatersituation in den sechziger Jahren mit den nicht ganz zutreffenden Worten: ,,wir haben kein Theater. Wir haben keine Schauspieler. Wir haben keine Zuhörer". Lessing vertrat ein konsequent antifeudales Literaturprogramm. Er hatte sich vorgenommen, ein Nationaltheater zu schaffen, d.h. ein Theater für die ganze Nation, nicht für eine privilegierte Minderheit. Dieses Theater sollte frei von hemmendem ausländischen Einfluß sein und die aktuellen Probleme der Nation selbst thematisieren. Nur ein bürgerliches Theater konnte nach Lessing diese Forderungen erfüllen. Wenn es auch nicht gelang, die Nationaltheater- Problematik organisatorisch zu verwirklichen, so konnte Lessing doch der Entwicklung des bürgerlichen Dramas durch sein eigenes Dramenschaffen Auftrieb geben. Mit Emilia Galotti, Minna von Barnhelm und Nathan der Weise sind ihm Theaterstücke gelungen, die richtungsweisend für das bürgerliche Drama im 18. Jahrhundert wurden. Trotz vieler Unterschiede lassen sich bestimmte Gemeinsamkeiten zwischen all diesen Dramen feststellen. Diese liegen in erster Linie in der ,,Bürgerlichkeit" der Stücke. Bürgerlich waren diese Dramen nicht im heutigem Sprachgebrauch. Sie war damals noch ein Begriff zur Klassenbezeichnung. In der kontrastierenden Gegenüberstellung von bürgerlich - privat und höfisch - öffentlich lag nichtsdestoweniger ein starkes gesellschaftskritisches Element. Bürgerlich waren diese Dramen also deshalb, weil in Ihnen Tugenden wie Humanität, Toleranz, Sittlichkeit, Mitleidsfähigkeit, Gerechtigkeit und Gefühlsreichtum dargestellt wurden. So stammt Lessings Emilia Galotti aus dem niederen Adel, verkörpert aber durch ihre Moralität das bürgerliche Tugendideal, das sich durch den Immoralismus des Hofes nicht korrumpieren läßt. In Kabale und Liebe wird ein ähnliches Thema behandelt wie in Emilia Galotti. In den beiden Dramen von Lessing und in de von Schiller geht es um das Motiv der ,,verführten Unschuld", in allen drei Dramen stehen Frauen im Mittelpunkt der Auseinandersetzung zwischen Adel und Bürgertum, alle drei Dramen enden mit dem Tod der Heldin.
Der Konflikt in der Emilia Galotti ist noch zugespitzter. Dort versucht der Prinz von Guastalla, ein typischer Vertreter schrankenloser Tyrannenwillk ü r und erotischer Libertinage, die tugendhafte Emilia in seine Gewalt zu bringen und schreckt dabei auch vor dem Mord an Emilias Br ä utigam nicht zur ü ck. Emilia ihrerseits ist nicht unempf ä nglich f ü r die erotischen Lockungen, die von dem Prinzen, ganz im Gegensatz zu dem ,,guten Appiani" ausgehen. ,,Verf ü hrung ist die wahre Gewalt! - Ich habe Blut, mein Vater, so jugendliches, so warmes Blut als eine. Auch meine Sinne sind Sinne. Ich stehe f ü r nichts" mit diesen Worten , die den Zeitgenossen ü brigens h ö chst anst öß ig vorkamen, fordert Emilia vom Vater den Dolch, um sich zu t ö ten. . Doch ist es schlie ß lich der Vater, der ihre den Tod gibt, weil er nicht zulassen kann, da ß die Tochter zur Selbstm ö rderin wird. In dem Vater Odoardo und dem Prinzen von Guastalla treten feudaler F ü rst und Privatmann schroff und unvers ö hnlich gegeneinander. Odoardo verachtet das Hofleben und lebt in seiner selbstgew ä hlten Einsamkeit auf dem Lande in rousseauistischer Abgeschiedenheit, fernab von den Verlockungen des Hofes. In der Tugend der Tochter sieht er den Garanten der eigenen moralischen Ü berlegenheit ü ber den Feudalherren, der er verachtet.
Die Töchter sind ,,Eigentum", ,,Vermögen" und ,,Ware" des Vaters, die Tugend ist nicht nur ein ideelles, sondern auch ein materielles Gut. Die Tugend der Töchter ist die Macht der Väter. Als ,,Ware" wird die Tochter zum Objekt des Austauschs zwischen Männern und zum Objekt der Auseinandersetzung zwischen Adel und Bürgertum. Die Töchter sind Opfer in doppelten Sinne: Sie bringen sich nicht einmal um, wie dies die Männer tun, sie werden umgebracht. Und sie sterben lange vor ihrem Bühnentod am Ende der Dramen als Opfer einer fetischisierten Tugendvorstellung, als die sie im Namen der bürgerlichen Moral stilisiert werden. Als entsinnlichte, reine Wesen, kurz als Engel im wahren Sinne des Wortes, sind sie nicht lebensfähig, sondern dem Tod geweiht.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Die aufklärirische Praxis im Drama"?
Der Text analysiert die Rolle des Dramas in der Aufklärung und dessen Funktion als Instrument zur Erziehung und gesellschaftlichen Veränderung. Es werden die Reformbemühungen Gottscheds und die Kritik Lessings an dessen Regeldogmatik beleuchtet. Lessings Ziel war die Schaffung eines Nationaltheaters, das die Probleme der Nation thematisiert und frei von ausländischem Einfluss ist. Das bürgerliche Drama, repräsentiert durch Lessings Werke wie Emilia Galotti, Minna von Barnhelm und Nathan der Weise, steht dabei im Fokus. Die Dramen werden hinsichtlich ihrer "Bürgerlichkeit" untersucht, wobei Tugenden wie Humanität, Toleranz, Sittlichkeit, Mitleidsfähigkeit, Gerechtigkeit und Gefühlsreichtum thematisiert werden.
Welche Rolle spielt Gottsched in der Entwicklung des Dramas in der Aufklärung?
Gottsched wird als eine zentrale Figur der Theaterreform dargestellt, der versuchte, das klassizistische französische Drama in Deutschland zu etablieren. Seine Reformbemühungen basierten auf strengen Regeln (gebundene Rede, feste Aktzahl, Einhaltung der drei Einheiten, Ständelklausel etc.). Allerdings stieß seine starre Regeldogmatik auf Kritik, insbesondere von Lessing.
Wie unterschied sich Lessings Ansatz von dem Gottscheds?
Lessing kritisierte Gottscheds Regeldogmatik und strebte ein Nationaltheater an, das die Interessen und Probleme des Bürgertums widerspiegelte. Er wollte ein Theater schaffen, das frei von ausländischem Einfluss ist und die aktuellen gesellschaftlichen Probleme thematisiert. Seine Dramen, wie Emilia Galotti, Minna von Barnhelm und Nathan der Weise, gelten als richtungsweisend für das bürgerliche Drama im 18. Jahrhundert.
Was bedeutet "bürgerlich" im Kontext der Dramen des 18. Jahrhunderts?
Im Kontext der Dramen des 18. Jahrhunderts bezieht sich "bürgerlich" nicht auf den heutigen Sprachgebrauch. Es ist eine Klassenbezeichnung und steht in kontrastierender Gegenüberstellung zu "höfisch". Bürgerliche Dramen thematisieren Tugenden wie Humanität, Toleranz, Sittlichkeit, Mitleidsfähigkeit, Gerechtigkeit und Gefühlsreichtum.
Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den Dramen Emilia Galotti und Kabale und Liebe?
Beide Dramen behandeln das Motiv der "verführten Unschuld". Frauen stehen im Mittelpunkt der Auseinandersetzung zwischen Adel und Bürgertum, und beide Dramen enden mit dem Tod der Heldin.
Welche Rolle spielen Frauen in den bürgerlichen Dramen der Zeit?
Frauen werden oft als Opfer dargestellt. Sie sind "Eigentum", "Vermögen" und "Ware" des Vaters. Ihre Tugend ist nicht nur ein ideelles, sondern auch ein materielles Gut. Sie werden im Namen der bürgerlichen Moral stilisiert und sterben oft, weil sie an den Verhältnissen scheitern.
Wie wird die Familie in den bürgerlichen Dramen dargestellt?
Die bürgerliche Kleinfamilie wird als private Sphäre gegen die öffentliche Sphäre des Hofes gesetzt. Sie dient als Schutzraum gegen feudale Willkür und als Enklave des Gefühls gegen die zunehmende Rationalität in Wirtschaft und Gesellschaft. Oft ist die Familie unvollständig oder das Verhältnis zwischen den Familienmitgliedern gestört.
Wie werden Männer und Frauen in den Dramen der Aufklärung dargestellt?
Tugendhaftigkeit, Treue, Hingabe und Emotionalität werden zu weiblichen Eigenschaften erklärt. Männer werden dagegen als stark, tapfer und handelnd geschildert. Eine Umkehrung der Rollen von Mann und Frau war nur der damaligen Komödie möglich.
Warum scheitern die bürgerlichen Helden und Heldinnen in den Tragödien?
Die bürgerlichen Helden und Heldinnen scheitern an den Verhältnissen und können ihre Identität nur in der Selbstvernichtung bewahren. Die objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse ließen eine positive Lösung des Konfliktes zwischen bürgerlichem Emanzipationswillen und feudaler Macht nicht einmal auf der Ebene des Dramas zu.
- Quote paper
- Christian Freier (Author), 1999, Die aufklärirische Praxis im Drama, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98918