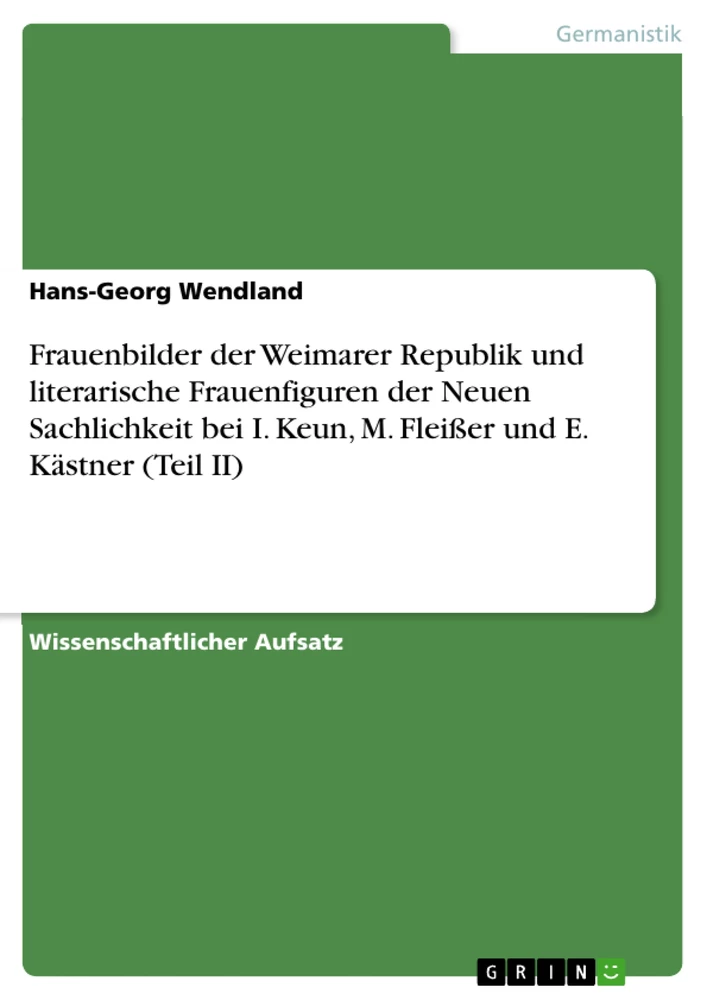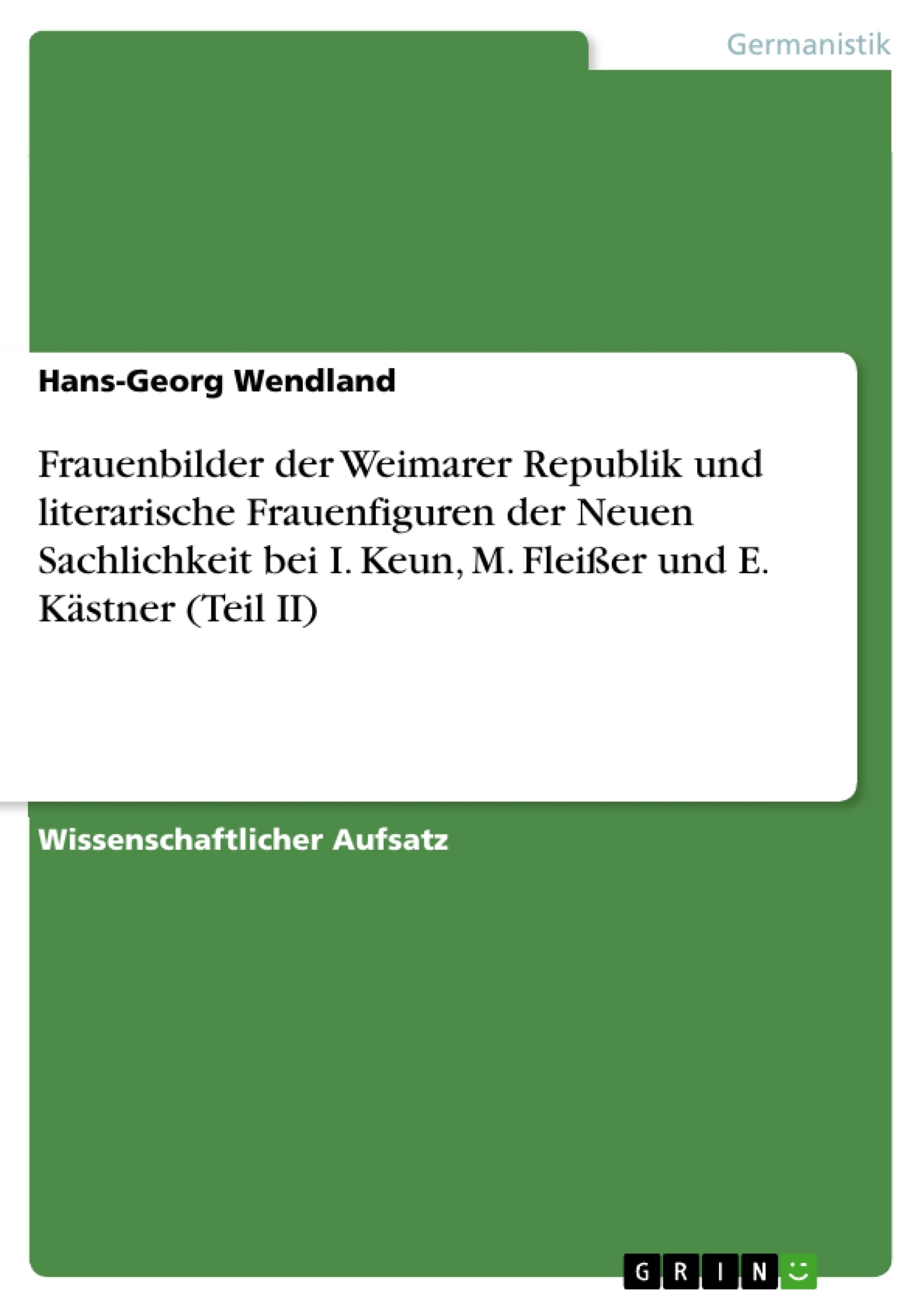Mit dieser Arbeit werden wichtige, bereits in Teil I aufgeworfene und diskutierte Fragen aufgenommen und weitergeführt. Es geht vor allem darum zu untersuchen, ob und inwieweit es den Protagonistinnen der drei behandelten Romane gelingt, auf dem von ihnen selbst gewählten Weg erfolgreich zu sein, obwohl sie ganz unterschiedliche Ausprägungen eines Frauenbildes verkörpern, das in der Weimarer Republik unter dem Schlagwort „Neue Frau“ in aller Munde war. Dies geschieht auf der Grundlage und unter besonderer Berücksichtigung einer nach dem Ersten Weltkrieg einsetzenden Strömung, die als „Neue Sachlichkeit“ Eingang in den literarischen Diskurs gefunden hat. Dieser literarischen Strömung wird bei der Behandlung des Themas ein wichtiger Stellenwert eingeräumt. Sie wird daher im nächsten Abschnitt ausführlich behandelt werden. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, ob diese neue Strömung – wie es einige Vertreter der nach dem Ersten Weltkrieg entwickelten Verhaltenslehren postulierten – ausschließlich männlich, d. h. als Gegenpol zu einem mütterlich-fürsorglich grundierten Frauenbild, orientiert war. Bereits in der Einleitung zu Teil I dieser Untersuchung hat sich gezeigt, dass es in der Literatur der Neuen Sachlichkeit Frauenfiguren gab, die sich durch ihr wachsames, kühl-berechnendes, zielstrebiges und diszipliniertes Verhalten in einer von Männern dominierten Welt durchsetzen und behaupten konnten. Umgekehrt wäre zu untersuchen, ob es bei den männlichen Figuren – zum Beispiel in Erich Kästners „Fabian“ - nicht auch Züge eines neusachlichen Anti-Helden gibt, der von Walter Benjamin als linker Melancholiker und Helmut Lethen als kontaktarmer, weltfremder, intellektueller Außenseiter beschrieben wurde und im Wettbewerb der Geschlechter eine Verliererrolle als enttäuschter, sentimentaler Liebhaber zugewiesen bekommt. Außerdem stellt sich die Frage, ob in der Literatur der Weimarer Zeit der Typus einer modernen starken Frau in den Romanen männlicher Autoren – hier also: Erich Kästner – stärker repräsentiert wird als bei Autorinnen wie Marieluise Fleißer und Irmgard Keun. Die Neue Sachlichkeit wird oft als eine unpolitische, ideologiefreie, alle Bereiche der Kultur, und insbesondere der Literatur, umfassende Strömung in der Zeit der Weimarer Republik (1918-1933) aufgefasst. Sie entsteht u. a. als Reaktion auf das gefühlsbetonte und übertriebene Pathos der Expressionisten und tritt für eine nüchterne, objektive Haltung gegenüber der Wirklichkeit ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Neue Sachlichkeit
- Die Verhaltenslehren der Kälte: ihr Einfluss auf die Literatur der Neuen Sachlichkeit und die Gestaltung der Frauenfiguren
- Irmgard Keuns Roman „Das kunstseidene Mädchen“
- „Träumen vom Glanz“ und „Schreiben wie Film“
- Das „System des Männerfangs“: Doris als „kalte persona“
- Liebe als Tauschgeschäft oder „der Warencharakter der Liebe“
- Die Kunst zu lügen und die Frage der Moral
- „Liebe ist kein Geschäft.“ „Ich liebe ihn. Nicht so - aber so.“
- Marieluise Fleißers Roman „Eine Zierde für den Verein“
- Das Bild der „Neuen Frau“ und sein männliches Gegenbild
- Frieda Geier als Paradigma der „Neuen Frau“ und kühles weibliches Pendant zu den männlichen Verhaltenslehren der Kälte
- Frieda Geier als Berufstätige...
- Frieda und die Ehe
- Frieda und Linchen
- Erich Kästners Roman „Fabian“
- Fabian: die sentimental-melancholische und passive männliche Kontrastfigur..
- Film und Reklame: Welt des schönen Scheins..
- Frauenbilder und das Thema der Liebe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die in Teil I bereits diskutierten Fragen im Kontext der Frauenbilder der Weimarer Republik und der literarischen Frauenfiguren der Neuen Sachlichkeit weiter zu vertiefen. Im Zentrum steht dabei die Frage, inwieweit die Protagonistinnen der drei behandelten Romane, trotz unterschiedlicher Ausprägungen des Frauenbildes der „Neuen Frau“, auf ihrem selbstgewählten Weg erfolgreich sein können. Die Untersuchung erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der literarischen Strömung der Neuen Sachlichkeit, die nach dem Ersten Weltkrieg in den literarischen Diskurs Einzug gehalten hat. In diesem Zusammenhang wird untersucht, ob die Neue Sachlichkeit – im Sinne der damaligen Verhaltenslehren - ausschließlich männlich orientiert war und als Gegenpol zu einem traditionell weiblichen Frauenbild fungierte.
- Die Bedeutung der „Neuen Frau“ in der Weimarer Republik
- Der Einfluss der „Verhaltenslehren der Kälte“ auf die Literatur der Neuen Sachlichkeit
- Die Darstellung von Frauenfiguren in der Literatur der Neuen Sachlichkeit
- Die Rolle von männlichen Figuren als Kontrastfiguren zu den Frauenbildern der Neuen Sachlichkeit
- Die Verbindung von fiktionalem und dokumentarischem Schreiben in der Neuen Sachlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt die zentralen Fragestellungen der Arbeit ein und skizziert den Hintergrund der Untersuchung.
- Das Kapitel „Die Neue Sachlichkeit“ beleuchtet die Entstehung und Charakteristika dieser literarischen Strömung in der Weimarer Republik. Es analysiert die ästhetischen und gesellschaftlichen Hintergründe der Neuen Sachlichkeit und beleuchtet die Debatte um ihre politische Ausrichtung.
- Das Kapitel „Die Verhaltenslehren der Kälte“ untersucht den Einfluss der im Kontext des Ersten Weltkriegs entstandenen Verhaltenslehren auf die Literatur der Neuen Sachlichkeit. Die Analyse fokussiert auf die Auswirkungen der Kälte-Metapher auf die Gestaltung von Frauenfiguren und die Darstellung von Geschlechterrollen in der Literatur.
- Das Kapitel „Irmgard Keuns Roman „Das kunstseidene Mädchen“ widmet sich der Analyse der Figur Doris als „kalte persona“ und untersucht die Darstellung von Liebe, Moral und Geschlechterrollen in Keuns Roman.
- Das Kapitel „Marieluise Fleißers Roman „Eine Zierde für den Verein““ analysiert die Figur Frieda Geier als Paradigma der „Neuen Frau“ und stellt sie in den Kontext der männlichen Verhaltenslehren der Kälte. Die Analyse beleuchtet Friedas Rolle als Berufstätige, Ehefrau und Freundin.
- Das Kapitel „Erich Kästners Roman „Fabian““ untersucht die Figur Fabian als sentimentalen und passiven männlichen Kontrast zu den weiblichen Figuren der Neuen Sachlichkeit. Die Analyse fokussiert auf die Darstellung von Film und Reklame als Welt des schönen Scheins und auf die Beziehung von Fabian zu Frauen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der Neuen Sachlichkeit, der „Neuen Frau“ in der Weimarer Republik, der Darstellung von Frauenfiguren in der Literatur, den „Verhaltenslehren der Kälte“ und dem Einfluss des Ersten Weltkriegs auf die deutsche Gesellschaft. Sie analysiert Romane von Irmgard Keun, Marieluise Fleißer und Erich Kästner sowie die Rolle von Film, Reklame und Journalismus in der literarischen Moderne.
- Citation du texte
- Hans-Georg Wendland (Auteur), 2021, Frauenbilder der Weimarer Republik und literarische Frauenfiguren der Neuen Sachlichkeit bei I. Keun, M. Fleißer und E. Kästner (Teil II), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/989384