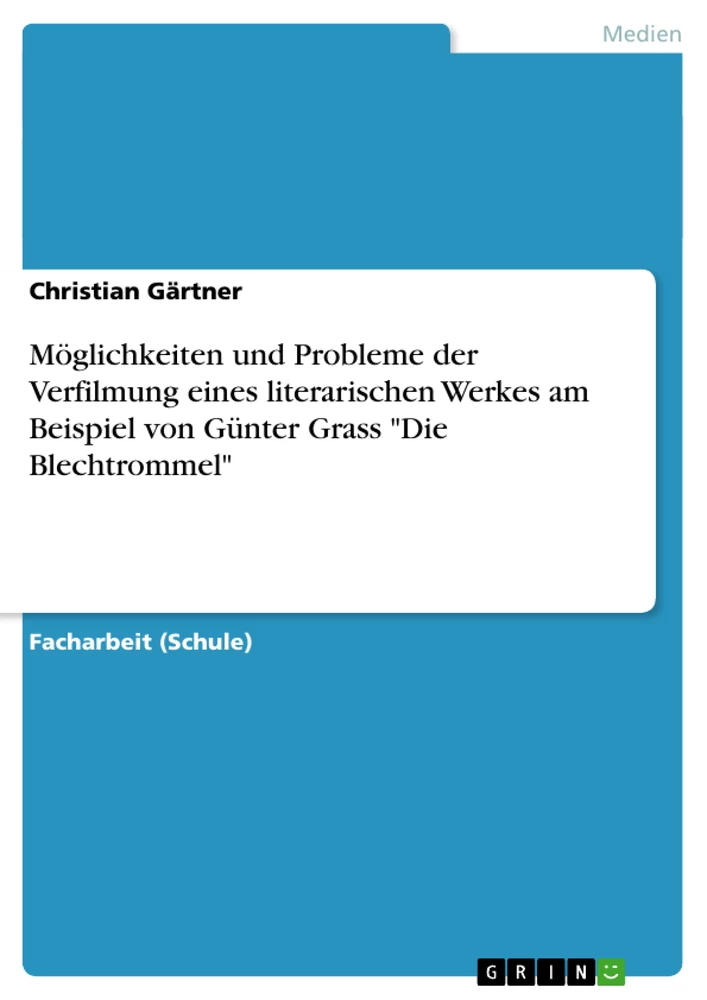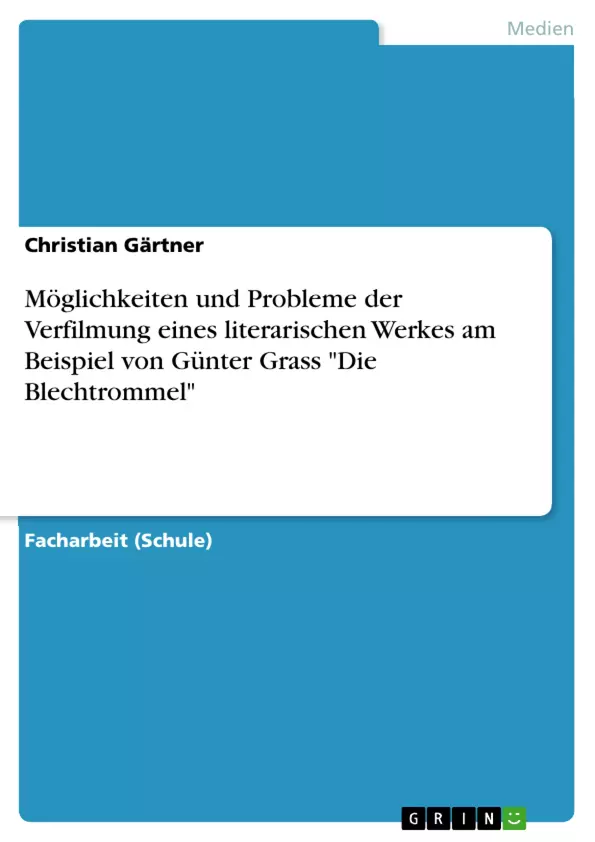Stellen Sie sich vor, ein Roman, der die deutsche Nachkriegsliteratur für immer veränderte, wird zum Leben erweckt – aber kann die Leinwand die Tiefe und den Abgrund von Günter Grass' Meisterwerk Die Blechtrommel wirklich erfassen? Diese Analyse nimmt Sie mit auf eine faszinierende Reise durch Volker Schlöndorffs Oscar-prämierte Verfilmung, ein Werk, das sowohl gefeiert als auch kritisiert wurde. Wir sezieren die Intentionen des Romans, von seiner scharfen Kritik am Kleinbürgertum und der Verblendung durch den Nationalsozialismus bis hin zur Darstellung des Schelmenhaften in Oskar Matzeraths rebellischer Verweigerung, dem Erwachsenwerden. Entdecken Sie, wie Schlöndorff die komplexen Themen der Schuld, der Verdrängung und der Suche nach Identität in einer zerrütteten Gesellschaft visualisiert, und welche erzählerischen Kniffe er anwendet, um die Vielschichtigkeit von Grass' Sprache und Symbolik auf die Leinwand zu übertragen. Dabei werden die Stärken des Films, wie die realistische Darstellung der Zeitgeschichte und die brillante schauspielerische Leistung von David Bennent als Oskar, ebenso beleuchtet wie die unvermeidlichen Schwächen, die sich aus der Kürzung und Vereinfachung des epischen Stoffes ergeben. Erfahren Sie, warum die Auslassung des dritten Buches, das die Nachkriegszeit und Oskars Eingliederungsversuche thematisiert, eine entscheidende Veränderung der Aussage des Werkes bewirkt und wie der Verlust des allwissenden Erzählers die Interpretation der Farbsymbolik und der historischen Anspielungen beeinflusst. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob eine Verfilmung überhaupt jemals die literarische Vorlage vollständig erfassen kann, oder ob sie nicht vielmehr als eigenständiges Kunstwerk betrachtet werden sollte, das neue Perspektiven eröffnet und somit das Originalwerk in einem neuen Licht erstrahlen lässt. Tauchen Sie ein in eine Welt aus Blech, Glas und schreiender Kritik, und beurteilen Sie selbst, ob Schlöndorffs Blechtrommel ein gelungenes Denkmal oder eine unvollständige Interpretation eines unsterblichen Romans ist. Eine Auseinandersetzung mit einem Schlüsselwerk der deutschen Filmgeschichte und ein Muss für jeden Literatur- und Filmliebhaber, der sich mit den Herausforderungen der Adaption literarischer Werke auseinandersetzen möchte. Die Analyse bietet eine umfassende Untersuchung der Blechtrommel, beleuchtet die historischen Bezüge, die allegorischen Elemente und die vielschichtigen Charaktere, und zeigt auf, wie der Film versucht, die Essenz von Grass' Kritik an der deutschen Gesellschaft und ihrer Vergangenheitsbewältigung einzufangen. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Literaturverfilmungen, deutsche Geschichte und die Auseinandersetzung mit Schuld und Verantwortung interessieren. Dieses Buch ist eine Einladung, über die Grenzen der Kunstformen nachzudenken und die Macht der Interpretation neu zu entdecken.
Gliederung:
A) Die Blechtrommel - Attraktion und Ärgernis
B) Möglichkeiten und Probleme der Verfilmung eines literarischen Werkes am Beispiel der Blechtrommel
I. Die Intention des Romans
1. Die Blechtrommel als realistischer Zeitroman
a) Oskar, der beobachtende Trommler
b) Die historischen Bezüge und Allegorien
2. Die Elemente des Schelmenromans im Roman
a) Die Erziehung des Pikaro
b) Die Blechtrommel als autobiographisches Werk aus einer niederen Perspektive
c) Episoden und Satire
d) Die Infragestellung der Welt aufgrund der Gesellschaftsverhältnisse
3. Die Blechtrommel als Bildungsroman
a) Die Verweigerung einer Entwicklung
b) Zwischen Goethe und Rasputin
c) Der ,,Mißbildungsroman"
II. Was die Verfilmung der Blechtrommel leistet
1. Verkürzung der Romanhandlung auf eine lineare Handlung
2. Der Film als handwerklich gut gemachtes Kunstwerk
3. Realistische Darstellung der Gesellschaft
4. Der Versuch die Romanvorlage präzise umzusetzen
a) Durch den Off-Sprecher wird die Treue zur Vorlage garantiert
b) Die Episodenhaftigkeit schafft epische Distanz
c) Die Verwirklichung von Zeit-, Schelmen- und Bildungsroman
III. Die Probleme beim Transport der Intentionen eines literarischen Werkes auf das Medium Film am Beispiel dieser Verfilmung
1. Die Aussparung wichtiger Passagen führt zu einer Verzerrung der Intention des Werkes
a) Die Religionsfrage wird nicht vollständig erfaßt
b) Die Ebene des Bildungsromans kommt nicht ausreichend zur Geltung
c) Das Schuldmotiv wird nur sporadisch angesprochen
d) Ohne das dritte Buch fehlt der wichtige Aspekt des Eingliederungsversuchs
2. Der Erzähler kann nicht befriedigend ersetzt werden
a) Des Erzählers eigentümliche Sprache konnte nur unzureichend transportiert werden
b) Die kaum vorkommende direkte Rede bereitet ein unüberwindbares Problem
c) Farbsymbolik, Allegorien und Anspielungen fehlen
C) Der Film Die Blechtrommel ist ein gelungenes Kunstwerk, das innerhalb der diesem Genre gesetzten Grenzen die Romanvorlage gut umsetzt
,,Man nehme zwei Teile psychoanalytische Weisheit (gar nicht wichtig, Genaues zu wissen), füge fünf Teile eingehende genaueste sexuelle Details hinzu, mische gut, und fülle dann auf mit ,wilder und ungetümer Diktion`. Schließlich versäume man nicht, einige Tropfen Gotteslästerung und einen guten Schuß morbider und obszöner Maßlosigkeit hinzuzusetzen, und fertig ist der preisgekrönte Roman: ,Die Blechtrommel` von Günter Grass." So beschreibt Dr. med. H. Müller-Eckhard1 Grass` epischen Erstling für den der Autor von der ,,Gruppe 47" 1958 den Literaturpreis, aufgrund der Lesung von Teilen seines noch nicht fertiggestellten Romans, erhielt. Doch nicht nur im deutschsprachigen Raum erregte die Blechtrommel die Gemüter. Vor allem die Verfilmung von Volker Schlöndorff führte aufgrund der Darstellung sexueller Einzelheiten zu heftigen Kontroversen. So läuft in den Vereinigten Staaten von Amerika noch heute ein Prozeß, der darüber entscheiden soll, ob die Blechtrommel weiterhin als Video erhältlich sein darf2. Doch sollte man nicht davon ausgehen, daß der Autor einzig und allein das deutsche Bildungsbürgertum in seinen Überzeugungen erschüttern wollte, denn hierfür ist der Roman zu vielschichtig, als daß man ihn einfach auf einen blasphemischen und werteverachtenden Kern reduzieren könnte. Für Volker Schlöndorff stellte die Blechtrommel eine besondere Herausforderung und zugleich eine einmalige Chance dar: Er durfte während der Zeit des Kalten Krieges an Originalschauplätzen in Polen drehen. Gleichzeitig wurde sein Werk aber auch von Grass kritisch betrachtet und letztendlich von ihm abgesegnet. Was Schlöndorff mit seiner oskarprämierten Verfilmung von Grass` Blechtrommel geleistet hat, und welche Möglichkeiten und Probleme die Adaption eines literarischen Werkes an das Medium Film mit sich bringt, soll im Folgenden erörtert werden.
,,Die Blechtrommel ist zu allererst ein realistischer Roman," behauptet Günter Grass und erklärt auch sofort, was er mit dem Begriff ,,Realität" verbindet: ,,Die Satire, die Legende, die Parabel, die Gespenstergeschichte, kurz alles was heutzutage dummvereinfacht als Surrealismus abgestempelt wird, dienen und gehören dieser Realität."3 So besteht der Roman einerseits aus genau rekonstruierten alltäglichen Situationen, Menschen und Vorfällen aus der jüngsten Vergangenheit Deutschlands und andererseits aus Vorstellungen und Formen, die einer künstlerischen Phantasie entstammen. Die Vermischung dieser Elemente ist nötig, um die verworrenen Zustände in der Vor- und Nachkriegszeit und vor allem während der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland zu beschreiben, entspricht aber auch der Vorstellungsweise eines Kindes oder eines Verrückten. Im Roman ist es der bucklige Oskar Matzerath, der aus einer Heil- und Pflegeanstalt in drei Büchern von seinem Leben erzählt - oder besser seine Trommel erzählen läßt. Denn eigentlich ist es sein Blechinstrument, das von den kartoffelfarbenen, Unterschlupf gewährenden Röcken seiner Großmutter, bis hin zur furchteinflößenden Gestalt der Schwarzen Köchin erzählt. Die Trommel schafft das nötige Wissen und die nötige Distanz, die Oskar bei seiner Beobachtung der Welt und der Gesellschaft braucht: ,,Hätte ich nicht meine Trommel, der bei geschicktem und geduldigem Gebrauch alles einfällt, was an Nebensächlichkeiten nötig ist, um die Hauptsache aufs Papier bringen zu können,[...] wäre ich ein armer Mensch ohne nachweisliche Großeltern."4 In Oskars Darstellungen, die einerseits den autobiographischen Bericht, beginnend mit dem Zusammentreffen der Großeltern 1899, und endend mit seiner Verhaftung 1952, und andererseits die Rahmenhandlung in der Anstalt von 1952 bis 1954 enthalten, wird der Einzelne völlig auf sich selbst verwiesen, denn von außen kommt keine Hilfe, da der Nächste ebenso ratlos ist und der fiktive Erzähler die einzige Informationsquelle bleibt. Oskar lebt in einer Zeit, in der das Leben nichts mehr zu bieten hat, was eine Anstrengung wert wäre. Bezeichnend hierfür ist das Bild der beiden Freunde Oskar und Klepp, die sich in Düsseldorf herumdrücken, von Kino zu Kino gehen, weil sie nicht wissen, was sie mit ihrer freien Zeit anfangen sollen. Aus diesem Gefühl der Daseinsleere entwickelt sich ein Gefühl der Unsicherheit und des Bloßgestelltseins, das auch für die meisten anderen Figuren des Romans charakteristisch ist. Die Folge dieser Gefühle ist der Versuch einen Unterschlupf, ein Asyl bietendes Versteck - Tische, Schränke, die Röcke der Großmutter und schließlich die Heil- und Pflegeanstalt - zu finden. Dies findet zum Beispiel auch bei Agnes eine Entsprechung:
,,[...]denn wenn sie nicht unter das Bett kroch, dann steckte sie im Kleiderschrank, und wenn Besuch da war saß sie unter dem Tisch und mit ihr ihre Kodderpuppen. Es kam dem Mädchen Agnes also darauf an, versteckt zu bleiben[...]5 "
Die Blechtrommel des Erzählers stellt die Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart her. Auf ihr wird sich Oskar am Ende auch ein Zukunftsbild zusammentrommeln6. Oskar stellt sich die Aufgabe, ,,von unten her trommelnd, den Erwachsenen zuzuschauen"7. Hierfür hat er als ,,hellhöriger Säugling", dessen ,,geistige Entwicklung schon bei der Geburt abgeschlossen ist und sich fortan nur noch bestätigen muß"8, die besten Voraussetzungen. Die Zustände, die er bei seiner Geburt 1924 vorfindet, erschrecken ihn dermaßen, daß er nichts mit dieser Welt zu tun haben will, und sich deshalb in das Außenseitertum des kleinwüchsigen dreijährigen Blechtrommlers flüchtet, denn mit der Größe eines Dreijährigen hat er die Augenhöhe seiner sitzenden Großmutter erreicht, die wie ein ruhender, schutzgewährender Pol auf den kaschubischen Äckern die Umgebung betrachtet, und somit kann auch Oskar unbehelligt und unverstanden von unten her seine Umwelt erfassen:
,,Neben all diesen Spekulationen, meine Zukunft betreffend, bestätigte ich mir: Mama und jener Vater Matzerath hatten nicht das Organ, meine Einwände und Entschlüsse zu verstehen und gegebenenfalls zu respektieren. Einsam und unverstanden lag Oskar unter den Glühbirnen, folgerte, daß es so bleibe, bis sechzig, siebzig Jahre später ein endgültiger Kurzschluß aller Lichtquellen Strom unterbrechen werde, verlor deshalb die Lust, bevor dieses Leben unter den Glühbirnen anfing; und nur die in Aussicht gestellte Blechtrommel hinderte mich damals, dem Wunsch nach Rückkehr in meine embryonale Kopflage stärkeren Ausdruck zu geben."9
Bewaffnet mit seiner Trommel und der Fähigkeit Glas zu zersingen, kommentiert Oskar nun die nächsten Jahrzehnte, in denen sich Geschichte ereignet so wie sie Oskar sich vorstellt - als eine Abfolge von Krieg und Frieden:
,,Der Krieg hatte sich verausgabt. Man bastelte, Anlaß zu ferneren Kriegen gebend, Friedensverträge[...]"10
Hier wird die Situation nach dem ersten Weltkrieg geschildert und es tauchen immer wieder Andeutungen auf historische Begebenheiten in der Blechtrommel auf, die das Verhalten der geschilderten Personen beeinflussen und somit deutlich werden. Am Ende des zweiten Buches wird im Kapitel ,,Glaube, Hoffnung, Liebe"11 die Reichskristallnacht geschildert, der der Spielwarenhändler Sigismund Markus zum Opfer fällt. Weiterhin schildert Oskar, wie sich sein Vater Alfred der damaligen Gepflogenheit anpaßt und in die NSDAP eintritt. Bemerkenswert sind auch die allegorisierenden. In der kleinbürgerlichen Freizeitbeschäftigung des Skatspiels, treffen die verschiedenen Nationalitäten aufeinander und das Spiel wird Ausdruck der Machtverhältnisse zwischen Deutschland, verkörpert durch den ,,gebürtigen Rheinländer"12 Alfred Matzerath, Danzig in Gestalt von Agnes Matzerath beziehungsweise Scheffler, der diese nach ihrem Tod vertritt, und Jan Bronski als Vertreter Polens:
,,Polen hat einen Grand Hand verloren; die freie Stadt Danzig gewann soeben für das Großdeutsche Reich bombensicher einen Karo einfach."13
Mit dem Reichsdeutschen Matzerath, der, beim Versuch sein NSDAP- Abzeichen zu verschlucken, stirbt, endet auch das Großdeutsche Reich, als die Russen in Danzig einmarschieren. Ähnlich verhält es sich mit Jan Bronski, der als Bediensteter in der Polnischen Post von der Heimwehr erschossen wird und somit den Untergang der polnischen Republik symbolisiert. Auch Oskar kann als Allegorie der Naziepoche gesehen werden, da bei Matzeraths Tod die Partei mit dem Sohn gleichgesetzt wird:
,,Sperrig und stechend gab ich den klebenden Bonbon an Matzerath ab, [...] damit er daran erstickte - an der Partei, an mir, an seinem Sohn [ ]"14
In dieses Bild passen auch folgende Datierungsparallelen: Die sexuelle Eroberung Marias fällt mit der Besetzung Frankreichs zusammen, das Vordringen bei Frau Greff mit dem Überfall auf Rußland. Allerdings werden solche Übereinstimmungen zwischen Oskar und den Nazis von dem durch Oskar positiv geschilderten Eindruck Polens gestört15. Auch läßt die rot- weiße- Farbe der Trommel - ein immer wiederkehrender Farbkontrast, der im Laufe der Untersuchung noch näher erläutert wird - einen Bezug zu Polen erkennen, der nicht mit der oben genannten Allegorie in Einklang zu bringen ist. Dies ist nur ein weiterer Anhaltspunkt dafür, daß dieser Roman nicht einfach und endgültig interpretiert werden kann, da seine Vielschichtigkeit immer wieder neue Fragen und Probleme aufwirft. Eindeutiger sind die Narben, die Oskar auf Herbert Truczinskis Rücken vorfindet und an denen die politische Spannung vor dem zweiten Weltkrieg abgelesen werden kann. Die erste der Narben, die sich Herbert in der Kneipe ,,Zum Schweden" geholt hat, bezieht sich auf osteuropäische Streitigkeiten. Der Deutsche nennt den Ukrainer ,,Ruski", der Ukrainer beschimpft den Danziger mit ,,Wasserpollack", und Herbert, der eigentlich in der Bar nur Ruhe, Ordnung und Frieden haben will und sie deshalb mit dem Völkerbund vergleicht, spricht von dem Polen als ,,Pollack" und wird von ihm ,,Nazi" genannt. Was sich anhört wie die Streitereien kleiner Kinder mit bloßen Worthülsen, wird zu einem Handgemenge, bei dem Herbert von dem Polen mit einem Messer gestochen wird16. Der Roman schildert also das genaue Bild der Gesellschaft der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und vieles beruht auf konkreten historischen Tatsachen. Allerdings bleibt es am Ende doch Fiktion, da das Bild von einer Kamera gemacht wurde, deren Linsen Oskars Augen sind, und mag er auch noch so gestochen scharf beobachten, am Ende bleibt eine perspektivische Erzählung und der Leser weiß, daß er es mit einer Verzerrung der Wirklichkeit zu tun hat. Darüber hinaus scheint es fast so, als wolle Oskar das Bild seiner Wirklichkeit absichtlich schwärzen und die positiven Seiten ignorieren.
Mehrere Kritiker und Interpreten sehen in Oskar den Pikaro, den Helden der pikaresken Erzählung. Eine Definition des Pikaresken findet sich bei Claudio Guillen17: Ein erster Punkt betrifft die Erziehung des Pikaro. Er wächst ohne die übliche elterliche Erziehung auf, wird deshalb den gesellschaftlichen Konventionen nicht angepaßt und internalisiert das Wertsystem der Gesellschaft aus diesem Grunde nicht. Oskar ist mit seinem Zwergwuchs schon von vornherein als Außenseiter abgestempelt und unterstreicht diese Position, indem er sich vor der Einschulung bewahrt. Er muß sich spätestens nach diesem Ereignis selbst erziehen, da die Eltern ihre Bemühungen um Anpassung an die herrschenden Gepflogenheiten aufgegeben haben. Der zweite Aspekt des Schelmenromans bezieht sich auf die autobiographische Darstellung, welche in dem Roman zweifelsohne dominiert. Oskar trommelt sich in den zwei Jahren des Erzählens letztendlich einen Lebensbericht, der als Selbstrechtfertigung gedacht ist, zusammen. In ihm beschreibt er nicht nur seinen eigenen Lebensweg, der, für einen Pikaro typisch, vom Kolonialwarenhändlerskind bis zum gefeierten Tourneestar quer durch die Gesellschaft führt, sondern gleichzeitig den Verfall einer ganzen Gesellschaft. Diese Beschreibung geschieht immer aus einer niedrigen Perspektive, die oben schon eingehender erläutert wurde. Diese beiden Erzählsituationen bewirken eine Einen - gung des Blickwinkels und das Fehlen einer Distanz zum Geschehen, was als weiteres Stilmittel des Schelmenromans aufgeführt wird. Manche Interpreten meinen hinter dem Erzähler den Autor zu erkennen und begründen dies mit dem Parallelismus der Lebenswege, denn auch Grass stammt aus Danzig, hat also viele der Schauplätze sicherlich mit eigenen Augen gesehen und auch er war Steinmetz, bevor er den Beruf des Schriftstellers ergriff. Zusätzlich läßt der Wechsel der Perspektiven - Oskar erzählt sowohl in der ersten als auch in der dritten Person Singular - darauf schließen, daß der Autor sich selbst einschalten würde. Allerdings wäre dieser Umsprung zu häufig und regelmäßig. Zusätzlich steht diese Annahme im Gegensatz zur Forderung des Pikaroromans, der Autor müsse sich hinter dem Erzähler zurückziehen, um der Aufgabe der moralischen Urteilsfällung enthoben zu werden und um ungestört protestieren zu können. Ein weiterer Punkt in der Definition Guillens ist das Auftreten von Schurken und die sich daraus ergebende Satire, beziehungsweise komische Wirkung. Die Schurken werden im Roman durch skurrile Personen ersetzt. Als Beispiel mag hier der Prototyp einer Lehrerin, Fräulein Spollenhauer, gelten. Sie vereint alle Attribute einer spießigen Lehrkraft in einer Weise, die zum Schmunzeln anregt:
,,Fräulein Spollenhauer trug ein eckig zugeschnittenes Kostüm, das ihr ein trocken männliches Aussehen gab."
,,[...] den uralten schablonenhaften Volksschullehrerin nenanblick [ ]"18 Satire entsteht vor allem durch die Erzählweise Oskars, die von schelmisch lächelnd bis boshaft und zynisch reicht und mit welcher er es versteht, die Figuren und Situationen so zu schildern, daß die sinnentleerten Alltagsgeschehnisse ihren feststehenden, abgedroschenen Charakter offenbaren. Diese Alltagssituationen werden in aneinandergereihten Einzelgeschichten, die zwar nicht alle von einander gelöst werden können, aber von denen viele, zum Beispiel die Geschichte Herbert Truczinskis, austauschbar sind, erzählt. Somit erfüllt die Blechtrommel auch die Forderung Guillens nach Episodenhaftigkeit. Die letzte der hier angesprochenen Thesen, ist das Kennzeichen des Pikaro, daß er zu allgemeinen Schlußfolgerungen komme und die Welt anprangere. Oskar kommt zu einer sehr prägnanten Schlußfolgerung: Weil die Welt so abstoßend ist, versucht er sich zunächst dieser Welt zu entziehen und später aus ihr, beziehungsweise vor ihr, zu entkommen, indem er seine Einlieferung in die Pflege- und Heilanstalt bewirkt. Seine Flucht endet aber in der schreckensvollen Wiederbegegnung mit ihr am Ende des Romans. Durch seine Versuche jeglicher Sozialisation zu entkommen, stellt er die Welt nicht nur in Frage, sondern verurteilt ihre Bewertungsmechanismen.
Die letzte Ebene, hinsichtlich welcher der Roman untersucht werden soll, ist die des Bildungsromans. Günter Grass selber behauptet, sein Roman sei ,,eine Travestie des deutschen Bildungsromans"19. Oskar Matzerath durchlebt also mehrere Bildungsetappen, aber im Unterschied zu seinen Vorgängern, wie der Grüne Heinrich oder Wilhelm Meister, verändert sich Oskar auf seinem Bildungsweg nicht. Oskars Bildungsgang ist nicht bestimmt von Fortschritten, denn diese spielen für den Frühentwickelten keine Rolle. Vielmehr sind seine Verweigerungen gegenüber dem traditionellen Bildungsweg Eckpunkte in seiner Entwicklung. Oskar sperrt sich aber nicht nur gegen antiquierte Bildungseinrichtungen, sondern auch gegen eine Gesellschaft, die jeden Sinn für sittliches Benehmen verloren hat. Deutlich wird dies an dem inzestiösen Verhältnis zwischen den Geschwistern Agnes und Jan, die sich nicht mehr um Wertvorstellungen kümmern, und im besonderen Ausmaß an der Entwicklung des Nationalsozialismus, der es versteht die deutsche Bevölkerung in seinen Bann zu ziehen. Der im Schutze der Dreijährigkeit verbleibende Oskar entzieht sich durch diese Absonderung aus der Erwachsenenwelt jeglicher Verantwortung. Während Alfred Matzerath in die Partei eintritt, beziehungsweise eintreten muß, verharrt Oskar passiv in seiner Außenseiterrolle. Das damit verbundene Schuldmotiv wird später noch eingehender erläutert. Oskars Lebensweg scheint von an Geburt festzustehen, zumindest für seinen mutmaßlichen Vater:
,,,Ein Junge`, sagte jener Herr Matzerath, der in sich meinen Vater vermutete.,Er wird einmal das Geschäft übernehmen. Jetzt wissen wir endlich, wofür wir uns so abarbeiten.`"20
Im Gegensatz zu dieser - von Oskars Warte her gesehen - eher trostlosen Zukunft, verspricht die Mutter, sein musikalisches Talent zu fördern und schafft damit das Objekt, das der Mittelpunkt der Handlung wird: ,,Wenn der klein Oskar drei Jahre alt ist, soll er eine Blechtrommel bekommen."21 Oskars erste Verweigerung besteht also darin, ,,alles was das Kolonialwarengeschäft betraf, schlankweg abzulehnen", den Wunsch seiner Mutter aber ,,zu gegebener Zeit, [...], wohlwollend zu prüfen"22. Seine zweite Verweigerung begeht er genau drei Jahre später, als sich absichtlich von der Kellertreppe stürzt, um seinem Entschluß, das Wachstum einzustellen, den nötigen Anlaß zu geben. Durch die Ablehnung des körperlichen Alterns manövriert sich Oskar bewußt in die Außenseiterrolle, um sich nicht in die Gesellschaft integrieren lassen zu müssen. Die Aufgabe seines Status als Dreijähriger im Jahr 1945 zwingt Oskar sich der Gesellschaft anzupassen und an ihrem Leben teilzunehmen. Er verliert hierbei nicht nur seine Außenseiterrolle, sondern auch noch seine glastötende Stimme und kann so seinen Protest nicht mehr artikulieren. Nur noch über das Trommeln kann er protestieren und auch hier nur indirekt. So trommelt er stellvertretend für andere die Kindheit wieder herauf und erlebt aus zweiter Hand noch einmal die zerstörerische Kraft seiner Kinderstimme:
,,Oskar trommelte also ,Die Schwarze Köchin` und mußte erleben, daß tausendfünfhundert Kumpels, [...], der bösen Schwarzen Köchin wegen ein fürchterliches Geschrei losließen, dem [...] hinter dicken Vorhängen mehrere Fensterscheiben der Festhalle zum Opfer fielen. So, über diesen Umweg, fand ich wieder meine glastötende Stimme [ ]"23
Das Attribut der Dreijährigkeit ist die Trommel, die dann ja auch am Ende des zweiten Buches symbolisch ins Grab des Vaters geworfen wird und somit einen neuen Lebensabschnitt einleitet. Gerät dieses Kennzeichen in Gefahr, so wird es von Oskar mit Hilfe seiner Stimme verteidigt, wobei sich seine Angriffe gezielt gegen gesellschaftliche Werte richtet. Als Oskar seine erste Trommel ohne Hoffnung auf Ersatz derselben einbüßen soll, zeigt sich dieses Phänomen zum ersten Mal:
,,[...] da gelang es Oskar, der bis zu jenem Tage als ein ruhiges, fast zu braves Kind gegolten hatte jener erste zerstörerische und wirksame Schrei. Für Matzerath jedoch, auch für Mama und Onkel Jan Bronski, [...], schien mehr als nur das Glas vorm Zifferblatt kaputt zu sein."24
Die Zerstörung der Uhr als Zeitmesser und somit oberstes Symbol gesellschaftlicher Regelungen, beschert Oskar den Sieg und den Erhalt seiner Trommel, die von nun an immer wieder durch eine neue ersetzt wird, auch wenn es scheinbar unmöglich scheint, noch neues Blech für den Gnom zu beschaffen. Die dritte Verweigerung wurde oben bereits beschrieben, da sie ein Element des Schelmenromans ist. Oskar manifestiert den Status der Dreijährigkeit, indem er neben der körperlichen nun auch seine psychische Zurückgebliebenheit untermauert. Hierbei richtet sich sein Protest gegen die von der Gesellschaft eingeteilte Zeit des
Stundenplans in der Schule. Oskar prangert aber nicht das Schulsystem an sich an, sondern erkennt, daß die Schule seine Trommel und den Status des Dreijährigen gefährdet. Diese drei Verweigerungen definieren Oskars Außenseiterrolle klar und in den ersten beiden Büchern wird diese auch nicht mehr in Frage gestellt. Nach dem gescheiterten Versuch sich in der Schule Wissen anzueignen, muß Oskar nun einen anderen Weg finden, seine intellektuellen Fähigkeiten, die er als hellhöriger Säugling mit abgeschlossener Entwicklung hat, auszubilden. Da sich aber laut Grass keine Veränderung Oskars ergibt und Oskar Bildung als Selbstzweck ohne erkennbares Bildungsziel betrachtet, muß dieser Versuch ins Groteske und Komische abgleiten. Seine Literaturauswahl ist demnach auch durch Klischees bestimmt:
,,Dieser Doppelgriff sollte mein Leben, welches Abseits meiner Trommel zu führen ich mir anmaßte, festlegen und beeinflussen. Bis zum heutigen Tage da Oskar die Bücherei der Heil- und Pflegeanstalt bildungsbeflissen nach und nach in sein Zimmer lockt - schwanke ich, auf Schiller und Konsorten pfeifend, zwischen Goethe und Rasputin, zwischen dem Gesundbeter und dem Alleswisser, zwischen dem Düsteren, der die Frauen bannte, und dem lichten Dichterfürsten, der sich so gern von den Frauen bannen ließ."25
Diese Kluft zwischen den beiden so unterschiedlichen Dichtern kann Oskar nicht schließen. Er steht damit nicht in der Tradition der Helden im klassischen Bildungsroman, die eine versöhnende Synthese zwischen zwei sich widersprechenden Prinzipien vollbringen. Aber der Dualismus ist nicht mehr klar erkennbar, da der lichte Dichterfürst durch die Benutzung des deutschen Bildungsbürgertums und den Nazis nicht mehr nur ,,apollinische Züge trägt"26. Dadurch bekommt auch er dämonische Züge, die sogar den finsteren Rasputin überholen:
,,So kann es das Wörtchen Goethe sein, das mich aufschreien und ängstlich unter die Bettdecke flüchten läßt. So sehr ich auch von Jugend an den Dichterfürsten studierte , seine olympische Ruhe ist mir schon immer unheimlich gewesen. Und wenn er heute verkleidet, schwarz als Köchin, nicht mehr licht und klassisch, sondern die Finsternis eines Rasputin überbietend, vor meinem Gitterbett steht und mich anläßlich meines dreißigsten Geburtstages fragt. ,Ist die Schwarze Köchin da?` fürchte ich mich sehr."27
Nachdem Oskar einen Waldbrand - der übrigens als Vorbote des kommenden Weltbrands gesehen werden kann - während des Besuchs der Zoppoter Freilichtbühne verursacht hat, nimmt seine Mutter davon Abstand, ihn durch weitere Theaterbesuche zu kultivieren. Statt dessen besuchen sie den Zirkus. Bei dieser Gele- genheit macht Oskar die Bekanntschaft mit Bebra, in dem er einen Seelenverwandten erkennt. Dieser durchschaut ihn sofort und bringt Oskar dazu, seine Erfahrungen allein ohne führende Hand zu machen. Im Folgenden betätigt sich Oskar als Verführer. Zunächst zerstört er eine Tribünenkundgebung der Nazis, indem er selbst - anstatt den Nationalsozialisten - die Massen durch seinen Dreivierteltakt bannt. Danach entlarvt er den Verbrechertrieb der Menschen, indem er ihnen durch das Zersingen der Schaufenster die Möglichkeit bietet, die Auslagen zu stehlen. Oskar, der ,,Held", versucht also nicht sich der Gesellschaft anzupassen, sondern er versucht, die Gesellschaft sich anzupassen28. Nach dem eben Erarbeitetem ist klar, warum Günter Grass von einer Travestie, und Hans Mayer in ironischer Pointierung von einem ,,Mißbildungsroman" sprechen29. Ein Indiz dafür, daß sich Oskar doch verändert, sind die drei Stadien des Trommelns: Zunächst trommelt Oskar nur aus Protest, und das im ersten Buch am heftigsten. Der zweite Schritt ist auch noch vom Protest geprägt, wenn auch nicht mehr so eindeutig. Dies ist die Zeit, als Oskar im Zwiebelkeller und für die Konzertagentur ,,West", sein Publikum in die Kindheit zurücktrommelt, also ,,vor jene vergessene Wirklichkeit, gegen die die Trommel des dreijährig gebliebenen protestiert hatte".30 Das letzte Stadium des Trommelns hat Oskar im weißen Metallbett der Heil- und Pflegeanstalt erreicht. Hier dient die Trommel zur Wiederaufbereitung seines Lebens. Oskar macht also trotz seiner Verweigerung der Gesellschaft gegenüber einen Entwicklungsprozeß durch. Dies wird auch durch den Wiedereingliederungsversuch des Jahres 1945 verdeutlicht. Was nun augenscheinlich dem Werdegang eines Bildungsromans entspricht, wird dadurch in Frage gestellt, daß Oskar sowohl äußerlich als auch innerlich von der Realität getrennt ist, weil er, ,,indem er unter Tarnung, die Eingehen auf die Wirklichkeit vortäuscht, eine eigene moralische Instanz besitzt, die seine Entscheidung unabhängig von der Wirklichkeit bestimmt."31 Andere Literaturhistoriker sehen in der Blechtrommel einen Anti- Bildungsroman, weil in ihm kritisch auf die Schwächen und Einseitigkeit der Bildungsideale der jeweiligen Epoche hingewiesen werden. Seinen parodistischen Charakter entfaltet der Roman nach Georg Just dann, wenn man ihn hinsichtlich der Lukacs'schen Kriterien für den Helden des Bildungsromans untersucht32. Nach Lukacs ist der Held ein Suchender, ein problematisches Individuum, ein Idealträger und der Repräsentant einer bestimmten Zeitproblematik. Oskar aber ist nach Just kein Suchender und problematisch deswegen, weil für ihn der einzige Sinn darin besteht, keinen Sinn zu suchen. Er kennt im Gegensatz zum traditionellen Helden, der als Idealträger bestimmt ist, kein Ideal. Oskar ist also kein Held der Romantradition. ,,Daß er diese dennoch selbst als Norm setzt, verleiht der Blechtrommel [...] ihren parodistischen Aspekt [...]33. Ob man nun die Blechtrommel als Bildungsroman, als dessen Parodie oder als Anti- Bildungsroman auffaßt, hängt von der Interpretation des Helden ab. Fest steht, daß sehr viele literarische Einordnungsformen möglich sind, aber auch, daß es nicht unbedingt notwendig ist diese auszunützen, denn der pessimistische Grundgedanke ist nicht von der Hand zu weisen. Es gelingt Oskar nicht, sich harmonisch in diese Welt einzufügen, da dieses Kleinbürgertum, dem er sich annähert, die große Ressource des Nationalsozialismus gewesen ist. Grass zerstört den Glauben daran, daß eine menschliche Entwicklung hinsichtlich humaner Selbstverwirklichung möglich ist. Das Buch endet in der Horrorvision der bevorstehenden Entlassung. Ein hoffnungsvoller Neubeginn ist nicht möglich. Die offenstehenden Möglichkeiten ,,müssen überprüft werden"34. Zur Überprüfung dient die Trommel, jenes Symbol der Dreijährigkeit und der Verweigerung. Die letzten Zeilen des Romans werden von einem kindlichen Schreckgespenst, das nicht in eine aufgeklärte Welt passen mag und immerwährende Schuld verkündet, dominiert:
,,Schwarz war die Köchin hinter mir immer schon. Daß sie mir nun auch entgegenkommt, schwarz. Wort, Mantel wenden ließ, schwarz.
Während die Kinder, wenn sie singen, nicht mehr singen: Ist die Schwarze Köchin da? Ja - Ja - Ja!"35
Die Umsetzung eines solch atmosphärisch und inhaltlich dichten literarischen Werkes in einen Film ist fraglos schwierig. Volker Schlöndorff zeigt bei seinem Versuch aber sehr gute Ansätze. Zunächst mußte die komplexe Romanhandlung mit ihren vielen Verstrickungen und Nebenhandlungen gekürzt werden. Hierbei schafft es Schlöndorff, der das Drehbuch zusammen mit Jean- Claude Carriere und Franz Seitz36 mit Günter Grass` Segen, verfaßt hat, große Teile des Romans abzubilden. Dies gilt aber nur für die ersten beiden Bücher, da sich Schlöndorff dazu entschlossen hat, das dritte Buch, welches auch oft kritisiert wurde, auszusparen. Im Mittelpunkt des Filmes steht, genau wie im Roman, Oskars Leben in der Gesellschaft der Nazizeit. Weiterhin fehlt die Rahmenhandlung in der Heil- und Pflegeanstalt sowie die Episoden ,,Rasputin und das ABC", ,,Schaufenster", ,,Herbert Truczinskis Rücken", ,,Niobe", ,,Die Stäuber", ,,Das Krippenspiel" und Teile mehrerer anderer Kapitel, was aber nicht so bedeutend ist.
Die Auszeichnungen in Cannes und in Hollywood sind ein Indiz für die handwerkliche Perfektion, mit der der Film gemacht wurde. Die Verfilmung der Blechtrommel erhielt 1979 sowohl die ,,Goldene Palme" als auch den Oskar für den besten fremdsprachigen Film. Großen Anteil daran haben neben den exzellenten Schauspielern um David Bennent (Oskar Matzerath) und Mario Adorf (Alfred Matzerath) vor allem der Kameramann Igor Luther und Maurice Jarre, der die Musik beisteuerte. Die oft nebel- und rauchverhangenen Bilder geben mit der, manchmal etwas eigenwilligen Musik Jarres, die immer dann zu hören ist, wenn die Großmutter Anna Bronski im Bild ist und so wohl auf deren besondere Stellung als ruhender Pol hinweisen soll, eine ganz besondere Atmosphäre, die der trüben und trostlosen Zeit die richtige Untermalung gibt. Daneben geben einige gute Regieeinfälle dem Film die Form eines Kunstwerks. Auf die besondere Wahl der Kameraperspektive komme ich noch später zu sprechen, aber bemerkenswert ist auch die letzte Einstellung des Films: Die am Bahnhof zurückgebliebene Großmutter schaut dem Zug, in dem Oskar, Kurt und Maria sitzen und der Richtung Düsseldorf davonfährt, hinterher. Neben den in die Weite führenden Schienen, sitzt eine Person auf dem Acker vor einem rauchenden Kartoffelfeuer - eine ähnliche Situation wie am Anfang. Aufgrund der Tatsache, daß Schlöndorff das pessimistische dritte Buch mit der Grundhaltung, daß sich nichts verändert habe, wegläßt, kann man darauf schließen, daß der in die Weite führende Zug nicht ins Ungewisse, sondern in eine bessere Zukunft fährt und die Kaschuben immer an der gleichen Stelle warten, um Schutz zu geben, egal ob es ein von der Polizei verfolgter Brandstifter oder ein buckliger Gnom ist. Der Film endet also anders als das Buch in einer positiven Vision.
Ein weiteres großes Plus der Verfilmung ist die Darstellung der Gesellschaft und ihrer Lebensweise. Oskars Viertel, in dem er aufwächst, wurde komplett nachgebaut und zusätzlich durfte Schlöndorff an Originalschauplätzen drehen, was dem Film eine große Authentizität verleiht. Die Räume entsprechen ihrer Ausstattung nach haargenau der Schilderung Grass` und somit einer Kleinbürgerfamilie der damaligen Zeit: Von der Standuhr über den Volksempfänger bis hin zu den Bierflaschen paßt sich alles wunderschön in das vom Autor gezeichnete Bild ein. Die Detailtreue geht sogar soweit, daß Oskar eine blaue Marinemütze mit der Aufschrift ,,MSS Seydlitz" trägt, und der Sarg von Alfred Matzerath aus den im Buch beschriebenen Margarinekisten der Marke ,,Vitello" - im übrigen ein makaberer Scherz des Autors, da sich ,,Vitello" wohl auf ,,vital" bezieht und somit das Bild in krassem Gegensatz zur Wortbedeutung steht - besteht.
Diese sehr realistische Darstellung der Gesellschaft ist gleichzeitig auch ein Aspekt der präzisen Umsetzung der Romanvorlage. Nicht nur Grass selbst ist es zu verdanken, daß im Film ein Off- Sprecher auftritt, der oft große Teile aus dem Roman zitiert, sondern auch der Erkenntnis Schlöndorffs, daß so der imposante Erzählstil Grass` wenigstens teilweise gerettet werden könne. So wird also der erste Teil bis Oskars Geburt vornehmlich durch Oskar als Off- Sprecher geschildert, wobei sogar Nebenhandlungen, zum Beispiel die seines Großvaters Koljaiczek, erwähnt werden, was wieder der präzisen Romanvermittlung zu Gute kommt. Zusätzlich garantiert eine solche Schilderungsweise eine Ablenkung von den Bildern, die sonst bei einem Film im Mittelpunkt stehen, und versucht somit die epische Distanz zu vermitteln. Außerdem wird deutlich aus welcher Perspektive geschildert wird, weil ein so gearteter Erzähler Züge des autobiographischen Berichts erkennen läßt. Weiterhin gleicht Schlöndorff mit der Episodenhaftigkeit die fehlende epische Distanz, die sonst dem, eher der Dramatik angehörenden, Medium Film anhaftet, aus. Er bewahrt damit gleichzeitig die Vorgabe des Romans, der ja auch aus Episoden aufgebaut ist. Durch die häufigen Schnitte, die der Umblendung von einer Episode zur nächsten dienen, weiß der Zuschauer genau, daß er es hier trotz der realistischen Darstellung mit einer filmischen Erzählung zu tun hat und nicht mit einer Dokumentation. Wichtig bei der Adaption dieses literarischen Werkes ist auch die Umsetzung der Intention des Romans, die sich in Zeit-, Schelmen- und Bildungsroman aufspaltet. Die realistische Darstellung der Gesellschaft wurde oben schon erläutert. Dem Regisseur gelingt es also, diese erste Dimension des Romans weitgehend zu erfassen, da er auch Oskar als beobachtenden Trommler darstellt, der seine Welt von unten her betrachtet. Hierzu verwendet Schlöndorff eine besondere Kameraperspektive, bei der zwar nicht immer direkt von Oskars Blickwinkel heraus gefilmt wird, jedoch immer aus einer niedrigeren Position. Als bestes Beispiel hierfür dient Oskars Geburt, bei der die Welt - in diesem Fall der Geburtskanal und danach die Glühbirne mit dem Falter - direkt aus Oskars Sichtweise gezeigt wird. Die Ebene des Schelmenromans wird auch im Film dargestellt, da die meisten ausschlaggebenden Episoden, also zum Beispiel ,,Der Stundenplan", übernommen wurden. Die von Guillen geforderten skurrilen Figuren treten in Gestalt von Fräulein Spollenhauer und Schugger Leo auf und tragen zur satirischen Wirkung bei. Eine komische Situation ist auch die Zerschlagung einer Nazi- Veranstaltung, die gemäß dem Kapitel ,,Die Tribüne" gezeigt wird, und die verkorkste Weltanschauung der Nazis, die in den Massenveranstaltungen so eindrucksvoll propagiert wurde, bloßstellt. Hierbei wird auch Oskars infragestellende Haltung gegenüber der Welt gezeigt und somit ein weiterer Aspekt des Schelmenromans verwirklicht. Die Dimension des Bildungsromans ist ebenfalls in Ansätzen verwirklicht. Oskars erste Verweigerung des angebotenen Kolonialwarengeschäfts ist ebenso wie die Verweigerung des Wachstums und die letzte Verweigerung des Schuleintritts im Film dargestellt. Die Grausamkeit der Gesellschaft, in die sich Oskar eingliedern soll, zeigt sich auch im Verhalten der Kinder Oskar gegenüber. Da er ein Außenseiter ist, wird er gehänselt und malträtiert. Die Kinder werden in einer Szene auch als Fortsatz der Gesellschaft, der wohl am schlimmsten durch den Nationalsozialismus geprägt war, gezeigt: Nachdem ein Nazitrupp durch die Straße gezogen ist, laufen die Kinder in ähnlicher Marschmanier hinterher und singen das Lied von der Schwarzen Köchin, die ja ein Symbol des Schreckens und der Schuld ist. So wird gleichzeitig die Begeisterung der Kinder für das Nationalsozialistische Gehabe und der Schrecken, der von diesem ausgeht, deutlich gemacht.
Allerdings muß man als Kenner des Buches auch seine Forderungen an den Film zurückschrauben, da es Schlöndorff nicht gelingt, alle Ebenen des Romans restlos zu erfassen. Das liegt zum einen daran, daß das Medium Film andere Akzente setzt als ein Buch, zum anderen aber auch an den Machern des Drehbuchs und des Films. Bei der Kürzung des Romans fallen einige wichtige Aspekte der Romanintention heraus. Das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen wird im Film nicht ausreichend genug beleuchtet, da hier nur eine Szene in der ,,Herz- Jesu- Kirche" ausgeführt wird. Während Oskar im Roman zweifelsohne auch gegen Gott, sofern es überhaupt einen gibt, protestiert, bleibt es in der Verfilmung bei einer Passage aus dem Imitatio Christi Motiv. Oskar macht sich im Roman ständig über die Kirche und Gott lustig:
,,`Ach, Vaterunser, wir wissen ja, daß Du viel Kleingeld hast, daß Du uns gerne Karussell fahren läßt, daß es Dir Spaß macht, uns das Runde dieser Welt zu beweisen. Steck bitte Deine Börse ein, sag stop, halt, fertig, Feierabend, basta, aussteigen, Ladenschluß, stoi - es schwindelt uns armen Kinderchen [ ]`. Aber der liebe Gott, Vaterunser, Karussellbesitzer lächelte, wie es im Buche steht lies abermals eine Münze aus seiner Börse hüpfen [...]."37
Ähnliches findet sich im Kapitel ,,Glaube, Hoffnung, Liebe", in dem Oskar es möglich ist ,,mit den drei Wörtchen ,Glaube, Hoffnung, Liebe` wie ein Jongleur mit Flaschen umzugehen, so [...] daß die betreffenden Wörtchen ebenso leer sind wie die Flaschen des Gauklers38:
,,Leichtgläubigkeit, Hoffmannstropfen, Liebesperlen, Gutehoffnungshütte, Liebfrauenmilch, Gläubigerversammlung. Glaubst du, daß es morgen regnen wird?"39
Diese Weltauffassung, in der kein Platz für einen Gott ist, kann man in der Verfilmung nicht nachvollziehen. Weiterhin führt die Aussparung der Dialektik zwischen Rasputin und Goethe zu einer Verzerrung der Dimension des Bildungsromans. Da man nicht erkennen kann, daß Oskar eine Vereinigung dieser beiden Gegensätze nicht gelingt, kann man auch nicht zu dem Schluß kommen, Oskar stehe nicht mehr in der Tradition des deutschen Bildungsromans, welchem eine solche Vereinbarung noch gelungen wäre. Obwohl die Verweigerung der Eingliederung in die Gesellschaft auch im Film eingehend dargestellt wird, fehlt der mit dem Faschismus zusammenhängende Effekt der Schuldfrage und des damit verbundenen Verdrängungsprozesses im Nachkriegsdeutschland. Zwar bekennt sich Oskar auch in der Verfilmung zu seiner Schuld, doch wird nicht deutlich woraus sich diese entwickelt und welche Mittel zur Gewissensentlastung er anwendet. Für Oskar ist nämlich eine aktive Einmischung in die Vorkommnisse der Welt ausschlaggebend für das Aufladen einer Schuld. Aus diesem Grund entzieht er sich jeglicher Verantwortung und flüchtet sich in die Heil- und Pflegeanstalt. Oskar sieht in dieser Welt keinen Sinn und die Geschichte ist nur noch eine Bündelung sinnloser Ereignisse. Mit dieser Einstellung reduziert er seine Schuld auf ein Minimum, denn ,,wenn nichts in der Welt einen auch noch so geringen Sinn hat, dann sind alle Handlungen gleich gut und gleich böse, und die Idee der Schuld selbst büßt praktisch jede Relevanz ein."40 Aber was Oskar auch immer unternimmt, um der schuldanklagenden Schwarzen Köchin zu entfliehen, ist zum Scheitern verurteilt, da er sie letztendlich genau vor sich hat, wenn er die Anstalt verläßt. Und genau hier besteht die größte Schwäche des Films: Das Weglassen des dritten Buches. Ohne diesen Teil des Romans wird die zeitkritische Bedeutung desselben erheblich vermindert und seine Form als Kunstwerk zerstört. Die Wiederaufnahme des Wachstums 1945 hat ihre Ursache ganz sicher in der Beendigung des Zweiten Weltkrieges und der Zeit des Nationalsozialismus. Oskar versucht sich deswegen in die Gesellschaft einzugliedern, beziehungsweise einen Kompromiß mit ihr zu finden. Aber er versagt kläglich und wird als verrückter Trommler in die Irrenanstalt gesperrt, weil sich nichts verändert hat. In diesem ,,Scheitern [...] in einer Zeit des angeblichen allgemeinen Wohlergehens, [...], artikuliert sich Grass` unerbittliche Kritik am Deutschland der fünfziger Jahre."41
Das Fehlen einiger Aspekte der Intention des Werkes ist bei einem solch komplexen Roman sicher nicht ganz zu vermeiden. Viel schwerer wiegt dagegen die notwendige Auflösung des überragenden Erzählers zugunsten der Bilder. Grass` Erzähler berichtet in meist längeren, dem ,stream of consciousness` ähnlichen, Sätzen, die dann mit attributiven Häufungen, Partizipien und einem Bilderreichtum versehen sind, der in der deutschen Literaturgeschichte der jüngeren Vergangenheit seinesgleichen sucht:
,,Die tausend Bleche, die ich zum Schrott geworfen hatte, und das eine Blech, das auf dem Friedhof Saspe begraben lag, sie standen auf, erstanden aufs neue, feierten heil und ganz Auferstehung, ließen sich hören, füllten mich aus, trieben mich von der Bettkante hoch, zogen mich, nachdem ich Klepp um Entschuldigung und einen Moment Geduld gebeten hatte, aus dem Zimmer, rissen mich an der Milchglastür und Kammer der Schwester Dorothea vorbei - noch lag das halbverdeckte Viereck des Briefes auf den Korridordielen -, peitschten mich in mein Zimmer, ließen mir jene Trommel entgegenkommen, die mir der Maler Raskolnikoff geschenkt hatte, als er die Madonna 49 malte;[ ]"42
Ein damit verbundenes weiteres Problem mit dem sich der Film - vor allem in diesem Fall - auseinandersetzen muß, ist die kaum vorkommende wörtliche Rede. Der Form des autobiographischen Berichts und der markanten Sprache Oskars ist es nämlich zu verdanken, daß sich das Verhältnis zwischen direkter Rede und Erzähltem weit zugunsten der Berichterstattung verschiebt. Die wenigen Dialoge, die doch noch vorkommen und überwiegend im Dialekt verfaßt sind, wurden von den Drehbuchschreibern allerdings sehr gerne übernommen. Beinahe unverzeihlich ist die Tatsache, daß der Farbsymbolik zuwenig Bedeutung beigemessen wird. Der Roman strotzt nur so von vor sich gegenseitig kontrastierenden und beeinflussenden Farbgebungen, welche sich gleich zu Beginn abzeichnen:
,,Zugegeben: Ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt, mein Pfleger, der mich beobachtet, läßt mich kaum aus dem Auge; denn in der Tür ist ein Guckloch, und meines Pflegers Auge ist von jenem Braun, welches mich, den Blauäugigen, nicht durchschauen kann."43
Das ,,Durchschauen- können" hängt also von der jeweiligen Augenfarbe ab, die eine, ihr eigene, Qualität bezeichnet. Im Kampf der Farben verliert Brunos Braun gegen Oskars Blau. Die Farbsymbolik geht aber noch weiter und letztendlich reicht sie vom weißlackierten Anstaltsbett bis zur dunklen Gestalt der Schwarzen Köchin. Die Episode ,,Karfreitagskost" vereint fast alle Farbzusammenhänge und bei den folgenden Ausführungen halte ich mich an den Interpretationsversuch von Lore Ferguson. Die abscheuliche Aalszene wird nur noch als Farb- und Klangspiel wiedergegeben. Oskar versucht die weißen und doch unreinen Möwen zu verscheuchen, indem er sich mit seinem ,,weißen" Blech gegen ihr ,,Weiß" richtet. Er wirbelt ,,auf seinem weißem Lack gegen dieses Weiß[ ] Doch das half nichts, das machte die Möwen höchstens noch weißer"44. Der Film stellt diese Szene zwar auch dar, aber die eher grauen Möwen muß man im Hintergrund suchen, und auch die todbringende schwarze Farbe der Aale kommt nicht ausreichend zur Geltung. Nach dem Spaziergang versteckt sich Oskar im Schrank und lenkt seine Gedanken auf sein damaliges ,,Wunschbild", die Krankenschwester Inge, die rote, lebendige Wunden heilt. Diese verehrt er wegen dem körperlosen, reinen Weiß ihrer Schwesterntracht und dem Rot ihrer Rotkreuzbrosche:
,,Am sauberen gestärkten Weiß ihrer Schwesterntracht, am schwerelosen Gebilde, das sie als Haube trug, an einer schlichten, mit rotem Kreuz verzierten Brosche ruhten sich mein Blick und mein von Zeit zu Zeit gehetztes Trommlerherz aus."45
In diesen Gedanken versunken schläft Oskar ein und erlebt im Traum nochmals eine Farbenund Klangwelt, die mit unheilbringenden schwarzen, grünen und gelben Farben beginnt, aber wieder zur Weiß- Rot- Symbolik zurückkehrt. Oskar variiert die Bedeutung der Farben. Rot und Weiß stehen auch als Symbol für Polen und die Blechtrommel. Aber genauso enthalten sie auch erotische Tendenzen. In der Episode ,,Im Kleiderschrank" haben die schwarzen Lackgürtel Schwester Dorotheas, die die Aale repräsentieren, eine eindeutige erotische Ausrichtung und das Essen der weißen Spaghetti- ,,Geschlinge" mit dem roten ,,langen Wurm Tomatenmark"46 erinnert an ein Liebesmahl. Bis auf die Farbgebung der Trommel und der Augenfarbe Oskars, die aber bei Schlöndorff in keinem Bezug steht, kann die Verfilmung diese Farbsymboliken nicht transportieren. Weiterhin fehlen der auf Zelluloid gebannten Geschichte Oskars die Allegorien, die im Roman so deutlich hervortreten. Auf die verschiedenen sinnbildlichen Darstellungen bin ich oben schon eingegangen. Der letzte Punkt, den die Verfilmung zum Teil vermissen läßt, sind die Anspielungen, die sich überwiegend auf die historischen Verhältnisse beziehen:
,,Und ich suche das Land der Polen, das verloren ist, das noch nicht verloren ist. Andere sagen: bald verloren, schon verloren, wieder verloren. Hierzulande sucht man das Land der Polen neuerdings mit Krediten, mit der Leica, mit dem Kompaß, mit Radar, Wünschelruten und Delegierten, mit Humanismus, Oppositionsführern und Trachten einmottenden Landsmannschaften.[...] Verloren, noch nicht verloren, schon wieder verloren, an wen verloren, bald verloren, bereits verloren, Polen verloren, alles verloren, noch ist Polen nicht verloren.47 "
In scheinbar endlosen Reihungen findet Oskar immer wieder neue Assoziationen und Allusionen, die die bewegende Geschichte Polens, das mehrere Teilungen durch Fremdmächte über sich ergehen lassen mußte, widerspiegeln. Laut Oskar besteht aber noch Hoffnung für sein Land. Bei den im Film übernommenen Anspielungen wurde zwar vor allem der Protest gegen das Naziregime erfaßt, aber es fehlen zusätzlich zur Episode ,,Herbert Truczinskis Rücken" noch die Anspielungen des dritten Buches, in dem ja Oskar die Nachkriegsgesellschaft und ihren Verdrängungsprozeß in seiner einmaligen Sprache verurteilt. Diese eigenwillige und geniale Erzählweise wurde zwar auch teilweise durch den Off- Sprecher übernommen, aber was sind schon ein paar Passagen gegenüber fast 800 Seiten gedrucktes Wort?
Zum Abschluß ergibt sich nun noch die Frage, ob die Verfilmung eines literarischen Werkes denn jemals die gleichen Schwerpunkte erfassen kann, wie die Vorlage, und ob bei der Verneinung dieser Frage eine Umsetzung in das Medium Film überhaupt gerechtfertigt ist. Die vorangegangene Analyse hat gezeigt, daß ein Film niemals den gleichen künstlerischen Wert wie die Literaturvorlage erreichen kann. Das heißt aber nicht, daß er deswegen überhaupt keinen Wert erlangen kann - er ist auf eine andere Art und Weise wertvoll oder nicht. Das Medium Film stellt ganz andere Ansprüche und kann auch völlig andere Resultate vorzeigen. Eines bleibt aber für beide Genres gleich: die Forderung nach einem eigenständigen Kunstwerk. So hat die Verfilmung der Blechtrommel sicherlich ihren eigenen künstlerischen Anspruch, da sie eine eigene Interpretationsweise liefert. Hätte der Film nur die Handlung des Romans übernommen, so wäre ein Scheitern unvermeidlich gewesen, da sich ein solches Plagiat keine Existenzberechtigung verdient hat. Durch das Aussparen des dritten Buches verfälschen die Macher des Films zwar die Intention des Romans, aber sie schaffen eine neue Aussage; eine Aussage, die mehr den Überzeugungen der ausgehenden 70er Jahre entspricht, als die, die Grass 1959 seinem Roman zugrunde legte. Insofern ist diese Verfilmung also nicht nur gerechtfertigt, sondern auch erwünscht, weil sie neue Interpretationsansichten aufzeigt und damit gleichzeitig den Status des Romans als Jahrhundertwerk festigt, denn nur ein solches Werk ist interessant, das auch nach Jahren und Jahrzehnten die Gemüter der Menschen erregt, erheitert, vor allem aber zum Leben erweckt.
[...]
1 Detlef Krumme: G. Grass- Die Blechtrommel S.34/35
2 www.stateok.us_~odl_fyi_td62698htm
3 Lore Ferguson (S.7) zitiert ein Interview mit Günter Grass vom 14.11.1959
4 Grass, Die Blechtrommel S.23
5 Grass, Die Blechtrommel S.28
6 Grass, Die Blechtrommel S.777
7 Grass, Die Blechtrommel S.457
8 Grass, Die Blechtrommel S.52
9 Grass, Die Blechtrommel S.54/55
10 Grass, Die Blechtrommel S.47
11 Grass, Die Blechtrommel S.253ff
12 Grass, Die Blechtrommel S.47
13 Grass, Die Blechtrommel S.274
14 Grass, Die Blechtrommel S.532
15 Grass, Die Blechtrommel S.135
16 Grass, Die Blechtrommel S.230/231
17 Detlef Krumme: G. Grass- Die Blechtrommel S.52ff
18 Grass, Die Blechtrommel S.98
19 Detlef Krumme: G. Grass- Die Blechtrommel S.66
20 Grass, Die Blechtrommel S.52
21 Grass, Die Blechtrommel S.52
22 Grass, Die Blechtrommel S.54
23 Grass, Die Blechtrommel S.734/735
24 Grass, Die Blechtrommel S.78/79
25 Grass, Die Blechtrommel S.111/112
26 Detlef Krumme: G. Grass- Die Blechtrommel S.72
27 Grass, Die Blechtrommel S.769
28 Detlef Krumme: G. Grass- Die Blechtrommel S.74
29 Detlef Krumme: G. Grass- Die Blechtrommel S.74/75
30 Heinz Ide, zitiert nach: Detlef Krumme: G. Grass- Die Blechtrommel S.75
31 Manfred Durzak, zitiert nach: Detlef Krumme: G. Grass- Die Blechtrommel S.76
32 Detlef Krumme: G. Grass- Die Blechtrommel S.76
33 Georg Just, zitiert nach: Detlef Krumme: G. Grass- Die Blechtrommel S.77
34 G. Grass- Die Blechtrommel S.777
35 G. Grass- Die Blechtrommel S.779
36 www.kabel1.de/Filmlexikon
37 G. Grass- Die Blechtrommel S.542
38 Robert Leroy: Die Blechtrommel v. G. Grass - Eine Interpretation S.31
39 G. Grass- Die Blechtrommel S.261
40 Robert Leroy: Die Blechtrommel v. G. Grass - Eine Interpretation S.111
41 Robert Leroy: Die Blechtrommel v. G. Grass - Eine Interpretation S.153
42 G. Grass- Die Blechtrommel S.666
43 G. Grass- Die Blechtrommel, S.9
44 G. Grass- Die Blechtrommel, S.193
45 G. Grass- Die Blechtrommel, S.200
46 G. Grass- Die Blechtrommel, S.665
Häufig gestellte Fragen
Was ist "Die Blechtrommel" und worum geht es in dieser Analyse?
Diese Analyse befasst sich mit Günter Grass' Roman "Die Blechtrommel" und dessen Verfilmung durch Volker Schlöndorff. Sie untersucht die Intentionen des Romans, die Möglichkeiten und Probleme bei der Adaption eines literarischen Werkes für das Medium Film und bewertet die filmische Umsetzung.
Welche literarischen Einflüsse werden in der Analyse von "Die Blechtrommel" behandelt?
Die Analyse untersucht "Die Blechtrommel" unter verschiedenen literarischen Gesichtspunkten, darunter als realistischer Zeitroman, als Schelmenroman (Pikaroroman) und als Bildungsroman (oder dessen Travestie/Anti-Bildungsroman). Es wird untersucht, wie Grass diese verschiedenen Genres nutzt und modifiziert.
Welche historischen Bezüge und Allegorien werden in der Analyse des Romans identifiziert?
Die Analyse zeigt, dass der Roman Bezüge zur deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts aufweist, insbesondere zur Zeit des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit. Oskar selbst, sowie andere Charaktere und Ereignisse, werden als Allegorien für politische und gesellschaftliche Entwicklungen interpretiert.
Wie wird die Rolle des Erzählers Oskar Matzerath in der Analyse bewertet?
Oskar wird als unzuverlässiger Erzähler betrachtet, dessen Perspektive die Realität verzerrt. Seine Rolle als Außenseiter, seine Verweigerung des Wachstums und seine Trommel dienen als Mittel zur Beobachtung und Kommentierung der Gesellschaft.
Welche Aspekte der Verfilmung von "Die Blechtrommel" werden in der Analyse hervorgehoben?
Die Analyse lobt die handwerkliche Qualität des Films, die realistische Darstellung der Gesellschaft und den Versuch, die Romanvorlage präzise umzusetzen, beispielsweise durch den Einsatz eines Off-Sprechers. Es wird aber auch kritisiert, dass wichtige Passagen ausgelassen wurden und der Erzähler des Romans nicht adäquat im Film dargestellt werden konnte.
Welche Probleme entstehen bei der Verfilmung eines literarischen Werkes laut Analyse?
Die Analyse argumentiert, dass die Kürzung des Romans, der Verlust der komplexen Erzählweise und die Reduktion der Farbsymbolik dazu führen, dass der Film die Intentionen des Romans nicht vollständig erfassen kann.
Was ist die abschließende Bewertung der Verfilmung von "Die Blechtrommel"?
Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass der Film ein gelungenes Kunstwerk ist, das innerhalb der Grenzen des Mediums Film die Romanvorlage gut umsetzt. Es wird betont, dass die Verfilmung eine eigene Interpretationsweise bietet und somit den Status des Romans als Jahrhundertwerk festigt.
Welche Kritikpunkte werden am Ende des Textes angeführt?
Es wird bemängelt, dass einige Aspekte, insbesondere die Darstellung der Religionsfrage, des Bildungsromans und des Schuldmotivs nicht vollständig erfasst werden. Ebenfalls wird die fehlende Umsetzung der Farbsymbolik und der Anspielungen kritisiert.
Welche Fußnoten sind im Text zu finden?
Die Fußnoten verweisen auf verschiedene Quellen und Zitate, die in der Analyse verwendet werden. Dazu gehören Werke von Detlef Krumme, Lore Ferguson, Robert Leroy und Günter Grass selbst.
- Quote paper
- Christian Gärtner (Author), 1999, Möglichkeiten und Probleme der Verfilmung eines literarischen Werkes am Beispiel von Günter Grass "Die Blechtrommel", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98954