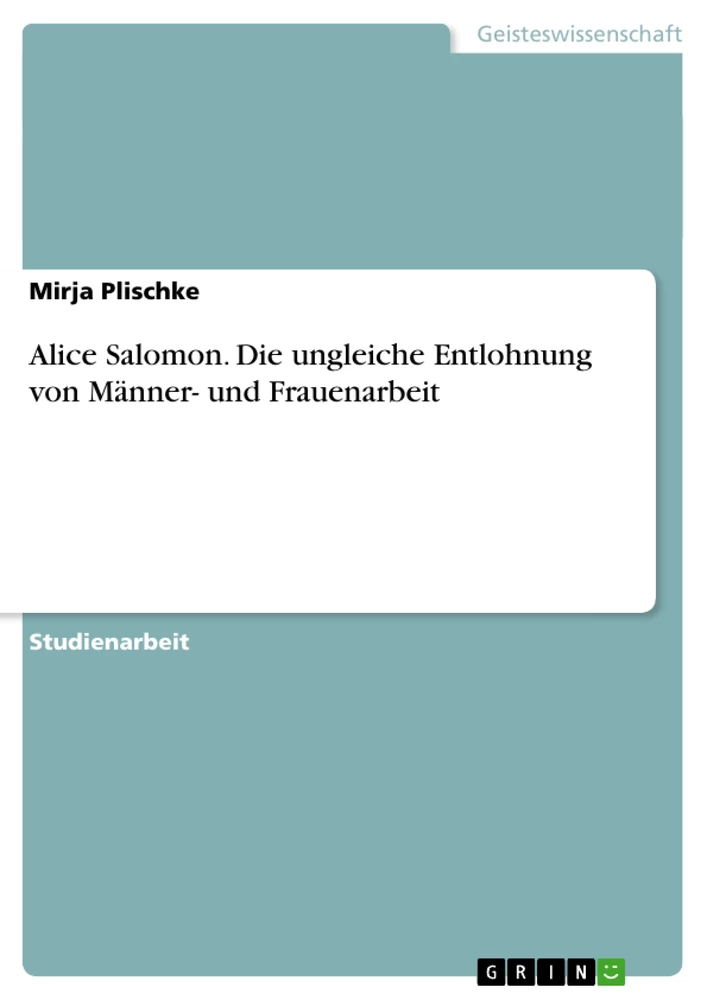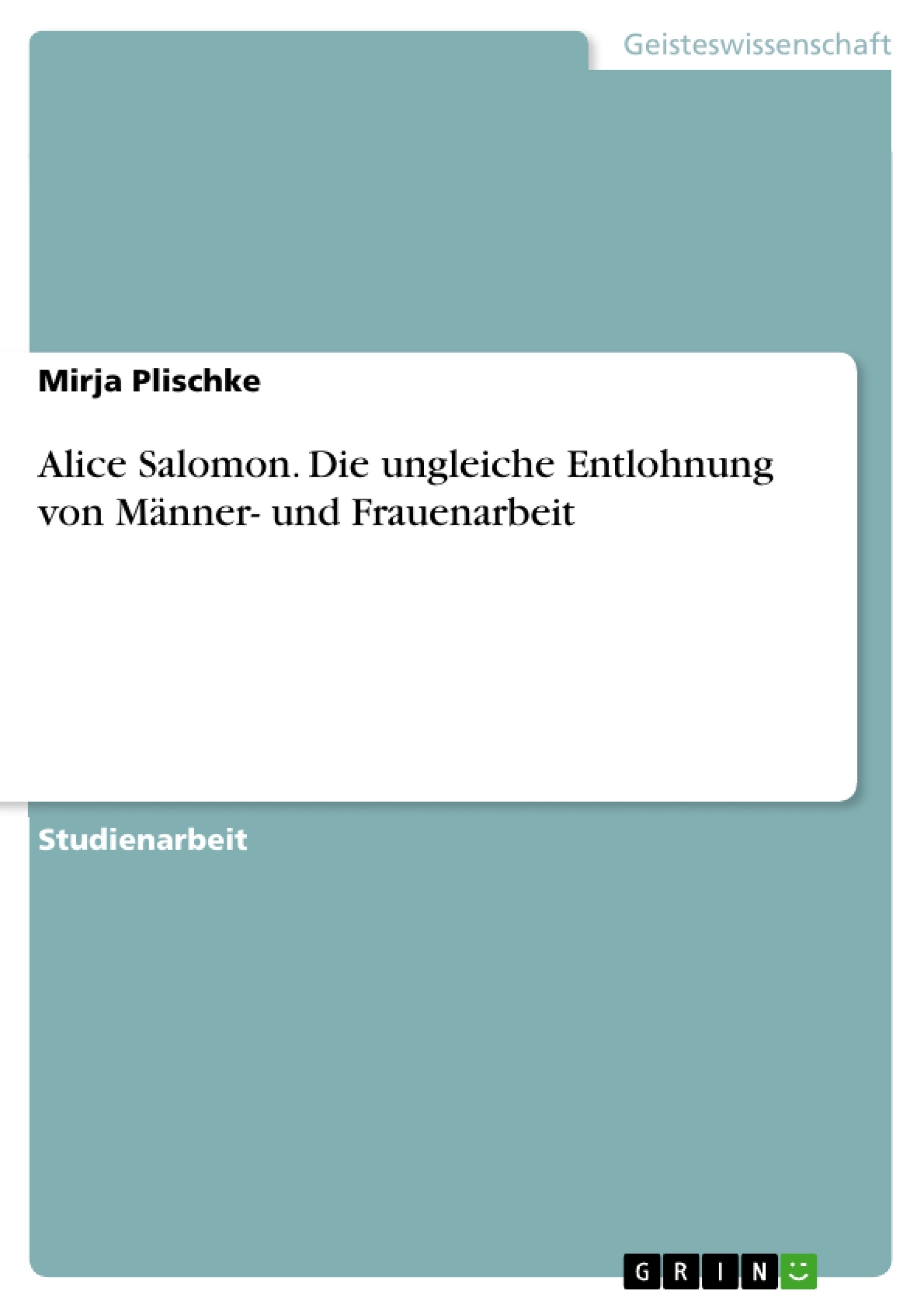Alice Salomon, Begründerin des sozialen Frauenberufs in Deutschland und Pionierin der Ausbildung zur Sozialarbeit, ist wohl kaum einem bekannt. Alice Salomon war eine der führenden Köpfe der Frauenbewegung ihrer Zeit, welche internationales Ansehen genoss und als eine der ersten Frauen in Deutschland promovierte. Sie und andere Frauen, die entscheidende soziologische Beiträge geliefert haben scheinen vergessen. Fassman (1996:296) sieht die Ursache im Nationalsozialismus. Er schreibt Alice Salomon sei von „den Nazis um ihre wohlverdiente Anerkennung und die Früchte ihrer Lebensarbeit” gebracht. Wie viele andere von den neu wiederentdeckten Soziologinnen ist auch sie jüdischer Herkunft und muss 1937 das Land verlassen. Doch sie scheint nicht völlig vergessen, denn im Jahr 1993, 45 Jahre nach ihrem Tod, wird die Berliner Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, für die sie den Grundstein legte, in „Alice- Salomon-Fachhochschule Berlin” umbenannt.
Im folgenden werde ich mich mit Alice Salomons Leben und ihrer Doktordissertation „Die Ursachen der ungleichen Entlohnung von Männer- und Frauenarbeit” befassen. Da mich besonders beeindruckt hat, wie viel Alice Salomon in ihrem Leben geleistet und was für eine Vielzahl an Projekten sie oftmals gleichzeitig bearbeitet hat, erscheint es mir wichtig ihre Biographie ausführlich zu beschreiben. Danach werde ich mit ihrer oben genannten Dissertation befassen und versuchen kurz aber präzise Thematik, Fragestellung, Methode, Argumentation und Schlussfolgerung darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biographie
- Kinder- und Jugendjahre
- Der Wendepunkt
- Studium und Promotion
- Soziale Frauenschule und internationales Engagement
- Ausweisung aus Deutschland und einsames Lebensende
- ,,Die Ursachen der ungleichen Entlohnung von Männer- und Frauenarbeit❞
- Inhalt, Methode und Ziel
- Schlussfolgerungen
- Ausblick
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Leben und der Arbeit der deutschen Soziologin Alice Salomon, einer bedeutenden Figur der Frauenbewegung im frühen 20. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf ihrer Dissertation „Die Ursachen der ungleichen Entlohnung von Männer- und Frauenarbeit”, in der sie die sozialen und ökonomischen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern untersucht. Die Arbeit beleuchtet Salomons Lebensweg, ihre zentralen Anliegen und die Relevanz ihrer Forschung für die heutige Zeit.
- Alice Salomons Leben und Wirken
- Die Rolle der Frauenbewegung in der deutschen Gesellschaft
- Soziale Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen
- Alice Salomons Beitrag zur Sozialarbeit
- Die Bedeutung von Salomons Werk für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Alice Salomon als eine einflussreiche Persönlichkeit in der Frauenbewegung des frühen 20. Jahrhunderts vor. Sie hebt ihre Pionierrolle in der Entwicklung der Sozialarbeit und ihre Bedeutung als eine der ersten Frauen, die in Deutschland promovierte, hervor. Der Fokus der Arbeit liegt auf Salomons Leben und ihrer Dissertation „Die Ursachen der ungleichen Entlohnung von Männer- und Frauenarbeit”.
Biographie
Kinder- und Jugendjahre
Dieser Abschnitt beleuchtet die frühen Lebensjahre von Alice Salomon, ihre Herkunftsfamilie und ihre Erfahrungen in der konservativen und patriarchalischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Die Beschreibung ihrer Schulzeit zeigt die eingeschränkten Bildungs- und Karrieremöglichkeiten für Frauen in dieser Zeit.
Der Wendepunkt
Die Begegnung mit der Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit stellt einen Wendepunkt in Salomons Leben dar. Sie engagiert sich zunehmend für soziale Anliegen und findet Anerkennung in der Frauenbewegung. Die Gründung des ersten Berliner Clubheims für Fabrikarbeiterinnen und die Einführung von Ausbildungskursen in der sozialen Arbeit unterstreichen ihr Engagement für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen.
Studium und Promotion
Alice Salomon beschließt, sich für Nationalökonomie an der Berliner Universität einzuschreiben. Ihre Entscheidung, trotz fehlender Vorbildung und ihrer sozialen Arbeit, zu studieren, ist Ausdruck ihres unbezwingbaren Strebens nach Bildung und Erkenntnis. Die Dissertation „Die Ursachen der ungleichen Entlohnung von Männer- und Frauenarbeit" wird ein zentrales Thema der Arbeit.
Schlüsselwörter
Alice Salomon, Frauenbewegung, Sozialarbeit, Soziologie, Geschlechterungleichheit, Arbeitsmarkt, Bildung, Dissertation, Frauenrechte, Soziale Arbeit, Feminismus, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Alice Salomon?
Alice Salomon war eine Pionierin der sozialen Arbeit in Deutschland, Begründerin des sozialen Frauenberufs und eine führende Persönlichkeit der Frauenbewegung.
Womit befasste sich Alice Salomons Dissertation?
Ihre Dissertation trug den Titel „Die Ursachen der ungleichen Entlohnung von Männer- und Frauenarbeit“ und untersuchte ökonomische Geschlechterungleichheiten.
Warum musste Alice Salomon Deutschland verlassen?
Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft wurde sie 1937 von den Nationalsozialisten aus Deutschland ausgewiesen und emigrierte in die USA.
Welchen Beitrag leistete sie zur Ausbildung in der Sozialarbeit?
Sie legte den Grundstein für die professionelle Ausbildung durch die Gründung der Sozialen Frauenschule in Berlin, die heute ihren Namen trägt.
Was war der „Wendepunkt“ in ihrem Leben?
Der Wendepunkt war ihre Begegnung mit Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit, was ihr lebenslanges Engagement für soziale Belange einleitete.
- Quote paper
- Mirja Plischke (Author), 2003, Alice Salomon. Die ungleiche Entlohnung von Männer- und Frauenarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9900