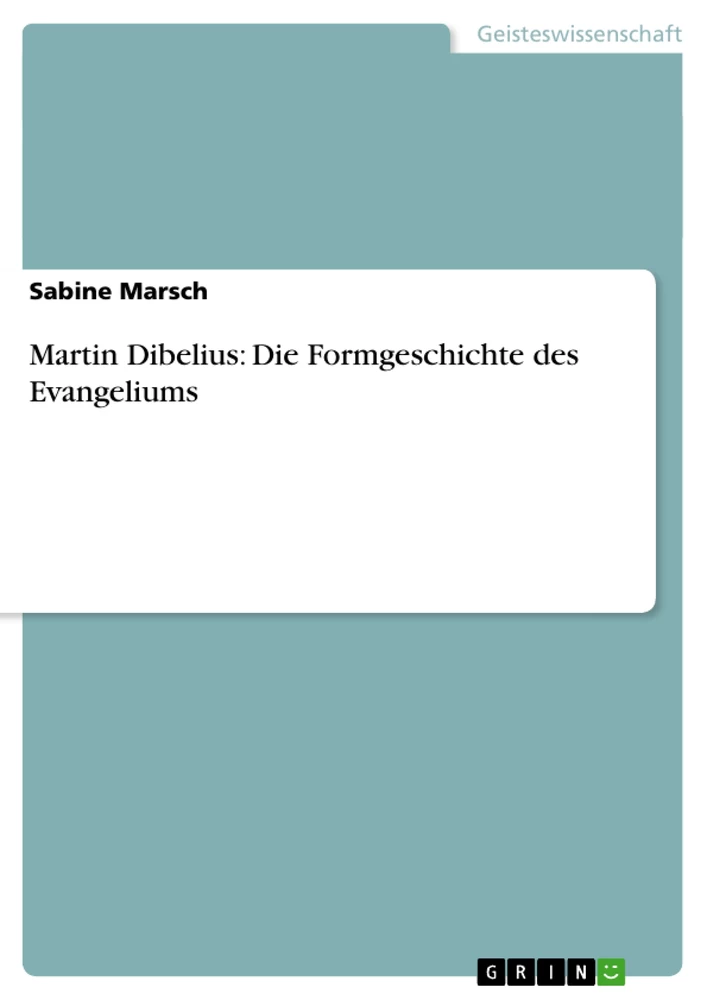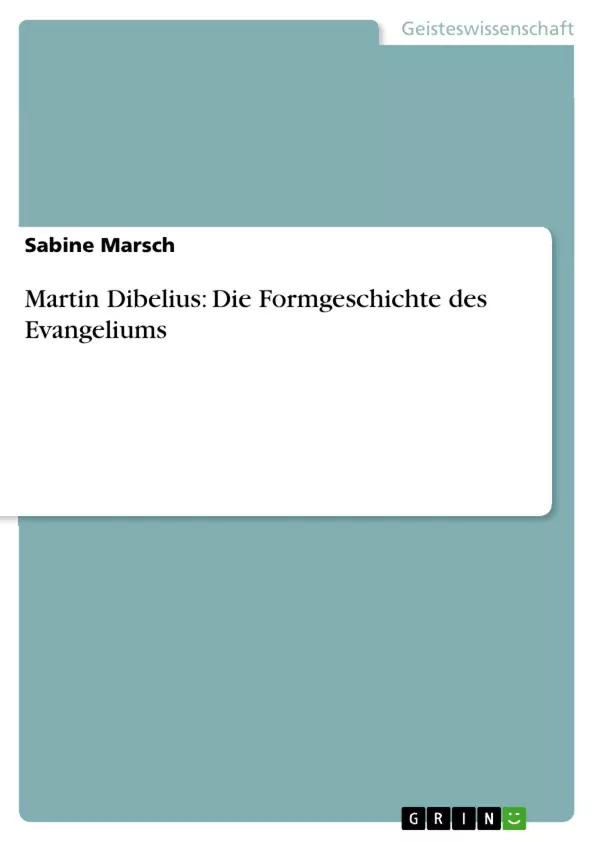Wie entstand das Neue Testament wirklich? Martin Dibelius' bahnbrechende "Formgeschichte des Evangeliums" nimmt uns mit auf eine faszinierende Reise in die Frühzeit des Christentums, als die Geschichten über Jesus von Mund zu Mund weitergegeben und schließlich in den Evangelien festgehalten wurden. Entdecken Sie, wie Dibelius die synoptischen Evangelien seziert und die einzelnen Erzählungen in ihre kleinsten Bestandteile zerlegt, um ihre ursprüngliche Form und ihren "Sitz im Leben" zu rekonstruieren. War es die Predigt, das Zeugnis oder gar die Legende, die diese Geschichten formte? Tauchen Sie ein in die Welt der Paradigmen, Novellen, Legenden und Mythen, die das Fundament der christlichen Überlieferung bilden. Erfahren Sie mehr über die subtilen Stilmerkmale, die jede Gattung prägen, von der erbaulichen Wortwahl bis hin zur detaillierten Schilderung von Wundern. Dibelius' Werk ist mehr als nur eine theologische Analyse; es ist eine fesselnde Detektivarbeit, die uns die Augen für die komplexen Prozesse öffnet, die zur Entstehung der Evangelien führten. Diese Neuauflage bietet eine unverzichtbare Einführung in die formgeschichtliche Methode und lädt dazu ein, die synoptische Überlieferung mit neuen Augen zu sehen. Lassen Sie sich von Dibelius' scharfsinnigen Beobachtungen und seiner Leidenschaft für die Erforschung der biblischen Texte begeistern und entdecken Sie die verborgenen Schichten der Evangelien. Werden Sie Zeuge, wie aus mündlichen Erzählungen und kleinen literarischen Formen die Grundlage des christlichen Glaubens entstand. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für Theologie, Geschichte und die Ursprünge des Christentums interessieren. Es bietet einen tiefen Einblick in die Arbeitsweise der Evangelisten und zeigt, wie sie Stoffe übernahmen, formten und zu einer neuen Botschaft zusammenfügten. Erforschen Sie die Bedeutung des "Sitzes im Leben" und verstehen Sie, wie die Bedürfnisse der frühen christlichen Gemeinde die Form der Evangelien prägten. Lassen Sie sich von Dibelius' wegweisender Forschung inspirieren und gewinnen Sie ein tieferes Verständnis für die Entstehung und Bedeutung der neutestamentlichen Schriften. Erleben Sie, wie die Formgeschichte uns hilft, die Evangelien nicht nur als historische Dokumente, sondern auch als lebendige Zeugnisse des Glaubens zu verstehen.
1. Biographie Martin Dibelius
- geboren: 14.September 1883 in Dresden
- gestorben: 11. November 1947 in Heidelberg
- Studium: Theologie und Philosophie in Leipzig, Tübingen und Berlin
- 1905: theologisches Examen in Leipzig, Doktor der Philosophie in Tübingen
- 1909: Habilitation in Berlin, bis 1915 Privatdozent an der Uni in Berlin
- 1915: Berufung nach Heidelberg; Lehrstuhl NT
- 1919: Dei Formgeschichte des Evangeliums, zweite stark erweiterte Auflage 1933
Der Theologe soll und will Glaubender sein, - und somit einseitig, leidenschaftlich, unkritisch; er soll und will Forscher sein, - und somit besonnen nach allen Seiten, kühl und kritisch. Der „Weg der Theologie“ erscheint so als „schmaler Pfad zwischen Abgründen auf beiden Seiten“, schrieb Dibelius 1941.
2. Verständnis von Formgeschichte:
Kleinliteratur ? keine „literarischen1 Werke“ = Traktate, Manuskripte...
Heute ist die Veröffentlichung solcher Kleinliteratur gut nachzuvollziehen, in der Antiken Welt war es schwieriger.
So wissen wir heute nicht mehr wann ein Paulusbrief, nach der wievielten Abschrift, er vom privaten Schriftstück in die beschränkte Öffentlichkeit der christlichen Gemeinde eintrat.
? synoptische Evangelien ? auf jeden Fall Kleinliteratur;
- können und wollen sich nicht mit „literarischen Werken“ messen; sind aber auch nicht nur private Niederschriften, sondern für eine kleine Öffentlichkeit bestimmt;
- die Verfasser sind mehr Sammler, Redaktoren... als Schriftsteller; sammeln, ordnen, überliefern des Materials, aber nicht ursprüngliche Formung des Stoffes
- Lukas? Apg.; Johannes-Evangelium: mehr Schriftsteller...
- Irrtum: Autoren und ihren Tendenzen eine großer Verantwortung für die Überlieferung zuzuschreiben..., literarische Freiheit
Keine Literatur, die durch den Willen der Schriftsteller geschaffen wird, sondern aus der Notwendigkeit hervorgeht (bei unliterarischen Menschen); eine soziologische Tatsache
Evangelisten übernahmen Stoff, der bereits geformt war, fügten kleine Einheiten zueinander, die vorher schon formale Geschlossenheit besaßen ? Formgeschichte kommt also hier zu ihrem Abschluss, vorher muss die Prägung der Texte geschehen sein.
Formgeschichte: Entstehung der kleinen Einheiten nachspüren und begreiflich machen, Typik herausarbeiten und dadurch zum Verständnis der Überlieferung gelangen.
Sammelgut auf die kleinsten wahrnehmbaren Formen der Überlieferung hin untersuchen, kleinste Einheiten = Gattungen;
Stil kennzeichnet Gattung: ob ein Verfasser Anhängerschaft gewinnen möchte kann man unter Umständen an Wortwahl, Satzbau, Einleitung, Ausleitung... erkennen. Gattung lässt einen Schluss auf den „Sitz im Leben“ hin zu.
3. Konzeption:
Formen der synoptischen2 Überlieferung:
A) Erzählungen:
„Sitz im Leben“: Predigt, Zeugnis zum Heil; tragende Bedeutung hat für die Predigt nur die Leidensgeschichte; Rest nur als anschauliche Bsp.
1. Paradigma:
z.B. Kindersegnung (Mk 10, 13-16)
Stilmerkmale:
- geschlossene Sinneinheiten; in sich verständlich (? Rundung); existierten ursprünglich schon als selbstständige Erzählungen;
- einfach erzählt, Details vor allem bei der Schilderung von Personen (? Portrait)
- Jesu Worte deutlich hervorgehoben, am Ende häufig ein „Chorschluss“ an Leser und Hörer
- erbaulicher Stil (Wortwahl)
(Bultmann rechnet Erzählungen, die Worte Jesu enthalten, zum Redestoff!)
2. Novelle:
z. B. Erzählung vom Besessenen und den Schweinen (Mk. 5,1ff) und Speisung der 5000 (Mk. 6,35ff)
Stilmerkmale:
- geschlossene Einzelgeschichten (wie Paradigmen), sind aber breiter angelegt
- mehr Details
Vergleichbar mit antiken Wundererzählungen ? Ziel: Jesus als Wundertäter hervorheben, besondere Technik bei Heilungen wird genau beschrieben.
? wahrscheinlich Erweiterungen von Paradigmen durch profane Motive (mehr der Welt zugewandt)
3. Legende:
z.B. Geschichte vom 12jährigen Jesus im Tempel, Kindheitsgeschichten
Stilmerkmale:
- Personallegende: wunderbare Geburt des Helden, Erkennung des Kindes als zukünftigen Retter, frühe geistige Reife... (entspricht Lebensbeschreibung vieler antiker Persönlichkeiten)
- stark erbaulichen Charakter, unterschied zum Paradigma: nicht die Botschaft der Tat steht im Vordergrund, sondern die Frömmigkeit und Heiligkeit des Helden
4. Mythus:
Taufe, Versuchung und Verklärung (keine weiteren Beispiele vorhanden!)
Stilmerkmale:
- Auftreten überirdischer Personen oder Erzählung eines überirdischen Vorgangs (Unterschied zum Mythus bei Bultmann!?)
5. Leidensgeschichte:
Stilmerkmale:
- feste Abfolge von Szenen (Verhaftung muss vor dem Verhör geschehen...), entspricht dem christologischen Kerygma (1.Kor.15)
Nach Dibelius hat die Leidengeschichte unmittelbaren Heilsinn, keine Berichterstattung sondern Verkündigung
B) Paränese (Lehre Jesu)
[...]
- Arbeit zitieren
- Sabine Marsch (Autor:in), 2001, Martin Dibelius: Die Formgeschichte des Evangeliums, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99002