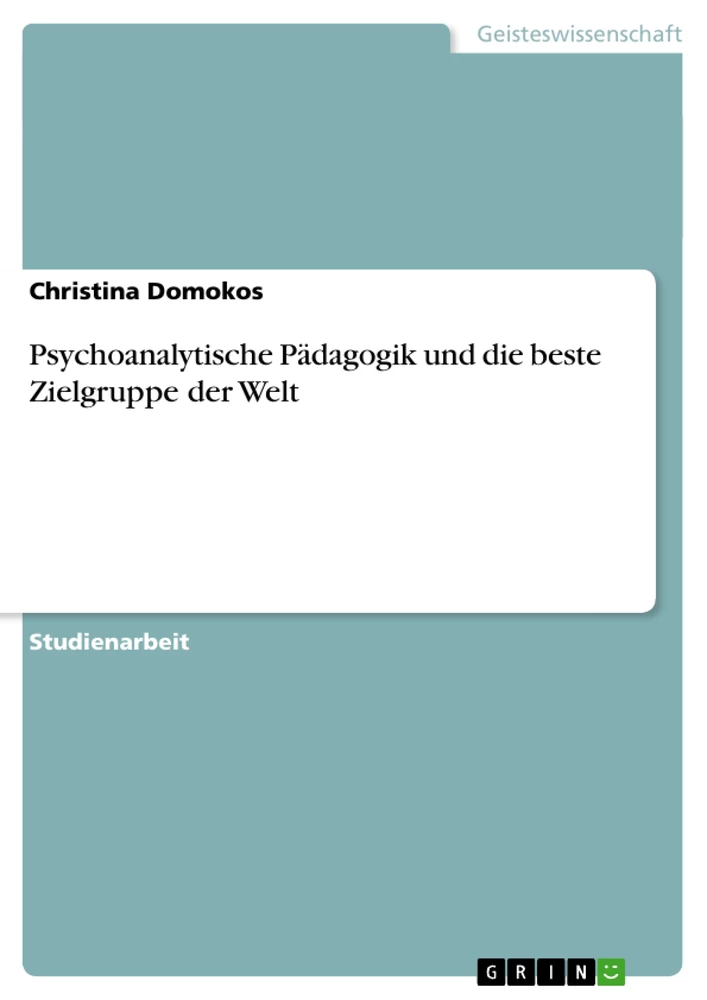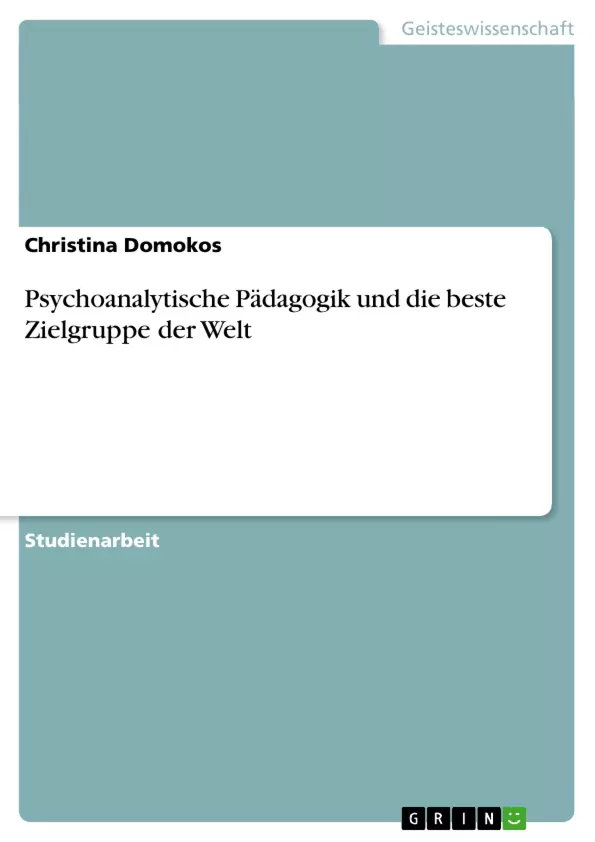1. EINLEITUNG
Nachdem wir das Zitat: ,,Die Absicht, dass der Mensch ,glücklich ’ sei, ist im Plan der ,Schöpfung ‘ nicht enthalten “1, in einer von Freuds Publikationen lasen, interessierte es uns, wie trotz des zugrundeliegenden pessimistischen Menschenbildes (des polymorph perversen Wesens) eine letztendlich facettenreiche Pädagogik -die psychoanalytische Pädagogik- entstehen konnte.
Der Leser erfährt zunächst Inhalte und Grundstruktur der psychoanalyischen Theorie und folgend Auffassungen und Zusammenhänge der psychoanalytisch orientierte Pädagogik.
Während unserer Nachforschungen versuchten wir, die speziell psychoanalytisch-pädagogischen Erklärungsansätze zu Fragen der Erziehung auf ein aktuelles Thema zu beziehen (in kurzer Form), um die ,,alten“ Erkenntisse, deren Ursprung im Wien der Kaiserzeit lag, einmal aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen.
Unserer Auffassung nach stellt der Themenkomplex -Werbung und Kinder- ein typisches Phänomen unserer Zeit dar, da Kinder ganz selbstverständlich mit Medien aufwachsen und sie in ihren Alltag integrieren. In einigen Ländern der EU beispielsweise, ist Werbung in staatlichen Grund- und weiterführenden Schulen üblich, um zur finanziellen Unterstützung für Bildungsmaßnahmen beizutragen. Die Werbung müsse dabei jedoch einer gewissen Ethik unterliegen, meinen Kritiker. Dieses aktuelle Beispiel zeigt einmal mehr die Brisanz und Emotionalität, mit der diese Diskussion geführt wird.
Werbung hin- Werbung her
Welche Sichtweise könnte nun die psychoanalytische Pädagogik dafür bereit halten und was gibt es überhaupt über diesen erziehungswissenschaftlichen Zweig zu sagen?
2. EINFÜHRUNG IN DIE PSYCHOANALYTISCH ORIENTIERTE PÄDAGOGIK
Die psychoanalytische Pädagogik zeigt, was man mit den wichtigsten Grundannahmen der Psychoanalyse tun kann, um Erziehung nutzbar und wirksam zu machen.
Erste Kontakte zwischen Psychoanalyse und Pädagogik gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie stießen aufgrund Freud`s Annahme des Unbewußten, seiner These der frühkindlichen Sexualität, sowie damit verbundener Gesellschaftskritik, auf erheblichen Widerstand. Trotzdem setzten sich einzelne Vorkämpfer (siehe dazu Anhang -Pioniere psychoanalytischer Pädagogik- ). in ihrer Arbeit intensiv mit oben genannter Verbindung auseinander und ermöglichten so die Weiterentwicklung.:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten2 3
Psychoanalytische Pädagogik sei jedoch, nach Auffassung Figdors noch keine Wissenschaft im eigentlichen Sinne, da sich ihre Vertreter bislang nicht über gemeinsame Theorien und Methoden geeinigt haben.4 Die Kontroverse diskutiert das Verhältnis zwischen Psychoanalyse auf der einen und Pädagogik auf der anderen Seite. Anhänger, die die Möglichkeit gemeinsamer Praxisformen betonen, verweisen unter anderem auf Freud selbst, der in seinem Vorwort zu Aichhorn schrieb: ,,Das Kind ist das hauptsächliche Objekt der psychoanalytischen Forschung geworden; es hat in dieser Bedeutung den Neurotiker abgelöst[...]. “ 5
Trescher beispielsweise, sieht die psychoanalytische Therapie, genauso wie die psychoanalytische Pädagogik als mögliche Anwendungsfelder der Psychoanalyse an, wobei Bittner die mögliche Existenz einer eigenständigen psychoanalytischen Pädagogik, aufgrund ihrer potenziellen weltanschaulichen Gebundenheit, verneint.6 Für eine deutliche Abgrenzung zwischen Psychoanalyse und Pädagogik plädieren Vertreter beider Seiten.:
Fatke weißt im Interesse der Pädagogik darauf hin, dass die Psychoanalyse der Pädagogik nur bis zu einem gewissen Grad dienen könne und sich die Pädagogik aus sich selbst heraus bestimmen müsse. Er befürchtet theoretische Verluste innerhalb der Pädagogik, auf Kosten ihres Selbstverständnisses. Körner verweist auf die Unteilbarkeit der Psychoanalyse, indem er die Zusammengehörigkeit von setting (d. h. das äußere Arrangement, der Arbeitsvertrag, die zeitliche Regel- mäßigkeit und Begrenzung, die Motivation des Patienten, die freie Assoziation, die Abstinenzregel, die Diskretion des Analytikers) zur Psychoanalyse betont. Die einzige Kooperationsmöglichkeit zwischen beiden Disziplinen sieht er in der analytischen Supervision mit Pädagogen.7
Sowohl Vertreter der Psychoanalyse, als auch der Pädagogik, sind sich trotz anhaltender Diskussion über das Verhältnis beider Wissenschaften darüber einig, das eine gegenseitige Relevanz für beide Gebiete nicht zu leugnen ist.
2.1. Theorie der Psychoanalyse
Die Psychoanalyse ist eine empirische Wissenschaft, die von Sigmund Freud (1856-1939), der noch heute als ,,Vater der Psychoanalyse“ gilt, begründet worden ist. Der Beginn ihrer Entwicklung erstreckte sich über mehrere Jahre, datiert wird er jedoch um circa 1895.
Die Psychoanalyse führt zur Entstehung verschiedener Theorien, die aus Beobachtungsdaten abgeleitet sind und diese versuchen zu erklären. Es ist somit eine hermeneutisch, rekonstruierende Vorgehensweise. Brenner bezeichnet die psychoanalytische Theorie als,: ,,ein System von Hypothesenüber die Funktionsweise und Entwicklung der menschlichen Psyche “8.
Da die Rekonstruktion menschlicher Lebensgeschichte, aufgrund ihrer komplexen, subjektiven Zusammenhänge, nie einem objektiven Wahrheitsgehalt entsprechen kann, schrumpft die Objektivität zu größerer oder kleinerer Wahr- scheinlichkeit. Das subjektive Erleben eines Menschen steht eindeutig im Vordergrund.
Die Überlegungen der Psychoanalyse lassen sich in Grundannahmen und Modellvorstellungen unterteilen:
Zwei der fundamentalsten Hypothesen sprechen vom ,, Prinzip der psychischen Determiniertheit “ 9, d. h. die Annahme, dass psychische Vorgänge ausschließlich in Sinnzusammenhängen stattfinden und so keine psychische Diskontinuität herrsche, bzw. nichts zufällig geschehe. Aktuelles werde durch Voran- gegangenes determiniert. Die Psychoanalyse geht vom Wirken und Bestehen unbewußter psychischer Inhalte aus.10 Damit beschreibt sie menschliches Erleben nicht ausschließlich als bewußtes Tun, sondern nimmt an, dass unbewußte oder unbewußt gewordene Erfahrungen, Ängste und Wünsche das aktuelle Verhalten mitbestimmen.
Ziel der Psychoanalyse ist es, durch unterschiedliche Methoden und Vorgehensweisen diesen unbewußten Teil des Seelenlebens aufzudecken und somit aufgetretene Störungen und Krankheiten aufzuspüren und zu klären.
Neben den beiden genannten Grundannahmen, sollen nun die Modellvorstellungen der Psychoanalyse kurz erläutert werden.
Der Psychische Apparat
Freud versucht, die Vorgänge der menschlichen Psyche mit Hilfe des topo- graphischen Modells zu erklären. Er unterscheidet drei Gruppen psychischer Vorgänge: Das System Ubw (Unbewußt), wobei diese Vorgänge aktiv vom Bewußtsein ausgesperrt seien; das Vbw (Vorbewußte), dabei können die Inhalte durch Aufmerksamkeitsprozesse bewußt gemacht werden und das System Bw (Bewußt), welches bewußtes Erleben meint. Später ergänzt er diese Über- legungen durch das STRUKTURELLE PERSÖNLICHKEITSMODELL: Hier unterscheidet er drei Instanzen, die psychodynamisch miteinander verbunden sind und sowohl bewußte, als auch unbewußte Anteile enthalten.
Das ES als die elementarste Schicht und vorerst einzige Instanz bei Säuglingen, beinhaltet alles: ,,[...] was geerbt, bei Geburt mitgebracht und konstitutionell festgelegt ist. “ 11 In ihm sind sexuelle und aggressive Impulse und vor allem körperliche Bedürfnisse verankert. Es ist während des ganzen Lebens die Instanz, die ohne Rücksicht auf Verluste auf Lustgewinn und Bedürfnisbe- friedigung drängt. Das ES handelt nach dem Lustprinzip und ist relativ umweltunabhängig. In ihm herrschen keine logischen Denkgesetze oder Zeit- strukturen. Gegensätzliche Regelungen können nebeneinander existieren.
Ab dem sechsten Lebensmonat differenziert sich aus dem ES das ICH heraus. Das ICH enthält alle organisierenden, integrativen und systemischen Funktionen der menschlichen Psyche. Es ist Garant dafür, dass das Realitätsprinzip Regulator des seelischen Lebens ist. Das ICH wird als Organ der Anpassung bezeichnet. Bei der Bewältigung dieser Aufgabe helfen ihm die ICH-Funk- tionen. So gehören die Motorik, die Wahrnehmung, das Lernen und Denken, das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit, die Affekte, die Urteilsfähigkeit und das rationale Handeln zu den ,,Hilfseinrichtungen“ des ICHs.12 Es vermittelt zwischen den basalen Bedürfnissen des ES und den normativen Werten des
ÜBER-ICHs unter Berücksichtigung der Realität. Es handelt also nach dem Realitätsprinzip.
Die von Anna Freud systematisch beschriebenen Abwehrmechanismen benutzt das ICH um unlustvolle Gefühle, Affekte und Wahrnehmungen vom Bewußtsein fernzuhalten. Diese Vorgänge laufen unbewußt ab, sind aber bei jedem Menschen zu finden. Werden diese Mechanismen zur Bewältigung von Problemen ständig eingesetzt, verliert der Betreffende mit der Zeit den Zugang zu seiner seelischen Erlebniswelt, was Ausgangspunkt zu einer seelischen Fehlentwicklung sein kann. Jede Person benutzt einige wenige, aufeinander abgestimmte, Abwehrmechanismen. Im Folgenden werden die wichtigsten Abwehrmechanismen kurz genannt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das ÜBER-ICH beginnt sich ab dem fünften Lebensjahr zu differenzieren. Während das Kind bis dahin von außen durch Ge- und Verbote gesteuert wurde, übernimmt es jetzt die elterlichen Normen und Verhaltensregeln in die eigene Psyche13. Diesen Vorgang bezeichnet die Psychoanalyse als -Internalisierung-. Das ÜBER-ICH ist somit intrapsychischer Vertreter der Beziehungen und spielt beim Aufbau der Identifikationsvorgänge eine wichtige Rolle. Aber darüber hinaus werden auch soziokulturelle Aspekte vermittelt, denn soziale Milieus, Kulturen und Traditionen werden so übernommen und weitergegeben. Das ÜBER-ICH nimmt also die Funktionen des Gewissens, der Selbstbeobachtung und der Idealbildung wahr. Es handelt nach dem Moralitätsprinzip.
Die Strukturierung des psychischen Organismus kann nicht konfliktfrei verlaufen, zu vielfältig sind die Anforderungen von innerer und äußerer Realität. Hervorgerufen wird ein Konflikt, ,,durch mindestens zwei einander wider- strebender Tendenzen. “ 14 Durch normale Konflikte lernt das Kind Grenzen kennen, sie sind wichtig zur Selbst-Objekt-Differenzierung, d. h. das den Wünschen anderer Personen, auch Rechnung getragen werden sollte. Dagegen kann eine rigide und nicht kindgerechte Erziehungsweise im späteren Erwachsenenalter, bei entsprechend aktuellen Konflikten zu einer Vielzahl neurotischer Erkrankungen führen.
Die Trieblehre
Die Psychoanalyse begreift die Triebe als ,,Energieversorger“ und ,,Antriebe“ der Psyche. Es wird zwischen Triebquelle, Triebobjekt und Triebziel unterschieden.
Die Triebquelle meint den somatischen Ursprung, z. B. die Hormone die in diesem Zusammenhang mitwirken. Das Triebobjekt kann dabei variabel sein. Es kann sich dabei sowohl um Lebewesen, als auch um Gegenstände handeln. (die geliebte Mutter, oder das Kuscheltier.) Das Triebziel bildet der Spannungsabbau.15
Der Zustand psychischer Erregung bzw. Spannung treibt das Individuum zum Tätigwerden an. Diese Aktivität soll zu Befriedigung und damit zu Entspannung führen. Da diese nicht dauerhaft sein kann, beginnt der Kreislauf erneut. Vom Individuum wird eine unmittelbare Triebbefriedigung angestrebt, die nach dem Lustprinzip aufgelöst werden soll. Da dies oft im Widerspruch zum Realitätsprinzip steht, muß das ICH die Triebbefriedigung auf entsprechend andere Aktivitäten umleiten. So versteht Freud die Kultur und Gesellschaft als ,,Triebunterdrücker“. Jedoch ohne diese Zäsur, wäre ein Umleiten der Energie auf Tätigkeiten wie Lernen und Arbeiten nicht nötig und so die Schaffung und Aufrechterhaltung der menschlichen Kultur nicht sichergestellt.:
,,Die Kultur, die Gesellschaft, wird von Freud [ ... ] als eine von außen auf den Menschen einwirkende Gegebenheit gesehen, die vor allem Triebunterdrückung produziert. Auf diese Weise stehen sich Gesellschaftlichkeit (,,Kultur “ ) und biologische Natur des Menschen (,,Triebe “ ) unversöhnlich gegenüber. “ 16 Freud versuchte die Vielzahl der möglichen Triebe auf einige wenige Grundtriebe zu minimieren. Dabei unterschied er die Ur/Grundtriebe EROS (Sexualtrieb) und DESTRUKTIONSTRIEB (Aggressionstrieb).: ,, Ziel des ersten ist, immer gr öß ere Einheiten herzustellen und so zu erhalten, also Bindung, das Ziel des anderen im Gegenteil, Zusammenhänge aufzulösen und so die Dinge zu zerstören. “ 17 Diese beiden Triebe kommen nie getrennt, sondern immer in einem Mischverhältnis vor. Das eine ist im anderen enthalten. Die beiden angenommenen Grundtriebe, machen die Existenz zweier dazugehöriger psychischer Energien notwendig. Beim Sexualtrieb spricht man von LIBIDO. Der Aggressionstrieb hat keine spezielle Bezeichnung.
Das Phasenmodell
Die psychoanalytische Entwicklungspsychologie hat ihre Phaseneinteilung an biologisch vorgegebenen Reifungsstufen des Sexualtriebs orientiert. Daran gekoppelt sind verschiedene Bedürfnisse wie Abhängigkeits- und Autonomie- bedürfnisse, sexuelle, aggressive, und narzistische Bedürfnisse18. Während bestimmter Reifungsphasen nehmen diese Triebansprüche besondere Bedeutung ein und werden im Idealfall mit angemessenen Angeboten der Bezugspersonen beantwortet. Der fortschreitende Reifungsprozess hat demnach eine Veränderung der Triebwünsche zur Folge.
- DIE ORALE PHASE
Das erste Vierteljahr wird in der Psychoanalyse als die Dualunion oder Mutter- Kind-Einheit bezeichnet. Der Mund ist während dieser Zeit das zentrale Lustorgan
- DIE ANALE PHASE
Die mit dem zweiten Lebensjahr beginnende anale Phase, hat als Elementarbefriedigung die Entleerung von Stuhl und Urin.
- DIE INFANTIL-GENITALE PHASE
Die dritte Phase, die etwa das dritte bis fünfte Lebensjahr umfaßt, wird als die phallische, oder die infantil-genitale Phase bezeichnet. Die Geschlechtsteile, also Penis oder Klitoris werden libidinös besetzt.
- LATENZZEIT
Während der Latenzzeit (6.-12. Lebensjahr) findet eine deutliche Verlangsamung der Triebentwicklung statt: Neue erogene Zonen werden nicht aktiviert. Da dieses Entwicklungsstadium nicht unmittelbarer Gegenstand der Hausarbeit sein wird, gehen wir nicht näher darauf ein.
2.2. Grundsätze psychoanalytischer Pädagogik
Aus den Grundannahmen der Psychoanalyse lassen sich verschiedene erziehungsrelevante Elemente ableiten.:
Aufgrund der unbewußten Anteile des menschlichen Seelenlebens ist es besonders in pädagogischen Berufen ratsam, vorbewußte Anteile der eigenen Person und eigene Reaktions- und Verhaltensweisen aufzudecken, um eine weitgehend unbelastete Interaktion zu ermöglichen. Das Wissen über die eigene Persönlichkeit, verbunden mit der Durcharbeitung eigener Konflikte, schafft gute Voraussetzungen dafür, andere als selbständige Personen anzuerkennen und empathiefähig zu sein. Erst die daraus entstehende Fähigkeit zur Selbstkontrolle ermöglicht, das Wissen von Übertragung und Gegenübertragung zu berück- sichtigen. Im therapeutischen Bereich wird es als eigene Methode angewandt, im Rahmen der Pädagogik, sollte dieses Wissen Beachtung finden: Die Tatsache, dass schon Kinder unbewußte Gefühle auf ihre Bezugsperson übertragen, sollte z. B. eine Betreuerin beachten, wenn sie in bestimmten Situationen von einem Kind wie dessen Mutter behandelt wird. Somit bietet die Psychoanalyse nach Bittner eine ,,Verstehenslehre, die dem Erzieher hilft, sich in das kindliche Seelenleben hineinzuversetzen. “ 19
Aufgrund der Internalisierungsprozesse durch das ÜBER-ICH, betont die psychoanalytische Pädagogik besonders die Wichtigkeit der Vorbildfunktion, welche alle Bezugspersonen eines Kindes innehaben. Sie sollten deshalb darauf achten, ihre eigenes ICH-IDEAL nicht bedingungslos auf die Kinder zu übertragen, um narzistische Projektionen und damit verbundene Fehleinschätzungen und Überforderungen zu verhindern. Eltern sollten sich ihrer Interaktion bewußt werden (wie oben erwähnt) und so auch durch ihre Kinder lernen, welche oft die Verhaltensweisen ihrer Eltern ausagieren.
Während der ödipalen Situation kommt der Beziehung des Kindes zum gegengeschlechtlichen Elternteil (bzw. Bezugsperson) eine große Bedeutung zu: Durch die Sensibilisierung der Eltern wird mehr ,,Ödipus-Wachsamkeit“ möglich, jetzt soll darauf geachtet werden, dass die Beziehung zu beiden Elternteilen (Bezugspersonen) gleichmäßig stabil bleibt. Geißler/ Hege gehen davon aus, dass sich anhand bestimmter Umweltkonstellationen spezifische Symptome ableiten lassen:20 Der Familienatmosphäre kommt so besondere Bedeutung zu, da sich hier permanent die direkte Verantwortung am Kind ausdrückt.
Die erste Verbindung zur Außenwelt erfährt das Neugeborene, in der oralen Phase, durch die Mutter: Diese Mutter-Kind-Dyade zeigt, im Regelfall, die starke Bezogenheit auf das Kind seitens der Mutter und die große Abhängigkeit des Kindes von der Mutter. Diese Zeit erinnert an eine verlängerte Schwangerschaft unter neuen Bedingungen. Der lange angenommene Allmachtsgedanke des Säuglings, der primäre Narzismus, ist eher unwahrscheinlich.21 Das Baby kann zwar noch nicht zwischen Objekt und einem Selbst unterscheiden, aber es kann durch verschiedene Sinnesorgane Wahrnehmungen zuordnen. So erkennt es z. B. die Stimme der Mutter und ihre Art der Berührungen, darüber sollte sich die Bezugsperson bewußt sein.
Wie schnell diese Differenzierungen stattfinden, hängt wesentlich von den Angeboten der Umgebung ab: Je vielfältiger die Wahrnehmungsangebote sind, desto schneller vernetzen sich die Nervenzellen des Gehirns miteinander und fördern eine positive Entwicklung. Während der Mutter-Kind-Dyade, als zweite ,,Intraphase“ innerhalb der Oralität, kristallisiert sich ein erstes (vollständiges) Gegenüber heraus. Es ist der Beginn der sozialen Beziehungen. Im ersten Lebensjahr sind körperliche Grundbedürfnisse entscheidend. Das Kind bezieht den Lustgewinn vor allem durch das Saugen. Der Mund ist damit die leitende erogene Zone in dieser Zeit. Damit kann auch eine erste Klassifikation der Welt in rauhe, glatte, gut und schlecht schmeckende Gegenstände stattfinden. Durch weitere Differenzierungen wird die Lust am Mund eine Lust am Essen und Trinken. Die Befriedigung dieser Bedürfniserlebnisse ist für die positive Basis des Selbst-, und Körperbildes wichtig. Dem Kind muss erst ein Sicherheits- erleben von außen (durch die Bezugspersonen) gegeben werden, bevor es selbst eine sicherheitsgebende Innenpräsenz zur Verfügung hat. Das Kind baut somit ein Bild seiner Bezugspersonen in sich auf, welches den Kern des ersten Bildes seiner Selbst darstellen wird. Erikson bezeichnet die Aufgabe dieser ersten Phase als das erfolgreiche Aufbauen eines Urvertrauens22, denn nur so kann das Kind einen hilfreichen Grundoptimismus entwickeln.
Die Leitzone verschiebt sich in der analen Phase vom Mund und Verdauungstakt hin zu Enddarm und After.23 Diese Veränderung findet aufgrund der biolog- ischen Reifung statt. Das Kleinkind ist jetzt dazu in der Lage, seinen Stuhlgang zu kontrollieren; durch die neu gewonnenen motorischen Fähigkeiten kann es sich der Umwelt aktiv zuwenden oder verweigern. Um ein positives Selbstbild zu schaffen, muss auch der Stuhl des Kindes als positiv betrachtet werden. Erikson bezeichnete diese Phase des Erlebens als -Loslassen und Festhalten-, bzw. als Autonomieerleben gegen Scham und Zweifel.24 Diese eben genannten Schwierigkeiten treten aufgrund der veränderten Beziehungsstruktur auf. Für die Beziehungsperson bedeutet diese Phase, je nach Typstruktur, Entlastung oder Verlassenheits- und Angstgefühle, denn die ICH-Entwicklung beruht auf dem allmählichen Heraustreten des Kindes aus der Symbiose mit der Mutter. Die Autonomiewünsche des Kindes können bei ,,bemutternden“ Personen als Zurückweisung ihres Liebesgefühls verstanden werden. Das Kind versteht die eigenen Bestrebungen dann als ,,böse“, reagiert ,,trotzig“ oder passiv. Mütter, die während der oralen Phase, aufgrund der eigenen Autonomieproblematik, Schwierigkeiten mit ihrem Kind hatten, fällt es nun leichter, das Kind in dieser Phase zu stärken.
,,Vielen Menschen fällt dieses sich bewegliche Einstellen auf unterschiedliche Anforderungen zu verschiedenen Zeiten der Entwicklung ein-und-desselben Kindes recht schwer. “ 25 Wichtig ist, dass in dieser Zeit die anderen Bezugspersonen, wie Vater und Geschwister stärker einbezogen werden. Während dieser Phase ist das ICH des Kindes schon deutlich zu erkennen. Da aber das logische Denken, das Verknüpfen von Ursache und Wirkung, den motorischen Fähigkeiten hinterherhinkt, scheitern viele kindliche Aktionen an dem ,,Nein“ der Eltern. Aufgrund dessen steigt das aggressive Potential des Kindes deutlich. Diese aggressiven Bedürfnisse müssen zu einem angemessenen Grad gewährt werden, um den Willen des Kindes anzuerkennen, um sein ICH zu stärken. Es muss Triebaufschub ermöglichen, Frustrationen regulieren und ,,Boss“ bleiben. Permanente Entsagung und regressive Erziehung, mit bisher noch nicht verstandenen Ver- und Geboten, führen zu einem starren ÜBER-ICH Vorläufer, die ICH-Entwicklung wäre somit behindert. Aber auch der elterliche Verzicht auf Machtausübung (laissez-faire-Erziehung), sowie eine verwöhnende Erziehung schaden dem Kind. Es fehlen ihm dann schützende Vorerfahrungen und Grenzen26, also ist eine differenzierte Triebbefriedigung anzustreben. Ein demokratischer Erziehungsstil sollte verwirklicht werden: ,,Grenzen ziehen mit Herz“.
In der infantil-genitalen Phase, erhöht sich die Aufmerksamkeit der Kinder bezüglich der Geschlechtsunterschiede. Sie beginnen verstärkt mit ihren Geschlechtsorganen zu spielen, was möglichst nicht unterbunden werden sollte. Nach Muck/ Trescher spielt in dieser Zeit die Frage der Gleichbehandlung eine wichtige Rolle. Jungen fühlen sich durch ihr offensichtliches ,,mehr“ gegenüber den Mädchen überlegen.27 Diese können sehr unterschiedliche Interpretationen zu dieser Tatsache haben: Sie reichen von Wut und Hass, über ,,abwarten- vielleicht kommt noch was“, bis hin zu Minderwertigkeitsgefühlen. Die Wirksamkeit solcher Phantasien wird umso größer, je mehr sie durch gesellschaftliche Werteinstellungen vermittelt werden. Das phallische ,,Gehabe“ der Jungen wird jedoch durch die Angst, den Penis verlieren zu können, überschattet (denn sie wissen, dass es auch Menschen ohne Penis gibt!). Diese Kastrationsangst des Jungen ist die Entsprechung des Penisneid des Mädchens.28 Durch die Beziehungserweiterung von der Dyade hin zur Triade, erwachen im Kind Besitz- und Vernichtungswünsche dem jeweils anders geschlechtlichen Elternteil gegenüber. Damit beginnt gegen Ende der infantil-genitalen Phase der ÖDIPUSKONFLIKT, der in seiner pathogenen Auswirkung, als ÖDIPUSKOMPLEX bezeichnet wird.29
Der ödipale Konflikt hat für Jungen und Mädchen unterschiedliche Bedeutung. Das Mädchen muss, anders als der Junge, das Liebesobjekt wechseln. Obwohl die Mutter als Rivalin begriffen wird, bleibt die primäre Liebesbeziehung neben den Beseitigungswünschen, bestehen. Diese unerträgliche Ambivalenz führt zu Scham- und Schuldgefühlen. Daher benannte Erikson diese Phase der sexuellen Entwicklung als eine kindliche Initiative gegen Schuldgefühle.30
Je besser jedoch die primäre Beziehung des Mädchens zur Mutter war, desto leichter gelingt eine Lösung des Konfliktes. Der Junge adressiert sein Begehren an die Mutter, wobei der Vater als ,,Störenfried“ begriffen wird und ausgeschaltet werden muss. Da der Junge aber auch ihm gegenüber Liebesgefühle entwickelt hat, führt dieser Zustand zu den gleichen Schuldgefühlen wie bei den Mädchen. Bezugspersonen unterstützen das Kind, indem sie darauf achten, dass es gleichwertige Kontakte zu Personen beider Geschlechter hat. Die Einsicht des Kindes, durch Reifung des Wahrnehmens und Denkens, führt zur Aufgabe der ödipalen Vorstellungswelt. Das Kind verabschiedet sich aus seiner Phantasiewelt, versöhnt und identifiziert sich mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil. Der Übergang vom Lust- zum Realitätsprinzip kann somit fortschreiten. In diesem Zeitraum, ist es je nach individueller Reifung des Kindes angemessen, sexuelle Aufklärung zu leisten um das Tun nicht unausgesprochen zu lassen.
Die Latenzzeit ist die Zeit vor der Geschlechtsreife. Ammon schreibt dazu: ,, [...]die Latenzzeit dient [...] zum kulturellen Lernen unter Benutzung bereits entwickelter menschlicher Möglichkeiten. “ 31 Eltern bezeichnen Kinder jetzt als relativ harmonisch und stabil, (die Ruhe vor dem Sturm der Pubertät). Die Psychoanalyse erklärt dies durch die Ruhepause des ICHs, da es keine übermäßigen Triebwünsche abzuführen hat. Das Kind hat nun die Möglichkeit Interesse, Aufmerksamkeit und Konzentration auf andere Lernziele zu richten. Bei erfolgreicher Auflösung des ödipalen Konfliktes ist die familiäre Triade (und evtl. Geschwister) eine wichtige Grundvoraussetzung zu sozialem Verhalten. Erikson bezeichnet diese Phase mit dem Gegensatzpaar ,,Werksinn gegen Minderwertigkeitsgefühl“.32 Das Kind eignet sich lernend die Umwelt an und erfüllt gestellte Aufgaben. Als Vertreter der Entwicklungspsychologie, bezeichnet Piaget dies als Akkomodation und Assimilation.33 Die Gefahr dieses Lebensstadiums besteht in der Erfahrung, beim Lösen von Aufgaben zu versagen und so die geforderte Leistung nicht zu erbringen. Dies kann zu einem dauerhaften Gefühl von Unzulänglichkeit und Minderwertigkeit führen.34 Daher sollten Kinder an erreichbaren Aufgaben lernen und sich so durch Motivation neue Lernziele stecken.
Mit beginnender Pubertät tritt die Phase der Adoleszenz ein. Sie erstreckt sich über einen Zeitrahmen vom 13. - 20. Lebensjahr.
2.3. Kritik
Die anhaltende Diskussion über die (Un-)Möglichkeit einer psychoanalytischen Pädagogik (wie oben umrissen) macht die Schwierigkeit, zwei Wissenschaften sinnvoll ineinander zu integrieren, deutlich. Aus pädagogischer Sicht können nicht alle Fragen der Erziehung psychoanalytisch geklärt werden, so sind z. B. die häufig in der Pubertät durchlebten Selbstwertkonflikte innerhalb der ICH- Organisation (siehe dazu Konzept der Selbstkohärenz von Kohut.35 ) mit Hilfe des Strukturmodells nicht gut fassbar. Auch sei eine Erziehung begriffen als Vorbeugung psychischer Erkrankungen und damit die Vermeidung von Traumatisierung, so Körner, unmöglich.36 Pädagogen arbeiten, begründet durch ihre Ausbildung, ausschließlich mit dem Bw. und Vbw. der menschlichen Psyche, das Ubw. bleibt Domäne der Psychoanalytiker. Kenntnisse über das von Freud angenommene latent Unbewusste sind jedoch für die Pädagogik von Nutzen. Die sexuelle Aktivität des Kindes, die einst in der psychoanalytischen Pädagogik einen so hohen Stellenwert einnahm, wird heute eher eingebettet, d. h. als Teil der gesamten psychosozialen Entwicklung des Kindes gesehen. Ammon sagt dazu: ,,Die sexuelle Aufklärung ist ein Erziehungsproblem, aber sie ist nicht der Kern des Problems der Erziehung. “ 37
Es bleibt Verdienst der Psychoanalyse, die Sexualität des Kindes erforscht und in die Öffentlichkeit getragen zu haben. Heute wird dies ohne Vorurteil anerkannt.
3. KURZER AKTUELLER BEZUG AM BEISPIEL DER WERBUNG
Werbung ist heute allgegenwärtig.
Die Dingwelt von früher ist heute eine Markenwelt geworden, Roller sind nicht mehr Roller, sondern Kickboards, aus Margarine sind Rama und Lätta geworden und Turnschuhe heißen Nikes und Buffalos. Eine Vielzahl von Experten (u.a. Designer, Marketing Producer, Werbepsychologen) beschäftigen sich damit, wie ein bestimmtes Produkt erfolgreich ,,unter die Leute“ gebracht werden, und sich gegen die Konkurrenz durchsetzen kann.
Im Wort ,,werben“ steckt das althochdeutsche Wort ,,wervan“, was ,,sich bemühen“ oder ,,etwas betreiben“ bedeutet. Das bekannteste und älteste Werbemittel ist unsere Stimme, durch die potentielle Käufer über die Beschaffenheit der Produkte informiert werden. In den aufkommenden Ballungs- und Handlungszentren entwickelte sich Werbung schnell. Durch die Produktion von Gütern in großen Mengen, musste eine Methode geschaffen werden, die die Nachfrage ankurbeln sollte. Werbung ist auch heute ein Bereich, der sich mit der Übermittlung von Werbebotschaften (Informationen) und dem damit verbundenen Ziel der Absatzsteigerung befasst.38 Mit dem Ziel der Gewinnung von Informationen über den Markt, trennt sich die Marktforschung inhaltlich von der Werbung, stellt ihr aber die Ergebnisse wieder zur Verfügung.39 Marketing hingegen versucht diesen Markt und seine Rahmenbedingungen zu verändern.40
Generell sind der kommerziellen Kommunikation Grenzen gesetzt durch:
- Rechtssprechung
- Aufsicht des deutschen Werberates
- freiwillige Selbstbeschränkung der Wirtschaft
- Klagebefugnis der Verbraucherorganisationen
Werbung hat aber, neben der wirtschaftlichen, auch eine kulturelle und psychosoziale Bedeutung. So ist Werbung Bestandteil unserer Kultur geworden, Kinder wachsen mit ihr auf. Als besondere Zielgruppe der Wirtschaft und den damit verbundenen Aufgaben und Herausforderungen für Eltern und Kinder soll sich im Folgenden beschäftigt werden.
3.1. Kinder als Zielgruppe der Werbung
Kinder sind für die Industrie und somit auch für die Werbung aus verschiedenen Gründen interessant:
Sie sind Konsumenten, Käufer auf dem ,,Gegenwartsmarkt“. Das Interesse der Kinder richtet sich dabei nicht nur auf Kinderprodukte; auch andere Bereiche, wie z. B. der Lebensmittelmarkt, erwecken ihre Aufmerksamkeit. Kinder sind außerdem ,,vermittelnde“ Konsumenten, indem sie ihre materiellen Wünsche an andere Personen richten, welche die entsprechenden Artikel dann kaufen. Sie sind immer einflussreichere ,,Mitentscheider“ bei Käufen der Eltern, bzw. anderer Bezugspersonen.
Desweiteren sind Kinder eine beliebte Zielgruppe der Werbung, da sie -als nachfolgende Generation- den Zukunftsmarkt bestimmen. Aus diesem Grunde versucht die Werbung schon früh, Markenloyalitäten zu schaffen, die sich langfristig im Kaufverhalten auswirken sollen: Durch diese Grundannahme, wird deutlich, dass hier von Determiniertheit im freudschen Sinne ausgegangen wird. Nach einer Studie des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen und der Abteilung Medienforschung des ZDF, können sich Neunjährige z. B. mühelos 700 Markennamen merken. Das verfügbare Geld der Kinder in Deutschland betrug 1993 11,5 Milliarden DM.41 Von 1,2 Millionen Werbespots die 1995 im Fernsehen zu sehen waren, warben allein 40% für Kinderprodukte oder mit Kindern; 350 Millionen DM ließ sich die Industrie 1995 die Kinderwerbung kosten.42 All diese Daten verdeutlichen, dass Kinder einen großen Wirtschaftsfaktor in Industrie und Handel darstellen. Je höher der Wettbewerbsdruck bzw. die Marktsättigung ist, desto stärker werden Werbebotschaften emotionalisiert, sie sprechen Bedürfnisse, Sehnsüchte und Träume der Kinder massiv an.
3.2. Handlungschancen psychoanalytischer Pädagogik
Die oben beschriebene Situation, in der sich Eltern und Kinder befinden, kann unter psychoanalytisch-pädagogischem Aspekt folgendermaßen betrachtet werden:
Durch die permanente Anregung mit Hilfe von Illusion durch die Werbung, werden Bedürfnisse bei Kindern geschürt, bzw. neu geschaffen. Psycho- analytisch ist das Bedürfnis nach Wunscherfüllung gleichzusetzen mit dem Streben nach Triebbefriedigung und Lustgewinn. Nach dieser Sichtweise, kommt es notwendigerweise zu Forderungen des ES, die die Triebabfuhr ermöglichen sollen. Wunschäußerungen eines Kindes sind demzufolge zunächst ,,normal“ und nachvollziehbar. Durch die häufigen Neuerscheinungen auf dem Spielzeugmarkt (60.000 jährlich),43 werden sie jedoch zur Belastung für beide Seiten. Eine angemessene Frustrationsregulation ist nötig, der Wille des Kindes ist anzuerkennen um so sein Selbstwertgefühl zu schützen. Würden die Wünsche des Kindes permanent missachtet, so würde es, aufgrund der Internalisierungs- mechanismen nicht nur seine Wunschäußerung, sondern seine gesamte Person als ,,böse“ empfinden. Ein überstrenges ÜBER-ICH, bzw. im pathologischen Fall neurotische Erkrankungen, können die Folge sein. Eine verwöhnende Erziehung hingegen, fördere zwangsläufig den narzistischen Persönlichkeitstyp.44 Mit zunehmendem Alter und damit einhergehender ICH- Entwicklung wird es möglich, das Lustprinzip durch das Realitätsprinzip abzulösen. Erst die zeitweise Beherrschung des ES, bietet hier pädagogische Handlungschancen. Die Stärkung des ICH steht dabei im Vordergrund, wobei ein Triebaufschub ohne Einsatz von Abwehrmechanismen möglich werden soll. Durch Bewusstmachung der Werbetricks, indem z. B. das angepriesene Produkt im Supermarkt gemeinsam mit dem Kind betrachtet wird, kann es die tatsächliche Beschaffenheit einschätzen, die Illusion wird so vermindert. Selbst wenn der Kaufwunsch bestehen bleibt, wird durch diese Gegenüberstellung der Realitätssinn gefördert. Das Kind kann, mit dieser Hilfestellung, seine bereits vorhandenen Erwartungen eher differenzieren, denn auch wenn Kinder 100 Spots gucken, haben sie nicht ,,automatisch“ 100 Wünsche. Menschliches Verhalten ist demnach nicht monokausal, es setzt sich nicht aus einem bloßen Reiz-Reaktions-Muster zusammen, wie die frühe Verhaltenslehre annahm, sondern ist komplexer zu sehen. Eltern, peer groups und andere Bezugspersonen haben nach wie vor einen entscheidenden Einfluss auf das Kind. Bezugspersonen die ihr eigenes Kaufverhalten reflektierend betrachten und über Zusammenhänge der Werbewirtschaft informiert sind, können auch ihren Kindern die nötige ICH-Stärke und damit Gelassenheit vermitteln. Durch eine entsprechende Vorbildfunktion findet eine beidseitige Sensibilisierung für die persönliche Verantwortung statt. Begreifen Eltern sich ausschließlich als Opfer der Werbung, ohne Interventionsmöglichkeiten zu sehen, wird der Werbung lediglich die Sündenbockfunktion zugeschoben (nach Freud „Verschiebung“; im Werbejargon „ externale Kausalattributation “45 genannt). Dies bietet jedoch in der realen Lebenswelt keine Hilfe für das Kind!
4. FAZIT
In der Auseinandersetzung mit dem Thema, erschienen uns die psychoanalytisch-pädagogischen Zusammenhänge, die wir zunächst überwiegend vor historischem Hintergrund gesehen haben, überraschend aktuell.
Während unserer Suche nach Schnittstellen der verwandten Disziplinen wurde uns klar, dass wir als (angehende) Sozialpädagoginnen von den Erkenntnissen psychoanalytischer Pädagogik profitieren können, da ,Erziehung zur Realität‘ auch unser Anliegen sein muß.
In dieser Pädagogik sind Möglichkeiten zur ICH-Stärkung gegeben, denn so Muck: ,,Der Mensch ist eben nicht vorprogrammiert, sondern nur an- programmiert, er ,,programmiert “ sich erst für sein Leben, indem er es lebt. “ 46
5. LITERATURVERZEICHNIS
6. ANHANG
[...]
1 Freud 1997
2 Fatke/ Scarbath (Hg.) 1995, S.90.
3 vgl. ebd., S.9ff.
4 vgl. Figdor in Muck/ Trescher 1993, S.63.
5 Freud in Aichhorn 1974, S.7.
6 vgl. Krüger 1999, S.114f.
7 vgl Figdor a.a.O., S.70ff.
8 Brenner 1997, S.14.
9 ebd.
10 vgl. Muck in Muck/ Trescher a.a.O., S.15.
11 Freud 1997, S.42.
12 vgl. Brenner a.a.O., S.46.
13 vgl. Tillmann 1997, S.59.
14 Hoffmann/ Hochapfel a.a.O., S.17.
15 vgl. Psychologieseminar Prof. Plath. Typus Skript, 23.10.1998.
16 Tillmann a.a.O., S.60.
17 Freud a.a.O., S.45.
18 vgl. Hoffmann/ Hochapfel 1999, S.25.
19 Bittner in Krüger a.a.O., S.114.
20 vgl. Geißler/ Hege 1988, S.48.
21 vgl. Hoffmann/ Hochapfel a.a.O., S.27.
22 vgl. Erikson 1980, S.97.
23 vgl. Hoffmann/ Hochapfel a.a.O., S.38.
24 Erikson, a.a.O., S.110f.
25 Muck in Muck/ Trescher a.a.O., S.29.
26 vgl. ebd. S.28.
27 vgl. ebd. S.33f.
28 Brenner a.a.O., S.101ff.
29 vgl. Hoffmann/ Hochapfel a.a.O., S.45.
30 vgl. Erikson a.a.O., S.117ff.
31 Ammon 1973, S.281.
32 Erikson Identität 1966, S.98.
33 vgl. Piaget 1992.
34 vgl. Tillmann a.a.O., S.209.
35 weiterführend: vgl. Kohut. Narzismus. Frankfurt/M. Suhrkamp, 1971.
36 vgl. Körner in Krüger 1999, S.116.
37 Ammon a.a.O., S.131.
38 vgl. Hunziker 1996, S.67.
39 vgl. Pflaum/ Bäuerle 1983, S.185.
40 ebd. S.184.
41 vgl. Becker-Textor, Schubert 1997 S.28.
42 vgl. www.pariteat-nrw.org/ oeff/ forum/97-8/kinder.htm
43 vgl. ebd. S.32.
44 vgl. Bravo-Jugend-Marktreport in Eggert 1999, S.102.
45 Bergler in http://.europa.eu. int.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Einleitung?
Die Einleitung beschäftigt sich mit der Frage, wie trotz des pessimistischen Menschenbildes der Psychoanalyse eine facettenreiche psychoanalytische Pädagogik entstehen konnte. Es wird ein kurzer Bezug zu einem aktuellen Thema (Werbung und Kinder) hergestellt, um die Relevanz der psychoanalytischen Pädagogik zu verdeutlichen.
Was sind die Hauptpunkte der Einführung in die psychoanalytisch orientierte Pädagogik?
Dieser Abschnitt beleuchtet die Anfänge der Verbindung zwischen Psychoanalyse und Pädagogik, die anfänglichen Widerstände und die Entwicklung durch Pioniere. Es wird auch die Kontroverse um den wissenschaftlichen Status der psychoanalytischen Pädagogik und das Verhältnis zwischen Psychoanalyse und Pädagogik diskutiert.
Welche Grundannahmen der Psychoanalyse werden erläutert?
Die Grundannahmen umfassen das Prinzip der psychischen Determiniertheit und die Existenz unbewusster psychischer Inhalte. Es werden auch die Modellvorstellungen des psychischen Apparats (ES, ICH, ÜBER-ICH) und die Trieblehre (EROS und DESTRUKTIONSTRIEB) erläutert.
Was sind die Grundsätze der psychoanalytischen Pädagogik?
Dieser Abschnitt beschreibt die erziehungsrelevanten Elemente, die sich aus den Grundannahmen der Psychoanalyse ableiten lassen. Dazu gehören die Bedeutung der Selbstreflexion des Erziehers, die Vorbildfunktion, die Beachtung der ödipalen Situation und die Bedeutung der frühen Mutter-Kind-Beziehung.
Welche Kritik wird an der psychoanalytischen Pädagogik geäußert?
Die Kritik konzentriert sich auf die Schwierigkeit, Psychoanalyse und Pädagogik sinnvoll zu integrieren. Es wird argumentiert, dass nicht alle Fragen der Erziehung psychoanalytisch geklärt werden können und dass Pädagogen hauptsächlich mit dem Bewussten und Vorbewussten arbeiten, während das Unbewusste Domäne der Psychoanalytiker bleibt.
Wie wird ein aktueller Bezug am Beispiel der Werbung hergestellt?
Der Text untersucht die Rolle der Werbung, insbesondere im Hinblick auf Kinder als Zielgruppe. Es werden die Motive der Industrie und die Auswirkungen der Werbung auf Kinder (Konsumentenverhalten, Markenloyalität) analysiert.
Welche Handlungschancen bietet die psychoanalytische Pädagogik im Kontext der Werbung?
Es wird dargelegt, dass Werbung Bedürfnisse bei Kindern schürt und dass eine angemessene Frustrationsregulation wichtig ist. Die Stärkung des ICH und die Bewusstmachung von Werbetricks werden als pädagogische Handlungschancen betont.
Was ist das Fazit des Textes?
Die Auseinandersetzung mit dem Thema hat gezeigt, dass die psychoanalytisch-pädagogischen Zusammenhänge überraschend aktuell sind und dass (angehende) Sozialpädagoginnen von den Erkenntnissen profitieren können.
- Citar trabajo
- Christina Domokos (Autor), 2000, Psychoanalytische Pädagogik und die beste Zielgruppe der Welt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99012