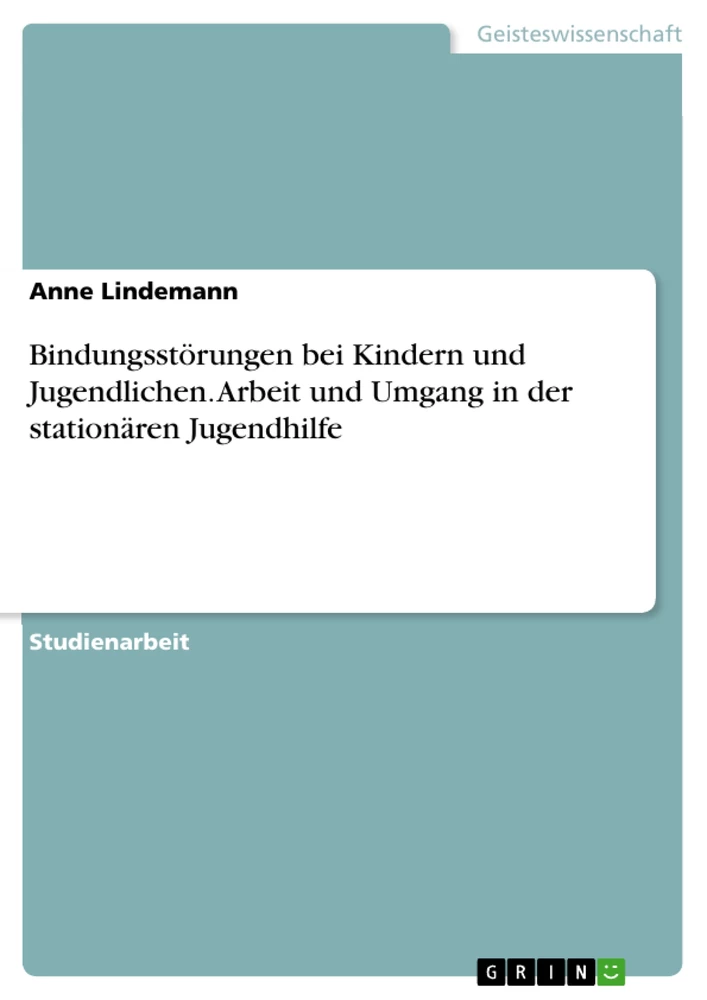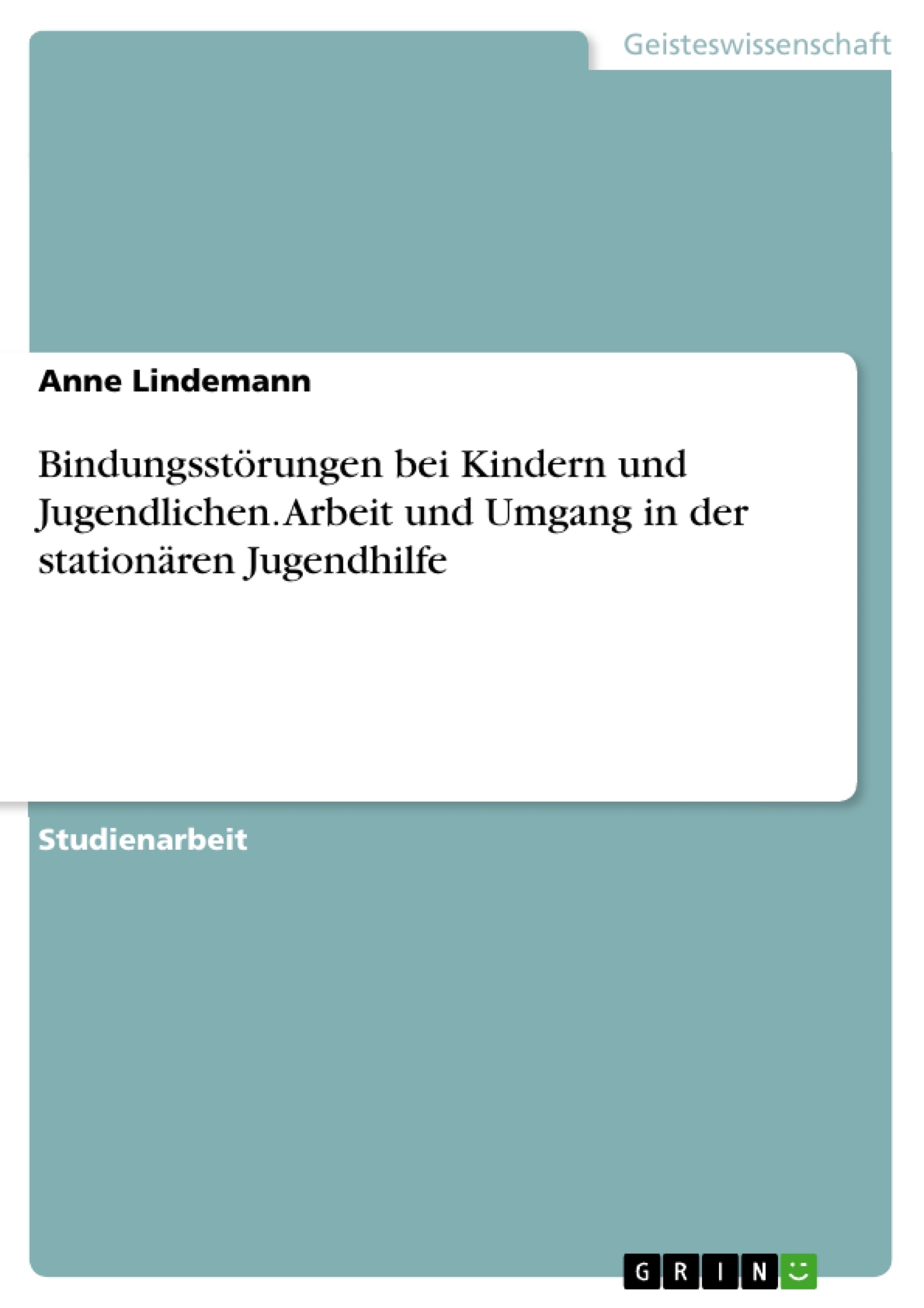In der vorliegenden Arbeit sollen Bindungsstörungen als solches beleuchtet werden und anhand eines Fallbeispiels aus der Arbeit eine Möglichkeit der Arbeit mit betroffenen Jugendlichen aufgezeigt werden.
Der Mensch ist ein soziales Wesen und geht in seinem Leben immer wieder Beziehungen ein, in denen er eine mehr oder weniger enge Bindung zu einem anderen Menschen aufbaut. Doch die wohl wichtigste Beziehung ist die zwischen Mutter und Kind. Kann diese Mutter-Kind-Dyade nach der Geburt nicht aufrechterhalten werden, können Bindungsstörungen beim Kind die Folge sein.
In der stationären Hilfe zur Erziehung soll Kindern und Jugendlichen ein neues, positiveres Lebensumfeld zur Verfügung gestellt werden, um sie bestmöglich in ihrer Entwicklung zu fördern, wenn es in der Herkunftsfamilie nicht möglich ist. Pädagogische Fachkräfte treffen in diesem Setting häufig auf Kinder und Jugendliche, die negative Bindungserfahrungen, wie Trennung, Misshandlung oder Vernachlässigung gemacht haben. Die Arbeit mit diesen Klient*innen gestaltet sich in vielerlei Hinsicht schwierig. Nicht nur, dass Bindungsstörungen sich in mannigfaltiger Form zeigen und häufig Komorbiditäten auftreten, soll der junge Mensch trotz Schichtdienst, personellen Engpässen und hoher Fluktuation der pädagogischen Fachkräfte auch noch eine Bezugsperson finden, obwohl er in seinem Leben möglichweise noch nie feinfühliges Verhalten oder Zuwendung erlebt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bindungsstörungen
- Definition
- Ursachen
- Innere Arbeitsmodelle
- Stationäre Kinder- und Jugendhilfe
- Fallbeispiel L. K.
- Mögliche Rahmenbedingungen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Bindungsstörungen und deren Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche in der stationären Jugendhilfe. Das Ziel ist es, das Phänomen der Bindungsstörungen zu beleuchten und anhand eines konkreten Fallbeispiels aus der Praxis aufzuzeigen, wie mit betroffenen Jugendlichen gearbeitet werden kann.
- Definition und Merkmale von Bindungsstörungen
- Ursachen und Entstehung von Bindungsstörungen
- Die Rolle der inneren Arbeitsmodelle in der Bindungstheorie
- Die Bedeutung von Bindung in der stationären Jugendhilfe
- Herausforderungen bei der Arbeit mit bindungsgestörten Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Bindungsstörungen ein und erläutert die Relevanz der Thematik im Kontext der stationären Jugendhilfe. Sie skizziert die Problematik, dass junge Menschen, die in ihren Herkunftsfamilien negative Bindungserfahrungen gemacht haben, in der stationären Hilfe zur Erziehung besondere Unterstützung benötigen.
- Bindungsstörungen: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Bindungsstörung und beschreibt die unterschiedlichen Ausprägungen und Ursachen. Es werden die inneren Arbeitsmodelle als mentale Repräsentanzen von Bindungserfahrungen vorgestellt.
- Stationäre Kinder- und Jugendhilfe: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Bedeutung von Bindung im Kontext der stationären Jugendhilfe. Die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen bei der Arbeit mit bindungsgestörten Jugendlichen werden beleuchtet.
- Fallbeispiel L. K.: Dieses Kapitel präsentiert ein konkretes Fallbeispiel aus der Praxis und zeigt auf, wie ein Jugendlicher mit Bindungsstörungen in der stationären Jugendhilfe betreut werden kann.
- Mögliche Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Rahmenbedingungen, die eine gelingende Arbeit mit bindungsgestörten Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe ermöglichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Themen Bindungsstörungen, stationäre Jugendhilfe, innere Arbeitsmodelle, Bindungstheorie und die Herausforderungen der Arbeit mit bindungsgestörten Jugendlichen in der Praxis. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: reaktive Bindungsstörung, enthemmte Bindungsstörung, Misshandlung, Missbrauch, Deprivation, Bezugsperson, emotionale Entwicklung und pädagogische Fachkraft.
- Quote paper
- Anne Lindemann (Author), 2020, Bindungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Arbeit und Umgang in der stationären Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/990130