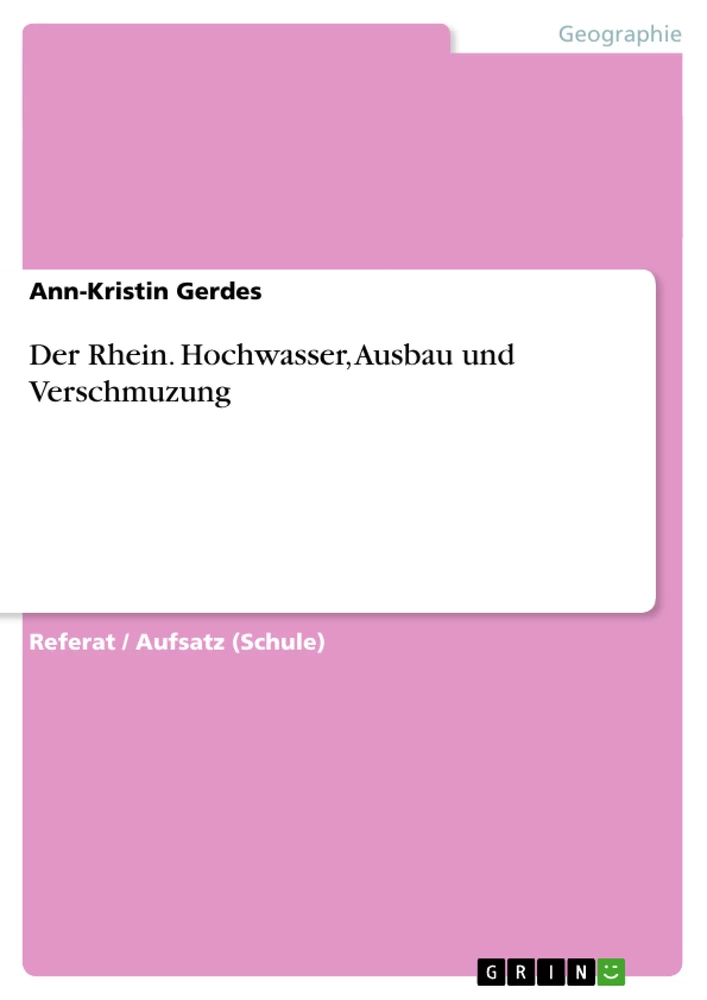DER RHEIN
„Das Rheinhochwasser hat gestern in Köln die Jahrhundert-Rekordmarke, 6cm höher als 1993, erreicht. Gegen 20 Uhr stieg die Flut auf das Niveau der großen Überschwemmung von 1926.“ Diese Berichte aus Funk- und Fernsehen kennen die meisten, und die Berichte über neue Katastrophen am Rhein nehmen kein Ende. Deshalb möchte ich in diesem Referat über die Ursachen und Maßnahmen, die dagegen unternommen werden, berichten.
HOCHWASSER
Früher konnte man ein sogenanntes „Jahrhunderthochwasser“ nur alle 100-200 Jahre erwarten , kleinere Hochwasser alle 2-3 Jahre. Heute dagegen liegt die Wahrscheinlichkeit bei unter 50 Jahren, bzw. bei 1 Jahr. Das liegt daran, das durch Bodenversiegelungen und Begradigungen der Nebenflüsse (z.B. Mosel, Main und Neckar), das Wasser schneller in den Rhein gelangt.
Die kleineren Hochwasser entstehen häufig durch Schneeschmelze, starken und langen Regen und Bodenversiegelung. Bei der Schneeschmelze kann der geschmolzene Schnee nicht durch den gefrorenen Boden abfließen, und läuft so oberirdisch in die Flüsse. Das gleiche Problem stellt sich bei der Bodenversiegelung (S.125,M4), d.h. beim Bau von Straßen und Gebäuden im Einzugsgebiet des Flusses.
KORREKTUREN AM RHEIN - FR Ü HER
Schon im 19. Jahrhundert hatten die Menschen Probleme mit dem Hochwasser am Rhein.
Außerdem bildeten sich nach jeder Überschwemmung große Flußschlingen (Mäander), die das Land zerstörten. Der hohe Grundwasserspiegel lockte auch Stechmücken an, die die Seuchen Malaria und Sumpffieber verbreiteten. Schließlich entwickelte der Wasserbauingenieur Tulla einen Plan: man sollte Uferbefestigungen anbringen, die den Fluß in ein 250m breites Bett zwingen sollten, um den hohen Grundwasserspiegel, der durch das Sickerwasser entstanden war, zu senken.
Nach 40 Jahren Arbeit waren diese Befestigungen angebracht und die Gebiete rund um den Fluß herum trockengelegt, so daß sie bebaut und besiedelt werden konnten. Nun waren die Leute zufrieden, aber der Naturhaushalt (Wechselspiel zwischen Wasser, Boden, Klima und Vegetation) war gestört. Es ergaben sich aber auch noch andere Probleme: die Strecke des Flusses hatte sich verkürzt und das Gefälle war größer geworden. Das löste nach kurzer Zeit Erosion aus, was wiederum zur Folge hatte , das der Grundwasserspiegel durch das immer tiefer sinkende Flußbett, zu tief sank(S.126,M2). Die Brunnen mußten tiefer gebohrt werden und die Vegetation veränderte sich. Die schönen Auewälder (S.127,M4), die sumpfiges Gebiet gewohnt waren, verschwanden, und zurück blieben nur Pflanzen, die die Trockenheit liebten.
AUSBAU AM RHEIN - HEUTE
In diesem Jahrhundert versuchte man erneut, den Rheinfluss vor allem für die Schifffahrt und für die Wasserkraftenergie zu verbessern.
Zuerst versuchte man es mit einem Rheinseitenkanal. Er war 100m breit und fast 10m tief und sollte einen Teil des Rheinwassers aufnehmen. Dieses Vorhaben wurde jedoch abgebrochen, als man merkte, das der Grundwasserspiegel immer weiter absank.
Dann entdeckte man die Schlingenlösung(S.129,M4): das Wasser wurde in ein Kanalbett geführt und in die Altrheinarme baute man kleine Wehre ein, die das Wasser stauten und somit den Grundwasserspiegel nicht beeinträchtigten. Doch mit dem Ergebnis war man immer noch nicht zufrieden. Um den Rhein trotzdem noch zu regulieren und um elektrischen Strom zu gewinnen, baute man 2 weitere Schleusen mit Wasserkraftwerken. Damit sich die dadurch entstandene Erosion nicht weiter ausbreitete, schüttete man zehntausende Tonnen Kies in den Strom. Außerdem versuchte man, die geschädigten Gebiete am Oberrhein zu renaturieren, d.h. sie in die ursprünglichen, natürlichen Verhältnisse zu bringen(S.127,M5). Dazu verlegt man z.B. einige Deiche zurück und verband die abgeschnittenen Altrheinarme wieder mit dem Rheinstrom. Zur Absicherung vor Hochwasser hat man 46 Polder angelegt(S.128,M1). Das sind landwirtschaftlich genutzte Gebiete, die bei Hochwasser ohne Gefahr geflutet werden können. Der Düsseldorfer Umweltminister hatte sogar schon vorgeschlagen, die Polder am Oberrhein schon vor den Hochwassern fluten zu lassen, damit sie gar nicht erst zustande kommen. Doch die Bauern waren da anderer Meinung, denn dadurch würden sie ihren ganzen landwirtschaftlichen Besitz verlieren.
VERSCHMUTZUNG AM RHEIN
Der Rhein wird durch viele Dinge, vor allem aber durch die Industrie, immer mehr verschmutzt (S.131,M3/S.130,M1). Die Kalisalzbergwerke im Elsaß z.B. führen dem Rhein pro Sekunde 100- 150kg Salz zu. Doch das ist nicht das einzige Problem: der Rhein ist der einzige Fluß, an dem die Industrie- und Siedlungsdichte so hoch ist.
Außerdem wird der Rhein intensiv genutzt: die Industrie benötigt das Wasser für die Produktion, Kraftwerke für die Kühlung und schließlich die Landwirtschaft zur Bewässerung. Das hat natürlich auch Folgen: das Grundwasser sinkt durch die hohe Wasserentnahme, das Kühlwasser wird erwärmt und das Trinkwasser ist durch Putzmittel u.a. Sachen verschmutzt und die Produktionsrückstände der Industrie halten das Wasser auch nicht sauber. Natürlich kann der Rhein einige Stoffe selbst abbauen, aber das sind nur organische Stoffe wie Kohlehydrate, Fette und Eiweiße.
Diese „Selbstreinigungskraft“ ist in Flüssen besonders groß, wenn der Sauerstoffgehalt hoch ist. Doch der Sauerstoffgehalt ist im Rhein nicht besonders groß, denn er hängt von der Wasser- temperatur ab. Je höher die Temperatur, desto weniger Sauerstoff. Da die Temperatur des Rheins durch das erwärmte Kühlwasser ansteigt, hat er dem entsprechend keinen hohen Sauerstoffgehalt. Die anderen sogenannten „anorganischen“ Stoffe bleiben im Wasser enthalten, da sie nicht abgebaut werden können.
Das verunreinigte Wasser ist natürlich auch für die Menschen schädlich, denn die Verunreinigungen können ganz leicht durch Trinkwasser, Fisch und bewässertes Gemüse in unseren Körper gelangen(S.130, M2).
ZUSAMMENARBEIT
Durch die hohe Verschmutzung des Rheins ist man vor Jahren darauf gekommen, das verschmutzte Wasser nicht immer wieder kompliziert aufzubereiten, sondern die Belastungen geringer zu halten. Dazu verbesserte man als erstes die Kläranlagen, denn die Aufbereitung des stark verschmutzten Wassers ist sehr aufwendig und teuer. Mit den neuen Kläranlagen will man die biologische Selbstreinigung der Natur fördern. Dabei wird dem Wasser z.B. auch Sauerstoff zugeführt (S.133,M3).
Im Jahre 1950 wurde die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins gegründet. Diese machte dann Verträge mit den Anliegerstaaten des Flusses, worin die sich verpflichteten, die Belastungen geringer zu halten. Das Ziel dieser Vereinigung ist es, das bis zum Jahr 2000 das Wasser so sauber ist, das wieder Lachse darin leben können und das die meisten Gebiete wieder renaturiert sind.
Außerdem wurde ein internationales Warnsystem zwischen Basel und Rotterdam eingerichtet. Das soll bewirken, daß alle Wasserwerke sofort informiert werden, wenn z.B. ein Unfall in einem Chemiewerk passiert ist, und die Gifte ins Wasser gelangt sind. So kann die Wasserentnahme sofort eingestellt werden.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "DER RHEIN"?
Der Text "DER RHEIN" behandelt das Thema Hochwasser am Rhein, dessen Ursachen, die menschlichen Eingriffe in den Flusslauf, die Verschmutzung des Rheins und die Bemühungen um den Umweltschutz und die Verbesserung der Wasserqualität.
Was sind die Ursachen für das vermehrte Hochwasser am Rhein?
Das vermehrte Hochwasser am Rhein wird hauptsächlich durch Bodenversiegelungen, Begradigungen der Nebenflüsse, Schneeschmelze und starken Regen verursacht. Durch die Versiegelung und Begradigung gelangt das Wasser schneller in den Rhein, was zu schnelleren und höheren Pegelständen führt.
Welche Korrekturen wurden früher am Rhein vorgenommen und welche Auswirkungen hatten diese?
Im 19. Jahrhundert wurden Uferbefestigungen angebracht, um den Fluss in ein 250m breites Bett zu zwingen. Dies sollte den Grundwasserspiegel senken und Überschwemmungen reduzieren. Diese Maßnahmen führten jedoch zu einer Verkürzung des Flusslaufs, einer Zunahme des Gefälles und Erosion, was den Grundwasserspiegel weiter senkte und die Vegetation veränderte.
Welche Maßnahmen wurden in neuerer Zeit zur Regulierung des Rheins ergriffen?
In neuerer Zeit wurden unter anderem ein Rheinseitenkanal gebaut (später abgebrochen), Schlingenlösungen mit Wehren in Altrheinarme eingesetzt, Schleusen mit Wasserkraftwerken errichtet und Kies in den Strom geschüttet, um Erosion zu verhindern. Außerdem wurden Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt und Polder angelegt, um Hochwasser abzufangen.
Wie wird der Rhein verschmutzt und welche Folgen hat das?
Der Rhein wird vor allem durch Industrieabwässer, Kalisalzbergwerke und die hohe Industrie- und Siedlungsdichte verschmutzt. Die Verschmutzung führt zu einem sinkenden Sauerstoffgehalt, der die Selbstreinigungskraft des Flusses beeinträchtigt, und gefährdet die Trinkwasserqualität sowie die Gesundheit von Menschen und Ökosystemen.
Welche Maßnahmen werden zur Reduzierung der Verschmutzung des Rheins ergriffen?
Zur Reduzierung der Verschmutzung wurden Kläranlagen verbessert, eine Internationale Kommission zum Schutz des Rheins gegründet, die Verträge mit den Anliegerstaaten abschloss, und ein internationales Warnsystem eingerichtet, um bei Unfällen in Chemiewerken schnell reagieren zu können.
Was ist das Ziel der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins?
Das Ziel der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins ist es, die Belastungen des Flusses zu reduzieren und die Wasserqualität so weit zu verbessern, dass wieder Lachse im Rhein leben können und die meisten Gebiete renaturiert sind.
- Quote paper
- Ann-Kristin Gerdes (Author), 2000, Der Rhein. Hochwasser, Ausbau und Verschmuzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99023