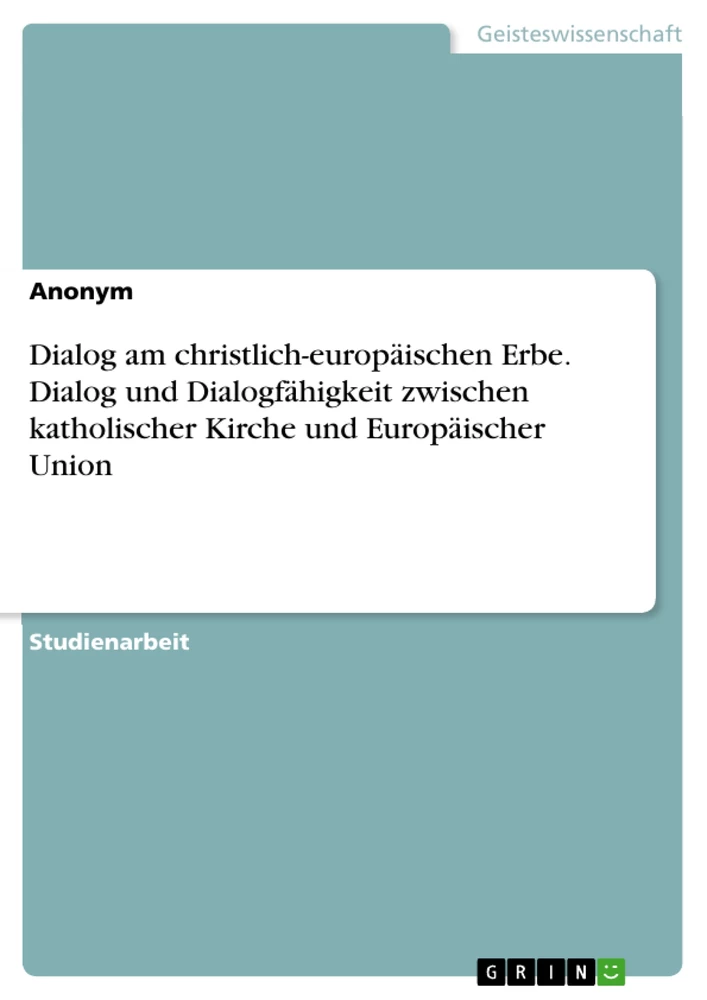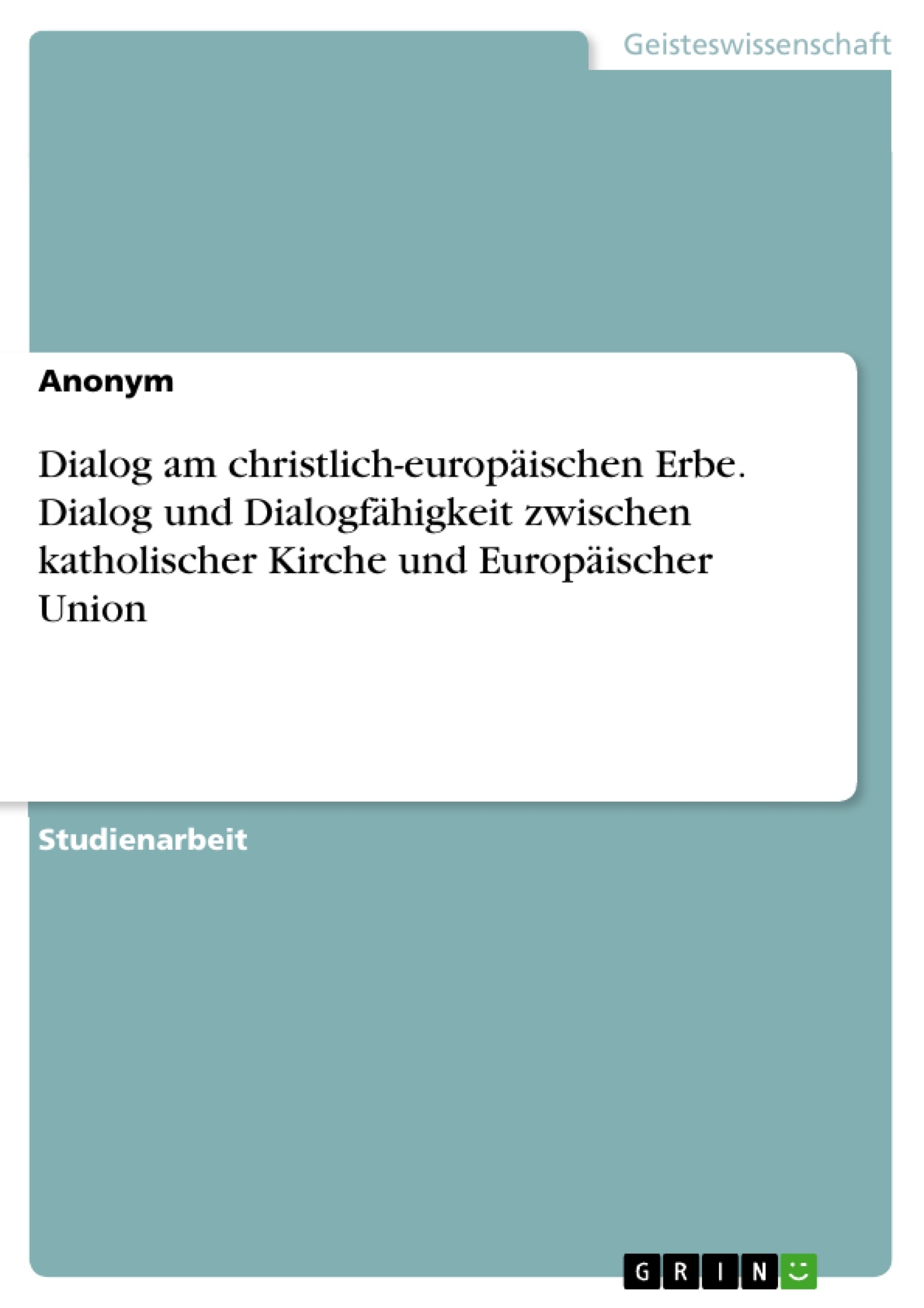Diese Arbeit soll keine historische Darstellung liefern, wann Europa christlich wurde beziehungsweise christlich genannt wurde, sondern erarbeiten, wie sich Europa, hier besonders in der Form der Europäische Union und das Christentum trotz oder wegen der Säkularisierung miteinander in Dialog treten können und wie sich ein wertschätzender Diskurs entwickeln kann.
Ebenso soll ein Blick auf den Bezug der katholischen Kirche auf Europa und im Besonderen auf die Europäische Union geworfen werden. Letztendlich soll diese Arbeit einen Überblick über die gegenseitige Bezugnahme geben und den Diskurs, in einigen Schwerpunkten, vom politischen Europa und katholischen Christentum in den Fokus nehmen und deren jeweils eigenen Zugang und Ausgangspunkt erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriff des Dialogs
- Annäherung an einen Dialogbegriff über das zweite Vatikanische Konzil
- Dialog als Win-Win-Situation in der Theologie von David Tracy
- Dialog im öffentlichen Bereich
- Zwischenfazit
- Rechtfertigung der EU und der katholischen Kirche als Dialogpartner
- Europäische Union
- Katholische Kirche
- Ekklesiologie als Grundlage
- Gemeinsames Interesse von Kirche und EU
- Beteiligte am Dialog
- Dialogführung in der Europäischen Union
- COMECE
- Zentrale Themen des säkularen Dialogs
- Migration und Asyl
- Grundpositionen des Dialoges
- Flucht und ihre Chance zum kulturellen Austausch
- Bekämpfung der Ursachen
- Rolle der Kirche
- Religionsfreiheit
- Beobachtung der COMECE zur Religionsfreiheit
- Inner-europäische Handlungsfelder der Religionsfreiheit
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Dialog zwischen der katholischen Kirche und der Europäischen Union im Kontext des christlich-europäischen Erbes. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Herausforderungen eines wertschätzenden Diskurses zwischen beiden Akteuren zu erörtern, ihre jeweiligen Bezugspunkte zu beleuchten und zentrale Themen des säkularen Dialogs zu analysieren.
- Der Begriff des Dialogs und seine verschiedenen Ausprägungen
- Die Rechtfertigung der EU und der katholischen Kirche als Dialogpartner
- Beteiligte am Dialog und deren Rolle (z.B. COMECE)
- Zentrale Themen des säkularen Dialogs, insbesondere Migration und Asyl sowie Religionsfreiheit
- Die gegenseitige Bezugnahme und der Diskurs zwischen politischem Europa und katholischem Christentum
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die historische Vorstellung eines christlichen Europa und führt in die Thematik des Dialogs zwischen der Europäischen Union und der katholischen Kirche ein. Sie begründet die Wahl der EU als Repräsentant Europas und kündigt die Untersuchung der Ekklesiologie der katholischen Kirche und deren Bezug zur EU an. Der Fokus liegt auf der gegenseitigen Bezugnahme und dem Diskurs zwischen politischem Europa und katholischem Christentum.
Begriff des Dialogs: Dieses Kapitel erörtert verschiedene Formen der Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat und definiert den Dialogbegriff. Es bezieht sich auf das Zweite Vatikanische Konzil und dessen Betonung der Religionsfreiheit als Beispiel für notwendigen Dialog. Weiterhin wird der Dialogbegriff von David Tracy als Win-Win-Situation vorgestellt, der auf einem offenen, gegenseitig würdigenden Gespräch basiert und Argumentation als nachgeordnetes Element betrachtet.
Rechtfertigung der EU und der katholischen Kirche als Dialogpartner: Dieser Abschnitt rechtfertigt die Auswahl der EU und der katholischen Kirche als Dialogpartner. Er analysiert die Grundlage der EU für die Klärung ihres Bezugs zum Christentum und untersucht die Ekklesiologie der katholischen Kirche, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Kirche und EU zu identifizieren. Dabei wird die Frage nach Anknüpfungspunkten und Gräben erörtert.
Beteiligte am Dialog: Hier werden die Akteure im Dialog näher betrachtet, insbesondere die Dialogführung innerhalb der Europäischen Union und die Rolle der COMECE (Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft). Der Abschnitt beschreibt die jeweiligen Strategien und Einflussmöglichkeiten der beteiligten Institutionen.
Zentrale Themen des säkularen Dialogs: Dieses Kapitel befasst sich mit zentralen Themen des Dialogs zwischen Kirche und EU, insbesondere Migration und Asyl sowie Religionsfreiheit. Es beleuchtet die unterschiedlichen Positionen im Dialog, analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten des kulturellen Austausches und untersucht die Rolle der Kirche in diesen Bereichen. Die Beobachtung der COMECE zur Religionsfreiheit und inner-europäische Handlungsfelder werden ebenfalls berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Dialog, Katholische Kirche, Europäische Union, Christlich-Europäisches Erbe, Säkularisierung/Postsäkularisierung, Religionsfreiheit, Migration, Asyl, COMECE, Ekklesiologie, David Tracy, Zweites Vatikanisches Konzil.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Dialog zwischen katholischer Kirche und Europäischer Union
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Dialog zwischen der katholischen Kirche und der Europäischen Union im Kontext des christlich-europäischen Erbes. Sie erörtert Möglichkeiten und Herausforderungen eines wertschätzenden Diskurses zwischen beiden Akteuren, beleuchtet deren Bezugspunkte und analysiert zentrale Themen des säkularen Dialogs.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt den Begriff des Dialogs, die Rechtfertigung der EU und der katholischen Kirche als Dialogpartner, die beteiligten Akteure (insbesondere die COMECE), und zentrale Themen des säkularen Dialogs wie Migration/Asyl und Religionsfreiheit. Die gegenseitige Bezugnahme und der Diskurs zwischen politischem Europa und katholischem Christentum stehen im Fokus.
Wie wird der Dialogbegriff definiert?
Der Dialogbegriff wird anhand verschiedener Formen der Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat erörtert. Es wird Bezug genommen auf das Zweite Vatikanische Konzil und den Dialogbegriff von David Tracy, der ihn als Win-Win-Situation mit offenem, gegenseitig würdigendem Gespräch versteht.
Warum werden die EU und die katholische Kirche als Dialogpartner ausgewählt?
Die Auswahl wird dadurch gerechtfertigt, dass die Arbeit die Grundlage der EU für ihren Bezug zum Christentum analysiert und die Ekklesiologie der katholischen Kirche untersucht, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Kirche und EU zu identifizieren und Anknüpfungspunkte sowie Gräben zu erörtern.
Welche Akteure sind am Dialog beteiligt, und welche Rolle spielen sie?
Die Arbeit betrachtet die Dialogführung innerhalb der Europäischen Union und die Rolle der COMECE (Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft), beschreibt deren Strategien und Einflussmöglichkeiten.
Welche zentralen Themen des säkularen Dialogs werden analysiert?
Zentrale Themen sind Migration und Asyl sowie Religionsfreiheit. Die Arbeit beleuchtet unterschiedliche Positionen im Dialog, analysiert Herausforderungen und Möglichkeiten des kulturellen Austausches und untersucht die Rolle der Kirche. Die Beobachtung der COMECE zur Religionsfreiheit und inner-europäische Handlungsfelder werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Begriff des Dialogs, Rechtfertigung der EU und der katholischen Kirche als Dialogpartner, Beteiligte am Dialog und Zentrale Themen des säkularen Dialogs, sowie ein Resümee.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dialog, Katholische Kirche, Europäische Union, Christlich-Europäisches Erbe, Säkularisierung/Postsäkularisierung, Religionsfreiheit, Migration, Asyl, COMECE, Ekklesiologie, David Tracy, Zweites Vatikanisches Konzil.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2019, Dialog am christlich-europäischen Erbe. Dialog und Dialogfähigkeit zwischen katholischer Kirche und Europäischer Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/990532