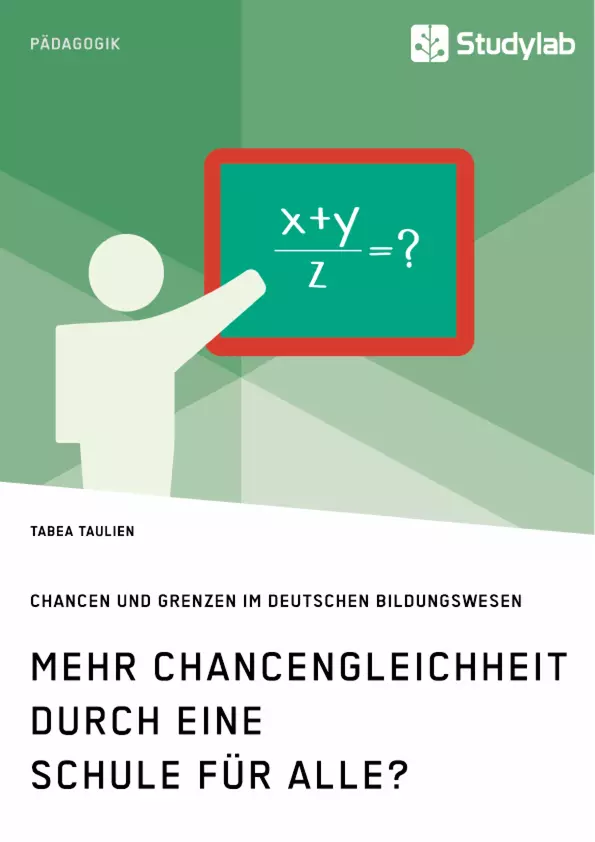Noch immer entscheidet die soziale Herkunft eines Kindes häufig über seine schulische Laufbahn und die anschließende Karriere. Das deutsche Bildungssystem behindert den Austausch zwischen verschiedenen sozialen Schichten. So entstehen Ungleichheiten, die einen starken Einfluss auf das Leben eines Menschen haben.
Ist eine Reform des Bildungssystems die geeignete Lösung für dieses Problem? Oder muss der Wandel in den Köpfen der Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen stattfinden? Tabea Taulien setzt sich in ihrer Publikation mit der Bildungsungleichheit im deutschen Schulsystem auseinander.
Eine mögliche Alternative wäre die Schule für alle, die keine Unterteilung in Mittelschule, Realschule und Gymnasium vornimmt. Eine gemeinsame Schulform könnte dafür sorgen, dass Schüler ihre erworbenen Denk- und Verhaltensweisen überdenken und diese sich nicht negativ auf den Schulerfolg auswirken. Die Chancen und Grenzen einer Schule für alle beleuchtet Tabea Taulien in diesem Buch.
Aus dem Inhalt:
- Chancengleichheit;
- Chancenverteilung;
- Bildungserfolg;
- Schulreform;
- Unterricht
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Chancengleichheit im Bildungssystem
- Bildungserfolg in Abhängigkeit von der sozialen Herkunft
- Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit
- Die Illusion der Chancengleichheit
- Die Familie als Reproduktionsinstanz bei Bourdieu
- Grundbegriffe der Bourdieuschen Ungleichheitstheorien
- Der Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg
- Ungleichheitsverstärkende Effekte im deutschen Schulsystem
- Soziale Ungleichheit innerhalb von Schulen
- Soziale Ungleichheit am Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe
- Soziale Ungleichheit zwischen den Schulformen
- Reduktion sozialer Ungleichheit durch Offenheit des Schulsystems?
- Chancen und Grenzen einer „Schule für Alle“ in Bezug auf die Chancengleichheit im Bildungssystem
- Chancen einer „Schule für Alle“
- Grenzen einer „Schule für Alle“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch analysiert die Chancen und Grenzen der Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem. Es beleuchtet die Herausforderungen, die aus der sozialen Herkunft und dem Einfluss der Familie auf den Bildungserfolg resultieren. Darüber hinaus werden die ungleichheitsverstärkenden Effekte im deutschen Schulsystem untersucht, um die Frage zu beantworten, ob eine „Schule für Alle“ tatsächlich zu mehr Chancengleichheit führen könnte.
- Soziale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem
- Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg
- Reproduktion sozialer Ungleichheit durch das Bildungssystem
- Chancen und Grenzen der „Schule für Alle“
- Kritik an den aktuellen Bildungsreformen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einleitung und stellt die Thematik der Chancengleichheit im Bildungssystem vor. Es werden grundlegende Begriffe wie Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit definiert. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg. Es werden die Theorien von Pierre Bourdieu und deren Relevanz für das Verständnis der Bildungsungleichheit im deutschen Kontext vorgestellt. Kapitel drei widmet sich den ungleichheitsverstärkenden Effekten im deutschen Schulsystem. Dabei werden verschiedene Ebenen der sozialen Ungleichheit innerhalb und zwischen den Schulen analysiert, um die Herausforderungen für die Chancengleichheit aufzuzeigen. Im vierten Kapitel werden die Chancen und Grenzen einer „Schule für Alle“ in Bezug auf die Chancengleichheit im Bildungssystem diskutiert. Hier werden verschiedene Ansätze und Reformen kritisch beleuchtet und in ihrer Wirkung auf die Bildungschancen verschiedener Bevölkerungsgruppen bewertet.
Schlüsselwörter
Chancengleichheit, Bildungssystem, soziale Herkunft, Familie, Bourdieu, Ungleichheit, Schulsystem, Bildungsreformen, „Schule für Alle“.
- Quote paper
- Tabea Taulien (Author), 2021, Mehr Chancengleichheit durch eine Schule für Alle? Chancen und Grenzen im deutschen Bildungswesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/990556