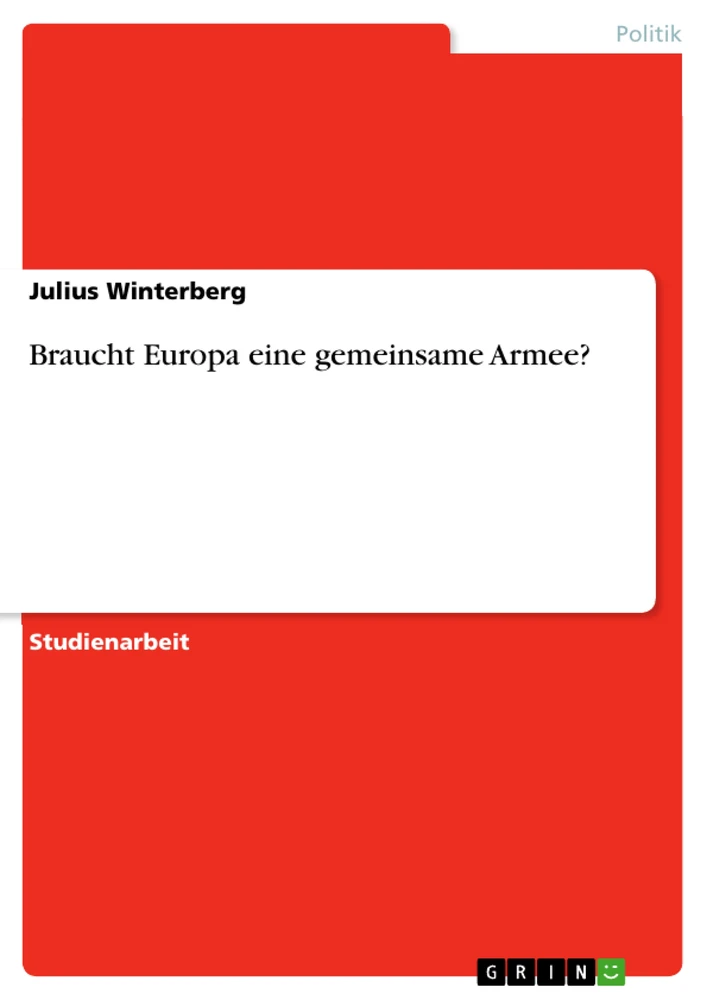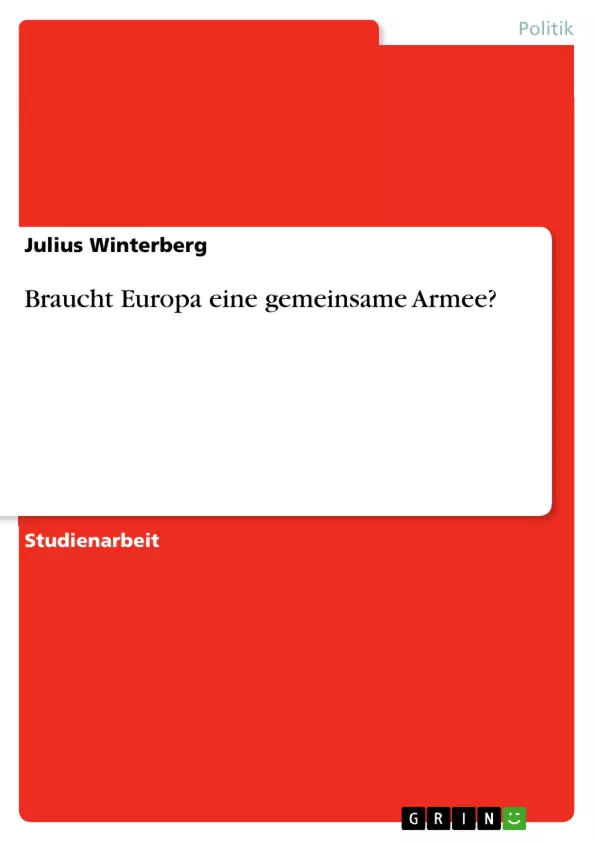In der Europäischen Union brodelt es gewaltig. Ereignisse wie die Flüchtlingskrise oder der Ukraine-Konflikt stellen die noch relativ junge europäische Union vor immer neue Herausforderungen und werfen die Frage auf, wie und ob man gemeinsam darauf reagieren soll. Doch was zählt überhaupt zu den Aufgaben eines solchen Staatenverbundes? Das Eurobarometer hat im zurückliegenden Jahr 2017 erneut gezeigt, dass die Sicherheit der Bürger auch heute noch immer oberste Priorität hat. 75 Prozent der Befragten Europäerinnen und Europäer erwarten, dass sich die europäische Union um die Verteidigungsangelegenheiten der Bürger kümmert und befürworten eine gemeinsame Sicherheitspolitik aller Mitgliedsstaaten.
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sieht deshalb eine gemeinsame Armee als logische Konsequenz und langfristiges Ziel des Projekts Europa. Er bezieht sich dabei nicht nur auf die Notwendigkeit aufgrund der großen Abhängigkeit zu den Vereinigten Staaten von Amerika als wichtigster Schutzpartner der Europäischen Union, sondern auch um als internationaler Akteur wahrgenommen zu werden und eigendynamisch handlungsfähig zu sein.
Doch wie steht es um die Sicherheit der Bürger Europas? Die Lage ist wahrlich nicht die schlechteste, stößt allerdings in Ausnahmesituationen wie wir sie in den vergangenen Jahren erlebt haben, immer wieder an ihre Grenzen. Nationale Streitkräfte, internationale Bündnispartner aber auch gemeinschaftliche Militäroperationen und -einsätze spannen ein umfangreiches wenngleich nicht unbedingt effizientes Verteidigungsnetz über die europäische Union. Braucht Europa eine gemeinsame Armee?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition einer Europäischen Armee
- 3. Ausgangssituation
- Vertrag von Lissabon
- Internationaler Terrorismus
- Flüchtlingskrise
- 4. Mögliche Umsetzung einer Europäischen Armee
- Errichtung einer föderalen Armee der EU
- Beibehaltung des gegenwärtigen Zustands
- Europäische Armee durch Angleichung nationaler Streitkräfte
- 5. Probleme
- Legitimation der Europäischen Union
- Nationale Parlamente
- Mangelndes „Wir-Gefühl“ in Europa
- 6. Fazit
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Der Weg ist das Ziel
- Quo vadis: Europa als europäischer Bundesstaat?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Armee. Ziel ist es, die Argumente für und gegen eine solche Armee zu beleuchten und die Herausforderungen ihrer Umsetzung zu analysieren.
- Definition und Konzeption einer Europäischen Armee
- Die aktuelle Sicherheitslage in Europa und ihre Herausforderungen
- Mögliche Modelle für die Umsetzung einer gemeinsamen Armee
- Politische und rechtliche Hürden für die Gründung einer europäischen Armee
- Das europäische Sicherheitsgefühl und seine Bedeutung für die Debatte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach der Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Armee. Sie verweist auf aktuelle Ereignisse wie die Flüchtlingskrise und den Ukraine-Konflikt, welche die europäische Union vor große Herausforderungen stellen und die Debatte um eine gemeinsame Sicherheitspolitik befeuern. Die hohe Priorität, die europäische Bürger der Sicherheit beimessen, wird anhand von Eurobarometer-Ergebnissen belegt, wodurch die Relevanz der Fragestellung unterstrichen wird. Die Zitate von Jean-Claude Juncker betonen die Notwendigkeit einer stärkeren europäischen Verteidigungsunion und einer langfristigen Perspektive hin zu einer gemeinsamen Armee, nicht nur wegen der Abhängigkeit von den USA, sondern auch um als eigenständiger internationaler Akteur handlungsfähig zu sein.
2. Definition einer Europäischen Armee: Dieses Kapitel befasst sich mit der Klärung des Begriffs „Europäische Armee“ im Kontext der aktuellen Situation. Es werden zentrale Fragen zur Organisation und Legitimation möglicher Einsätze aufgeworfen, wie z.B. die Kommandogewalt, die Legitimation von Einsätzen und die Vereinbarkeit mit nationalem Recht. Der Duden-Eintrag zum Begriff „Armee“ wird zitiert, um die grundsätzliche Frage nach der Rolle Europas als zukünftiger Akteur zu diskutieren. Die unterschiedlichen Positionen von Teilen der EU, die sich dem Nationalismus verbunden sehen (z.B. Ungarn), und Vertretern wie Jean-Claude Juncker und Martin Schulz, die ein geeintes Europa anstreben, werden einander gegenübergestellt. Diese unterschiedlichen Perspektiven bilden die Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema.
3. Ausgangssituation: Dieses Kapitel beleuchtet die Sicherheitslage in Europa. Der Vertrag von Lissabon, der internationale Terrorismus und die Flüchtlingskrise werden als wichtige Faktoren genannt, die die Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik unterstreichen. Es wird beschrieben, dass nationale Streitkräfte, internationale Bündnispartner und gemeinschaftliche Militäroperationen zwar ein Verteidigungsnetz bilden, dieses aber nicht unbedingt effizient ist. Diese Darstellung der komplexen Situation dient als Grundlage für die Argumentation der folgenden Kapitel.
4. Mögliche Umsetzung einer Europäischen Armee: Hier werden verschiedene Modelle für die Umsetzung einer europäischen Armee präsentiert: die Errichtung einer föderalen Armee, die Beibehaltung des gegenwärtigen Zustands und die Angleichung nationaler Streitkräfte. Diese Darstellung der Optionen schafft eine differenzierte Perspektive auf die Herausforderungen der Umsetzung und bietet verschiedene Lösungsansätze, die in der weiteren Analyse gewichtet werden.
5. Probleme: Dieses Kapitel widmet sich den Problemen, die mit der Umsetzung einer europäischen Armee verbunden sind. Die Legitimation der Europäischen Union, die Rolle nationaler Parlamente und das mangelnde „Wir-Gefühl“ in Europa werden als zentrale Herausforderungen genannt. Diese kritische Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten unterstreicht die Komplexität des Themas und bildet eine wichtige Grundlage für das Fazit.
Schlüsselwörter
Europäische Armee, Sicherheitspolitik, EU, Verteidigung, Nationalstaaten, Integration, Legitimität, Zusammenarbeit, Flüchtlingskrise, Internationaler Terrorismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: "Eine Europäische Armee?"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Notwendigkeit und Umsetzbarkeit einer gemeinsamen europäischen Armee. Sie beleuchtet Argumente dafür und dagegen und analysiert die Herausforderungen ihrer Umsetzung.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Konzeption einer Europäischen Armee, die aktuelle Sicherheitslage in Europa (inkl. Vertrag von Lissabon, internationaler Terrorismus und Flüchtlingskrise), mögliche Umsetzungsmodelle (föderale Armee, Beibehaltung des Status Quo, Angleichung nationaler Streitkräfte), politische und rechtliche Hürden (Legitimation der EU, Rolle nationaler Parlamente, "Wir-Gefühl"), sowie die Bedeutung des europäischen Sicherheitsgefühls für die Debatte.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit besteht aus sechs Kapiteln: 1. Einleitung, 2. Definition einer Europäischen Armee, 3. Ausgangssituation, 4. Mögliche Umsetzung einer Europäischen Armee, 5. Probleme, 6. Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas, beginnend mit der Einleitung und der Definition des Kernbegriffs, über die Analyse der aktuellen Lage und möglicher Lösungen bis hin zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und einem abschließenden Fazit.
Wie wird der Begriff "Europäische Armee" definiert?
Das Kapitel "Definition einer Europäischen Armee" klärt den Begriff im Kontext der aktuellen Situation. Es werden zentrale Fragen zur Organisation und Legitimation möglicher Einsätze (Kommandogewalt, Legitimation von Einsätzen, Vereinbarkeit mit nationalem Recht) aufgeworfen. Die unterschiedlichen Positionen nationalistischer Kräfte und Befürworter eines geeinten Europas werden einander gegenübergestellt.
Welche Herausforderungen werden bei der Umsetzung einer Europäischen Armee genannt?
Die Herausforderungen umfassen die Legitimation der Europäischen Union, die Rolle nationaler Parlamente und das mangelnde "Wir-Gefühl" in Europa. Die Hausarbeit betont die Komplexität dieser Probleme.
Welche Modelle für die Umsetzung einer Europäischen Armee werden vorgestellt?
Die Hausarbeit präsentiert drei Modelle: die Errichtung einer föderalen Armee, die Beibehaltung des gegenwärtigen Zustands und die Angleichung nationaler Streitkräfte. Diese Optionen werden differenziert dargestellt und hinsichtlich ihrer Herausforderungen analysiert.
Welche Rolle spielen aktuelle Ereignisse wie die Flüchtlingskrise und der internationale Terrorismus?
Die Flüchtlingskrise und der internationale Terrorismus werden als wichtige Faktoren genannt, die die Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik unterstreichen. Sie werden im Kapitel "Ausgangssituation" im Kontext des Vertrags von Lissabon diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert den weiteren Weg hin zu einer möglichen europäischen Armee, inklusive der Frage nach einem europäischen Bundesstaat.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäische Armee, Sicherheitspolitik, EU, Verteidigung, Nationalstaaten, Integration, Legitimität, Zusammenarbeit, Flüchtlingskrise, Internationaler Terrorismus.
- Arbeit zitieren
- Julius Winterberg (Autor:in), 2018, Braucht Europa eine gemeinsame Armee?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/991025