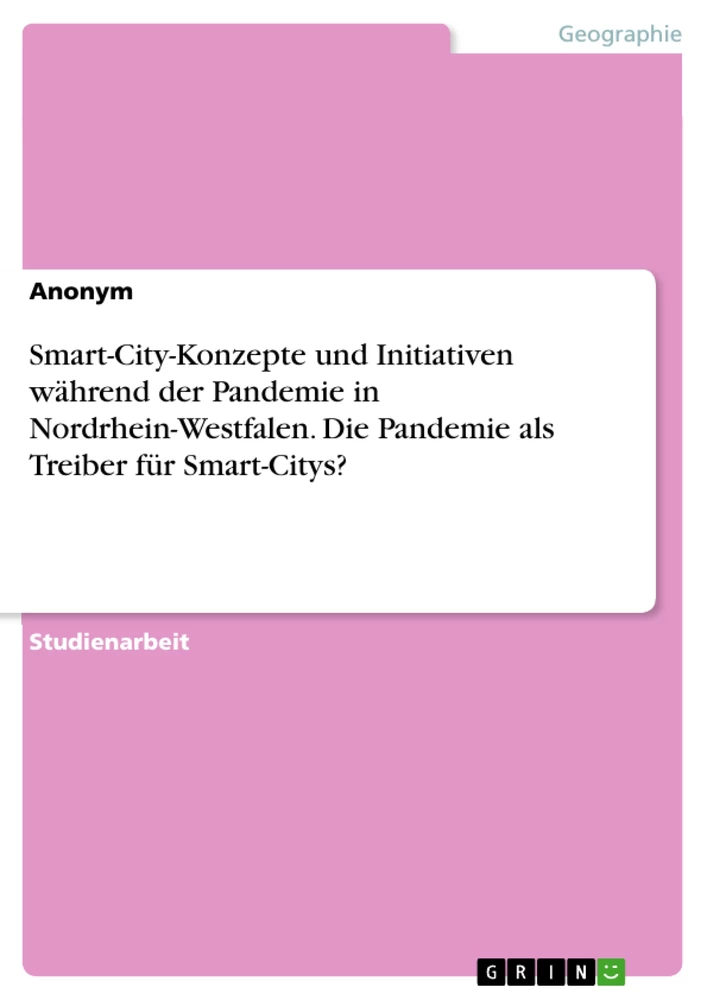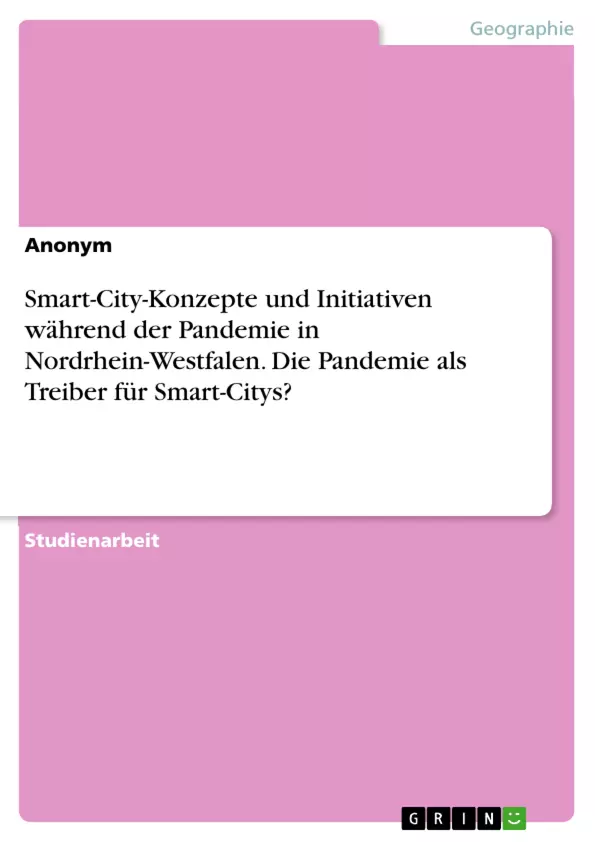Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob die Pandemie als eine Art Treiber auf die Smart-City Entwicklung Einfluss hat. Hierfür werden, neben der Begriffsgrundlagen, verschiedene pandemiebedingte Smart-City Lösungen in NRW vorgestellt. Zusätzlich wird erläutert, welche Digitalisierungsinitiativen in der Verwaltung stattgefunden haben. Zur Beantwortung der Forschungsfrage muss sich die Frage gestellt werden, ob die beschleunigte Entwicklung einen grundsätzlichen Einfluss auf die Smart-City-Lösungen hat oder diese nur auf die veränderten Rahmenbedingungen zurückzuführen ist und damit, obendrein durch die pandemiebedingten finanziellen Einbußen, in absehbarer Zeit wieder abnimmt.
Die COVID-19-Pandemie prägt seit Anfang des Jahres 2020 das gesellschaftliche und private Leben auf globaler Ebene. Angefangen von der Verwaltung, über Schulen und Universitäten bis hin zum medizinischen Sektor: Von jetzt auf gleich mussten für sämtliche städtischen Lebensbereiche digitale Angebote und Zugänge geschaffen werden. Im Laufe des Jahres entwickelten sich so verschiedene smarte Digitalisierungsinitiativen von Bund, Ländern, Städten und Kommunen. Lösungen wie Homeoffice, Online-Antragstellung und Onlinemeetings führten dazu, dass die Pandemie schon jetzt als Digitalisierungsbooster angesehen wird. Dabei demonstriert sie uns auf vielerlei Weise, dass die Digitalisierung viel zu lange vernachlässigt worden ist. Die Pandemie bringt den digitalen Rückstand ans Licht, dabei hilft die Digitalisierung den Bürgern und den Behörden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Begriffsgrundlage Smart-City
- Leistungsebenen einer Smart-City
- Die COVID-19 Pandemie in Deutschland
- Smart-City in Zeiten der Pandemie
- Smart-City-Lösungen als Antwort auf die Pandemie
- Digitalisierungsinitiativen in der Verwaltung
- Kritische Würdigung
- Der Bund als Treiber?
- Ohne Digitalstrategie keine Smart-City
- Wandel der Smart-City-Strategien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Entwicklung von Smart-City-Konzepten und -Initiativen in Nordrhein-Westfalen. Sie befasst sich mit der Frage, ob die Pandemie als Treiber für die Smart-City-Entwicklung fungiert und welche digitalen Lösungen als Reaktion auf die Krise entstanden sind.
- Definition und Entwicklung des Smart-City-Konzepts
- Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf städtische Lebensbereiche
- Smart-City-Lösungen als Antwort auf die Pandemie
- Digitalisierungsinitiativen in der Verwaltung
- Kritische Würdigung der Smart-City-Entwicklung im Kontext der Pandemie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage der Hausarbeit vor und beschreibt den aktuellen Kontext der Smart-City-Entwicklung im Zuge der COVID-19-Pandemie. Sie verdeutlicht die Bedeutung von digitalen Lösungen in Zeiten der Krise.
- Grundlagen: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Smart-City und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf das Konzept. Es beschreibt die verschiedenen Leistungsebenen einer Smart-City und erläutert die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Deutschland.
- Smart-City in Zeiten der Pandemie: Dieses Kapitel analysiert die Smart-City-Lösungen als Antwort auf die COVID-19-Pandemie. Es beleuchtet die Digitalisierungsinitiativen in der Verwaltung und untersucht die Rolle der Pandemie als Treiber für die Smart-City-Entwicklung.
- Kritische Würdigung: In diesem Kapitel werden die Chancen und Herausforderungen der Smart-City-Entwicklung im Kontext der Pandemie kritisch diskutiert. Es wird untersucht, ob die Pandemie zu einem nachhaltigen Wandel in der Smart-City-Strategie führt.
Schlüsselwörter
Smart City, Digitalisierung, Pandemie, COVID-19, Nordrhein-Westfalen, Verwaltung, Digitalisierungsinitiativen, Smart-City-Lösungen, Treiber, Nachhaltigkeit, Kritik, Wandel, Strategien.
Häufig gestellte Fragen
War die Pandemie ein Treiber für Smart Cities in NRW?
Ja, die COVID-19-Pandemie wirkte als Digitalisierungsbooster, da Kommunen gezwungen waren, kurzfristig digitale Angebote für Verwaltung, Bildung und Medizin zu schaffen.
Welche Smart-City-Lösungen entstanden während der Pandemie?
Beispiele sind Homeoffice-Lösungen, Online-Antragstellungen in der Verwaltung sowie digitale Meeting-Strukturen und Informationsportale.
Was sind die Leistungsebenen einer Smart-City?
Eine Smart-City umfasst verschiedene Bereiche wie smarte Verwaltung (E-Government), Mobilität, Energieeffizienz und digitale Teilhabe der Bürger.
Welche Rolle spielt der Bund bei der Smart-City-Entwicklung?
Der Bund fungiert oft als Treiber durch Förderprogramme und gesetzliche Rahmenbedingungen, die Städte zur Digitalisierung motivieren.
Wird die Entwicklung nach der Pandemie wieder abnehmen?
Die Arbeit diskutiert kritisch, ob finanzielle Einbußen die Entwicklung bremsen könnten oder ob der geschaffene digitale Standard dauerhaft bestehen bleibt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Smart-City-Konzepte und Initiativen während der Pandemie in Nordrhein-Westfalen. Die Pandemie als Treiber für Smart-Citys?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/991291