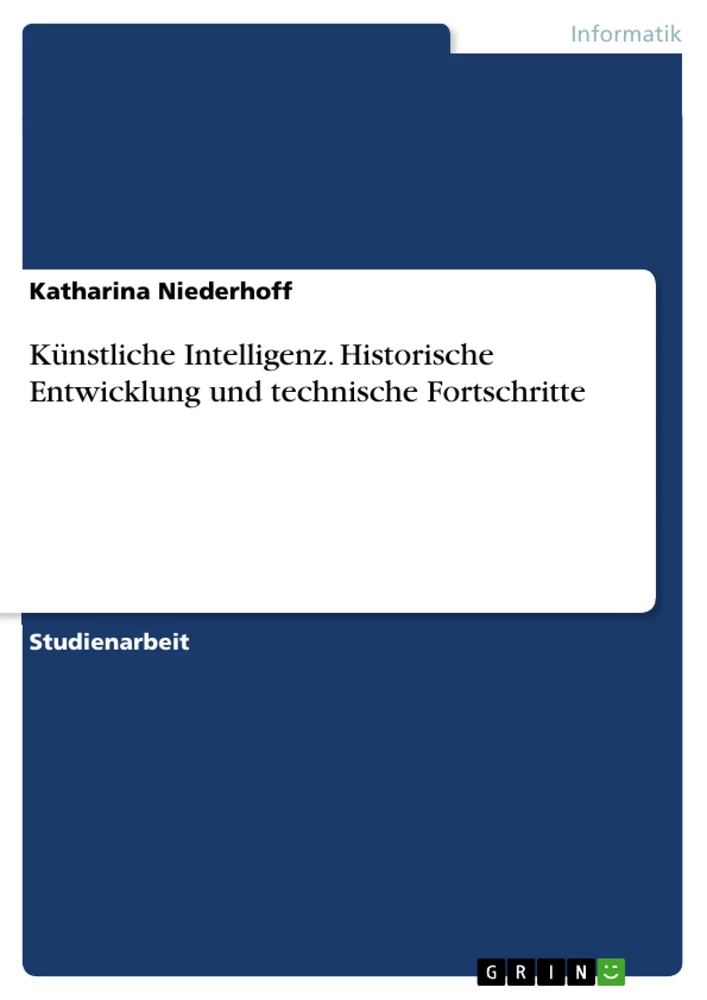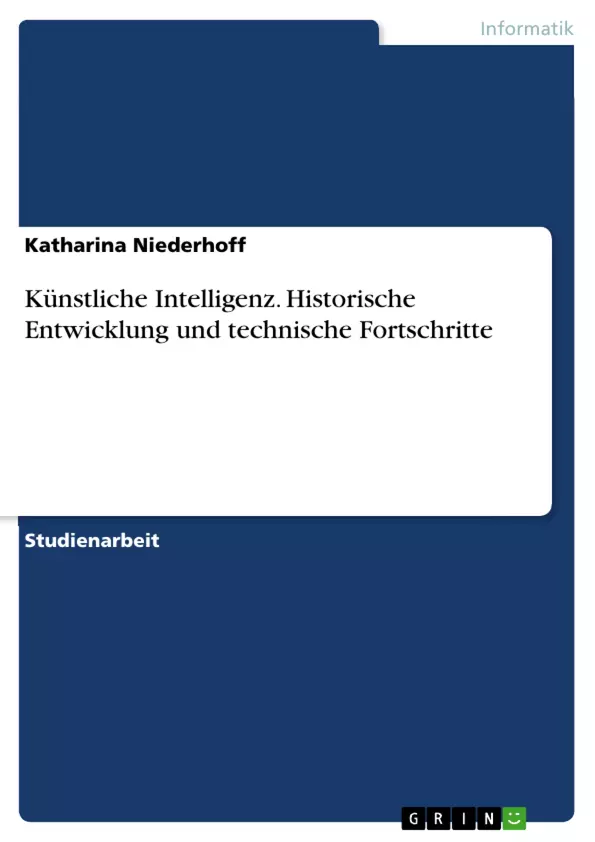In dieser Hausarbeit geht es um die technischen Fortschritte der künstlichen Intelligenz. Unternehmen haben durch den technologischen Fortschritt zunehmend Möglichkeiten, ihre Strategien und Vorgehensweisen strukturell zu verändern. Diese Veränderungen werden oftmals zum Erhalt von Wettbewerbsvorteilen gegenüber anderen Unternehmen auf dem Markt durchgeführt. Die künstliche Intelligenz gilt in 2018 als neueste große Veränderung. Es gibt immer mehr neue künstliche Intelligenzen und es wird weiterhin mehr Geld in die Forschung dieser investiert.
Inhaltsverzeichnis
- Bedeutung des technologischen Fortschritts bei der Entstehung von künstlicher Intelligenz
- Entwicklung von künstlicher Intelligenz durch technologischen Fortschritt
- Grundlagen zum technologischen Fortschritt und zur künstlichen Intelligenz
- Historische Entwicklung der künstlichen Intelligenz
- Auswertung von Big Data im Marketing
- Auswertung von Big Data durch künstliche Intelligenz als Einsatzgebiet
- Algorithmische Defizite bei der Auswertung von Big Data als Problembereich
- Kontrolle der künstlichen Intelligenz durch menschliches Eingreifen als korrespondierender Lösungsansatz
- Nutzung von Chatbots im Marketing
- Nutzung von Chatbots als Kundenberater durch künstliche Intelligenz als Einsatzgebiet
- Fehlendes Vertrauen der Nutzer gegenüber Chatbots als Problembereich
- Simulieren einer Persönlichkeit des Chatbots als korrespondierender Lösungsansatz
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss des technologischen Fortschritts auf die Entstehung künstlicher Intelligenz, ihre aktuellen Marketinganwendungen und damit verbundene Herausforderungen sowie mögliche Lösungsansätze. Das Ziel ist es, die historische Entwicklung nachzuzeichnen, relevante Einsatzgebiete im Marketing zu analysieren und korrespondierende Problembereiche mit Lösungsvorschlägen zu diskutieren.
- Der Einfluss des technologischen Fortschritts auf die Entwicklung von KI
- Aktuelle Einsatzgebiete von KI im Marketing (Big Data Analyse und Chatbots)
- Algorithmische Defizite und das Problem des Nutzervertrauens in KI-Systeme
- Menschliche Kontrolle von KI und die Gestaltung von Chatbot-Persönlichkeiten als Lösungsansätze
- Historische Entwicklung der künstlichen Intelligenz
Zusammenfassung der Kapitel
Bedeutung des technologischen Fortschritts bei der Entstehung von künstlicher Intelligenz: Der technologische Fortschritt ermöglicht Unternehmen, ihre Strategien grundlegend zu verändern, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Künstliche Intelligenz (KI) wird als eine der größten Veränderungen in diesem Kontext angesehen, insbesondere im Marketing, wo sie Chancen zur Auswertung von Big Data und zur Implementierung von Chatbots bietet. Das zunehmende mobile Internet und die sozialen Medien führen zu exponentiell wachsenden Datenmengen, die die Grundlage für KI-Anwendungen bilden. Die Arbeit untersucht, wie technologische Entwicklungen zur Entstehung von KI geführt haben und welche Einsatzgebiete und Herausforderungen im Marketing bestehen.
Entwicklung von künstlicher Intelligenz durch technologischen Fortschritt: Dieses Kapitel klärt den Begriff der künstlichen Intelligenz und beleuchtet deren Entwicklung im Kontext des technologischen Fortschritts. Ausgehend von der Definition von Intelligenz aus der Psychologie wird künstliche Intelligenz als simulierte oder künstlich geschaffene Intelligenz beschrieben. Die Arbeit verdeutlicht die stetige Weiterentwicklung der KI seit den 1950er Jahren, betont den rasanten technologischen Fortschritt und die zentrale Rolle des Internets seit den 1990er Jahren in Verbindung mit Smartphones und sozialen Medien. Es wird auf die Bedeutung des maschinellen Lernens und des tiefen Lernens, einschließlich künstlicher neuronaler Netze, eingegangen und deren Funktion im Kontext der automatisierten Auswertung großer Datensätze erläutert.
Auswertung von Big Data im Marketing: Dieses Kapitel behandelt die Auswertung von Big Data mit Hilfe von KI im Marketing. Die Analyse großer Datensätze soll neue Erkenntnisse und statistische Zusammenhänge liefern. Es werden jedoch auch mögliche algorithmische Defizite bei der Auswertung von Big Data als Problembereich genannt. Als Lösungsansatz wird die menschliche Kontrolle und Überwachung der KI-gestützten Auswertungen vorgeschlagen, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten und potenzielle Verzerrungen zu minimieren.
Nutzung von Chatbots im Marketing: Hier wird die Nutzung von Chatbots als Kundenberater durch KI im Marketing untersucht. Die schnelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von Informationen für Kunden ist ein zentraler Aspekt. Ein wichtiger Problembereich ist das fehlende Vertrauen der Nutzer in Chatbots. Als Lösungsansatz wird das Simulieren einer Persönlichkeit für den Chatbot vorgeschlagen, um die Interaktion für den Nutzer ansprechender und vertrauenswürdiger zu gestalten. Das Design der Chatbot-Persönlichkeit zielt auf die Steigerung der Akzeptanz und Interaktionsbereitschaft ab.
Schlüsselwörter
Künstliche Intelligenz, Technologischer Fortschritt, Marketing, Big Data, Chatbots, Algorithmen, Maschinelles Lernen, Tiefes Lernen, Künstliche Neuronale Netze, Nutzervertrauen, Lösungsansätze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Künstliche Intelligenz im Marketing
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Einfluss des technologischen Fortschritts auf die Entstehung und Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) im Marketing. Sie analysiert aktuelle Einsatzgebiete von KI, die damit verbundenen Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze. Ein Schwerpunkt liegt auf der Auswertung von Big Data und der Nutzung von Chatbots.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Bedeutung des technologischen Fortschritts für die Entwicklung von KI, die historische Entwicklung der KI, die Anwendung von KI zur Auswertung von Big Data im Marketing, die Nutzung von Chatbots im Marketing, algorithmische Defizite bei der Datenanalyse, das Problem des Nutzervertrauens in KI-Systeme, und Lösungsansätze wie die menschliche Kontrolle von KI und die Gestaltung von Chatbot-Persönlichkeiten.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, die sich mit der Bedeutung des technologischen Fortschritts für KI, der Entwicklung der KI, der Auswertung von Big Data im Marketing und der Nutzung von Chatbots im Marketing befassen. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen.
Welche konkreten Einsatzgebiete von KI im Marketing werden analysiert?
Die Seminararbeit analysiert insbesondere zwei Einsatzgebiete von KI im Marketing: die Auswertung von Big Data zur Gewinnung neuer Erkenntnisse und die Nutzung von Chatbots als Kundenberater.
Welche Herausforderungen werden im Zusammenhang mit der KI-Anwendung im Marketing identifiziert?
Die Arbeit identifiziert zwei zentrale Herausforderungen: algorithmische Defizite bei der Auswertung von Big Data, die zu ungenauen oder verzerrten Ergebnissen führen können, und das fehlende Vertrauen der Nutzer in KI-Systeme, insbesondere in Chatbots.
Welche Lösungsansätze werden in der Seminararbeit vorgeschlagen?
Als Lösungsansätze werden vorgeschlagen: die menschliche Kontrolle und Überwachung von KI-gestützten Auswertungen, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, und das Simulieren einer Persönlichkeit für Chatbots, um das Nutzervertrauen zu stärken und die Interaktion ansprechender zu gestalten.
Welche Rolle spielt der technologische Fortschritt in der Entwicklung von KI?
Der technologische Fortschritt, insbesondere die Entwicklung des mobilen Internets und sozialer Medien, führt zu exponentiell wachsenden Datenmengen (Big Data), die die Grundlage für KI-Anwendungen bilden. Die Arbeit betont die zentrale Rolle des Internets und die Bedeutung von maschinellem Lernen und Deep Learning für die Entwicklung von KI.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Seminararbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Künstliche Intelligenz, Technologischer Fortschritt, Marketing, Big Data, Chatbots, Algorithmen, Maschinelles Lernen, Tiefes Lernen, Künstliche Neuronale Netze, Nutzervertrauen und Lösungsansätze.
Welche historische Entwicklung der künstlichen Intelligenz wird dargestellt?
Die Arbeit zeichnet die historische Entwicklung der KI seit den 1950er Jahren nach und hebt den rasanten technologischen Fortschritt und die zentrale Rolle des Internets seit den 1990er Jahren hervor, insbesondere in Verbindung mit Smartphones und sozialen Medien.
- Quote paper
- Katharina Niederhoff (Author), 2020, Künstliche Intelligenz. Historische Entwicklung und technische Fortschritte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/991630