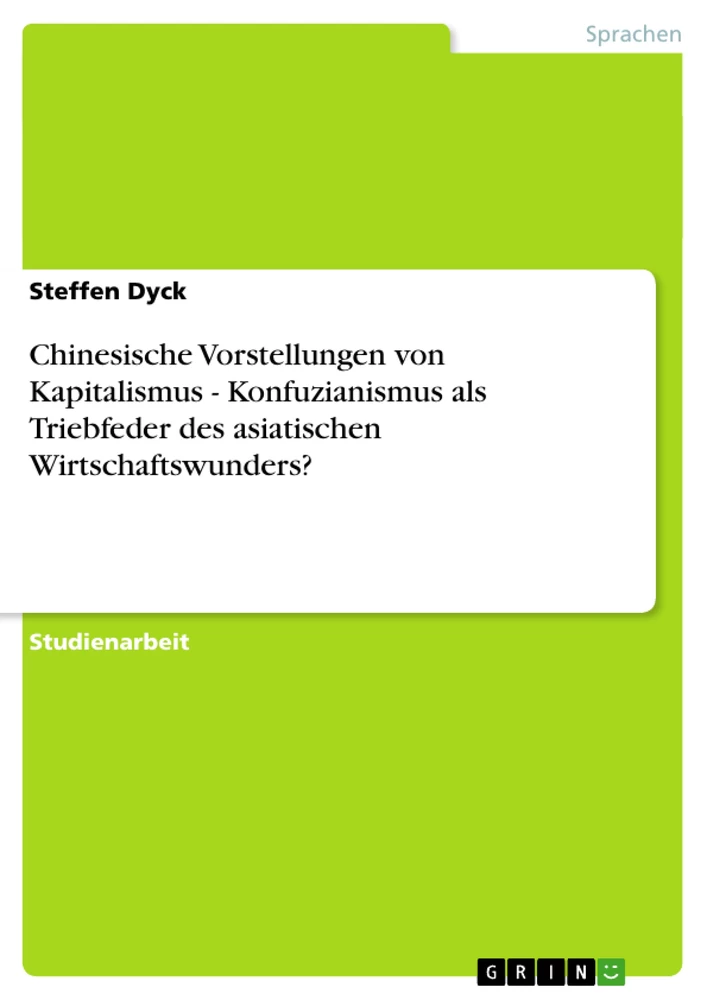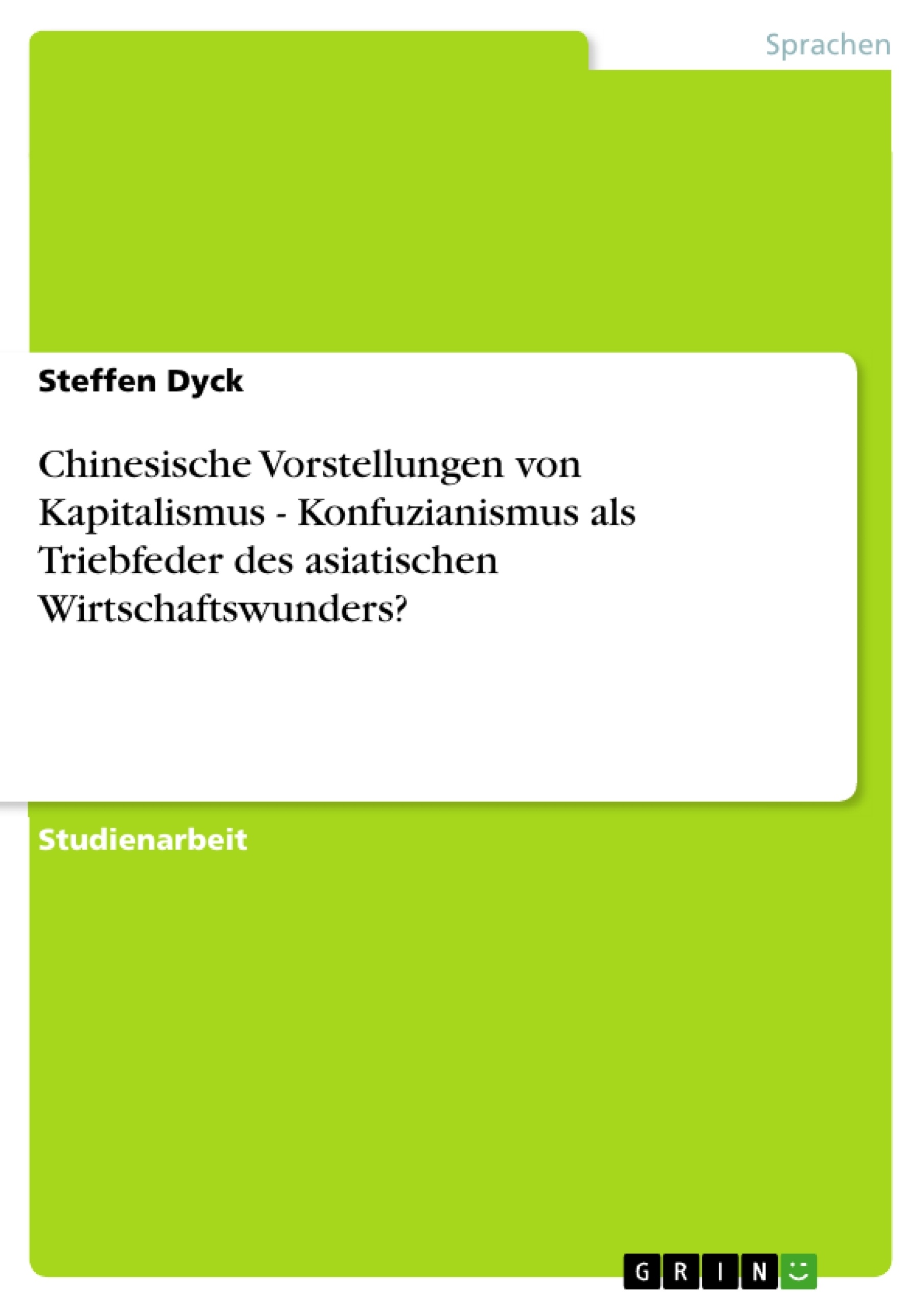"Chinas Bürgerkönig" Jiang Zemin will, dass künftig "auch Kapitalisten (...) in Chinas KP (...) ihre kommunistische Heimat finden" , titelte die Wochenzeitung "Die Zeit" unlängst im Rahmen einer dreiteiligen Serie über "Chinas neue Klassengesellschaft". Der Artikel porträtiert im Rahmen der Öffnungs- und Reformpolitik der achtziger Jahre zu Reichtum gekommene Möbelimporteure und Internetunternehmer, eben jene Kapitalisten, die nun auch in der KPCh willkommen sind. Dieser Artikel steht mit seiner Kernaussage - die wirtschaftlichen Reformen als Wegbereiter für wachsende persönliche Freiheiten und auch Stabilität - stellvertretend für eines der vielen Mosaiksteinchen, die das Chinabild im Westen prägen. China dient vielen als Projektionsfläche ihrer Hoffnungen - "der Markt der Zukunft" - aber auch der Angst des Westens vor einer von einem wirtschaftlich erstarkenden China ausgehenden Gefahr. Ein Zeichen dafür ist auch die Unzahl von Veröffentlichungen im Bereich der Ratgeber für Geschäftsleute, die beabsichtigen, in China aktiv zu werden. Auf der anderen Seite führt der zweifellos mit der Reformpolitik verbundene zunehmende Wohlstand in China selbst zu einer Veränderung in der Haltung dem Westen gegenüber.
In der vorliegenden Hausarbeit möchte ich versuchen, chinesische Vorstellungen von Kapitalismus mit Blick auf die Debatte um einen Zusammenhang zwischen Konfuzianismus und Kapitalismus mit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik der VR China nach dem Ende der Kulturrevolution 1976 und dem Sturz der Viererbande darzustellen. Zunächst möchte ich in Abschnitt II einige der in dieser Arbeit verwendeten Begriffe näher erläutern, die - obwohl teilweise alltäglicher Sprachgebrauch - bei näherer Betrachtung problematische Züge aufweisen. Als Basis der Darstellung obengenannter Debatte ist dann ein kurzer Abriss des historischen Wandels im Westen hin zum Kapitalismus und der damit verbundenen Veränderung seiner Haltung China gegenüber notwendig. Darüberhinaus erscheint es mir sinnvoll, die Rezeption des Kapitalismuskonzepts in China und die generelle Haltung Chinas dem Westen gegenüber ab dem Ende des Opiumkriegs im Jahre 1842 und der damit verbundenen Öffnung Chinas für die westlichen imperialistischen Mächte zu umreißen.
Im Hauptteil der Arbeit sollen verschiedene Standpunkte und Sichtweisen im Hinblick auf die Frage nach einem Zusammenhang von Konfuzianismus auf der einen und Kapitalismus auf der anderen Seite dargestellt und erörtert werden [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Erläuterung der verwendeten Begriffe
- III. Abriss der historischen Entwicklung im Westen und in China
- III.1 Die Entwicklung im Westen
- III.2 Die historische Entwicklung in China ab 1842
- III.3 Zusammenfassung
- IV. Ansätze zur Erklärung des asiatischen Wirtschaftswunders
- V. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht chinesische Vorstellungen von Kapitalismus im Kontext der Debatte um den Zusammenhang zwischen Konfuzianismus und dem wirtschaftlichen Aufstieg Chinas seit den Reformen von 1976. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Kapitalismus im Westen und in China, analysiert unterschiedliche Perspektiven auf die Rolle des Konfuzianismus im asiatischen Wirtschaftswunder und untersucht die Bedeutung der verwendeten Begriffe.
- Chinesische Wahrnehmung von Kapitalismus
- Der Einfluss des Konfuzianismus auf die wirtschaftliche Entwicklung Chinas
- Historischer Vergleich der Entwicklung des Kapitalismus im Westen und in China
- Analyse der Begriffe "Westen", "China" und "Kapitalismus"
- Diskussion verschiedener Erklärungsansätze für das asiatische Wirtschaftswunder
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die unterschiedlichen Perspektiven auf China im Westen, sowohl hinsichtlich Hoffnungen als auch Ängste. Sie umreißt das Ziel der Hausarbeit, chinesische Vorstellungen von Kapitalismus im Kontext des Konfuzianismus zu untersuchen, und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Erläuterung wichtiger Begriffe, einen historischen Abriss und eine Analyse verschiedener Erklärungsansätze umfasst. Der Fokus liegt auf der Verbindung von wirtschaftlichen Reformen und der sich verändernden Haltung Chinas zum Westen.
II. Erläuterung der verwendeten Begriffe: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition zentraler Begriffe wie "Westen" und "China", die als nicht statisch und kulturell definiert werden. Der "Westen" wird mit griechischer und römischer Tradition, christlichem Glauben und romanischen/germanischen Sprachen verbunden, während "China" neben der VR China auch Taiwan, Hongkong und Singapur umfasst. Die Definition von "Kapitalismus" wird ebenfalls diskutiert, wobei der Fokus auf Privateigentum, individuellen Freiheiten, marktwirtschaftlichem Wettbewerb und der Trennung von Politik und Wirtschaft liegt. Die Schwierigkeiten bei der Definition von "konfuzianischer Tradition" werden hervorgehoben, die sich über verschiedene Interpretationen und historische Entwicklungen erstreckt.
III. Abriss der historischen Entwicklung im Westen und in China: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die historische Entwicklung des Kapitalismus im Westen und in China. Die Entwicklung im Westen wird skizziert, wobei die Entstehung und Definition des Kapitalismus hervorgehoben werden. Im Bezug auf China wird die historische Entwicklung seit dem Opiumkrieg von 1842 beleuchtet, wobei die Öffnung Chinas für westliche Mächte und die damit verbundenen Veränderungen in der Haltung Chinas dem Westen gegenüber analysiert werden. Das Kapitel betont die komplexen und sich verändernden Beziehungen zwischen beiden Kulturen.
IV. Ansätze zur Erklärung des asiatischen Wirtschaftswunders: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Theorien und Ansätze zur Erklärung des asiatischen Wirtschaftswunders und analysiert die Rolle des Konfuzianismus in diesem Kontext. Es präsentiert und diskutiert gegensätzliche Meinungen über den Einfluss des Konfuzianismus auf die wirtschaftliche Entwicklung, die sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte beleuchten. Der Fokus liegt auf der aktuellen Relevanz dieser Debatte.
Schlüsselwörter
Kapitalismus, Konfuzianismus, Wirtschaftswunder, China, Westen, Reform- und Öffnungspolitik, historische Entwicklung, asiatische Werte, kulturelle Gemeinsamkeiten, Wirtschaftsreformen.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Chinesische Vorstellungen von Kapitalismus im Kontext des Konfuzianismus
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht chinesische Vorstellungen von Kapitalismus im Kontext der Debatte um den Zusammenhang zwischen Konfuzianismus und dem wirtschaftlichen Aufstieg Chinas seit den Reformen von 1976. Sie beleuchtet die Entwicklung des Kapitalismus im Westen und in China, analysiert unterschiedliche Perspektiven auf die Rolle des Konfuzianismus im asiatischen Wirtschaftswunder und untersucht die Bedeutung der verwendeten Begriffe.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Chinesische Wahrnehmung von Kapitalismus, Einfluss des Konfuzianismus auf die wirtschaftliche Entwicklung Chinas, historischer Vergleich der Entwicklung des Kapitalismus im Westen und in China, Analyse der Begriffe "Westen", "China" und "Kapitalismus", und Diskussion verschiedener Erklärungsansätze für das asiatische Wirtschaftswunder.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Erläuterung der verwendeten Begriffe, Abriss der historischen Entwicklung im Westen und in China, Ansätze zur Erklärung des asiatischen Wirtschaftswunders und Zusammenfassung. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Ziele der Arbeit. Die Kapitel zwei bis vier behandeln die jeweiligen Themenschwerpunkte im Detail. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Begriffe werden in der Hausarbeit definiert?
Zentrale Begriffe wie "Westen" (mit Bezug auf griechisch-römische Tradition, christlichem Glauben und romanischen/germanischen Sprachen) und "China" (einschließlich VR China, Taiwan, Hongkong und Singapur) werden definiert und ihre kulturelle Bedeutung erläutert. Auch der Begriff "Kapitalismus" (Privateigentum, individuelle Freiheiten, marktwirtschaftlicher Wettbewerb, Trennung von Politik und Wirtschaft) und die "konfuzianische Tradition" (mit ihren verschiedenen Interpretationen und historischen Entwicklungen) werden ausführlich diskutiert.
Wie wird die historische Entwicklung des Kapitalismus im Westen und in China dargestellt?
Die Hausarbeit skizziert die Entwicklung des Kapitalismus im Westen und beleuchtet die historische Entwicklung Chinas seit dem Opiumkrieg von 1842, einschließlich der Öffnung Chinas für westliche Mächte und der damit verbundenen Veränderungen in der Haltung Chinas zum Westen. Die komplexen und sich verändernden Beziehungen zwischen beiden Kulturen werden betont.
Welche Erklärungsansätze für das asiatische Wirtschaftswunder werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Theorien und Ansätze zur Erklärung des asiatischen Wirtschaftswunders und analysiert die Rolle des Konfuzianismus in diesem Kontext. Sie präsentiert und diskutiert gegensätzliche Meinungen über den Einfluss des Konfuzianismus auf die wirtschaftliche Entwicklung, die sowohl positive als auch negative Aspekte beleuchten. Der Fokus liegt auf der aktuellen Relevanz dieser Debatte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Kapitalismus, Konfuzianismus, Wirtschaftswunder, China, Westen, Reform- und Öffnungspolitik, historische Entwicklung, asiatische Werte, kulturelle Gemeinsamkeiten und Wirtschaftsreformen.
- Quote paper
- Steffen Dyck (Author), 2002, Chinesische Vorstellungen von Kapitalismus - Konfuzianismus als Triebfeder des asiatischen Wirtschaftswunders?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9918