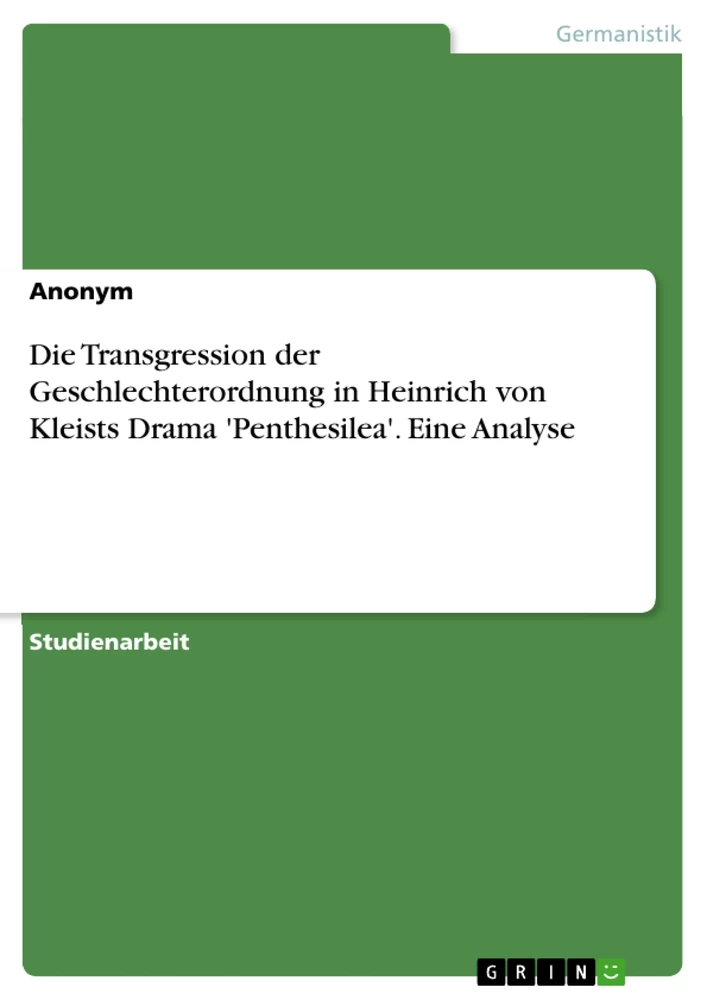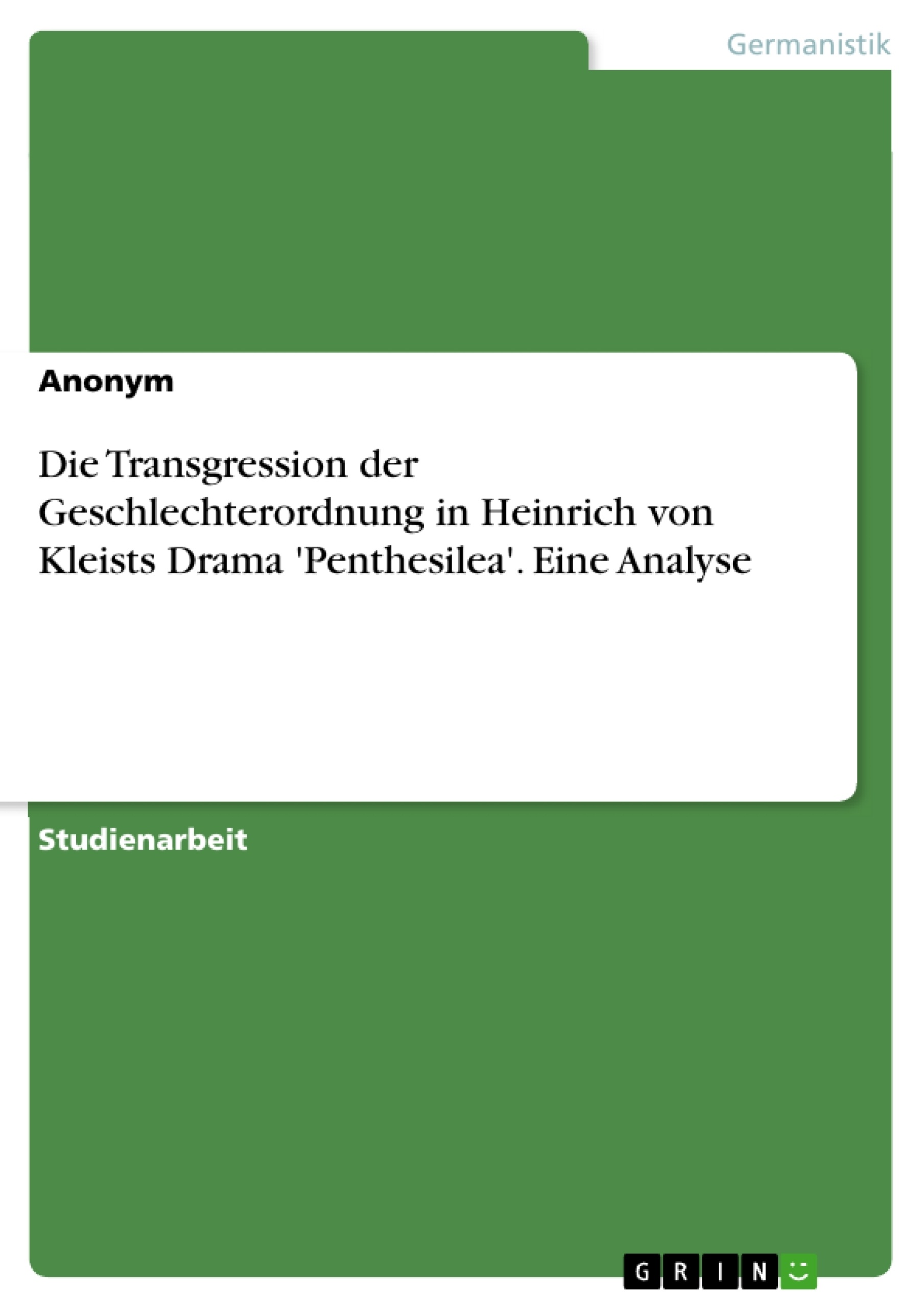Diese Hausarbeit soll darlegen, wie das Scheitern des Amazonenstaates letztlich eine Bestätigung des patriarchalischen Weltbildes darstellt und das Drama zum 'advocatus diaboli‘ seiner selbst werden lässt. Um diese These zu begründen, werde ich zunächst die traditionelle Geschlechterordnung um 1800 skizzieren und dafür sowohl philosophische und rechtliche Schriften, als auch Kleists eigene Haltung in diesem Diskurs anhand seiner Briefe sowie den Einfluss der Französischen Revolution auf die Amazonenthematik einbeziehen.
In einem weiteren Schritt wird untersucht, welche Transgressionen sich auf kollektiver Ebene zeigen, wie also die von den Amazonen gewünschte Gleichrangigkeit mit den Griechen unterlaufen wird und wie die Ambivalenzen des Amazonengesetzes die Überschreitungen hervorrufen. Analog dazu wird in einem dritten Schritt der Blick auf die individuelle Transgression der Protagonistin, Penthesilea, gerichtet. Dabei werden ihre Gefühle gegenüber Achill und die tragische Schlussszene mit dem Tod beider Protagonisten analysiert. Ein Fazit und ein kurzer Ausblick auf weiterführende Fragestellungen beschließen die Arbeit.
Heinrich von Kleist schuf mit Penthesilea ein Drama, das der Kritik aufgrund seiner unzeitgemäßen Exzentrik ein "genialisches Ärgerniß" war. Ursächlich für den "widrigen Eindruck", den viele von diesem Drama hatten, ist, dass Penthesilea durch das "Grundmuster der Transgression" charakterisiert ist. Nicht nur die Grenze zwischen Liebe und Gewalt, sondern auch die zwischen Mensch und Gott, Humanem und Animalischem sowie Leben und Tod wird überschritten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ordnung der Geschlechter um 1800
- Recht und Philosophie
- Kleists Briefe
- Amazonen(staat) im Kontext der Französischen Revolution
- Transgression der Geschlechterordnung auf kollektiver Ebene
- Die Opposition von Amazonen und Griechen
- Die Ambivalenzen des Amazonengesetzes
- Transgression auf individueller Ebene
- Penthesileas Privilegierung Achills
- Die Zerreißung Achills und die Selbsttötung Penthesileas
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Transgression der Geschlechterordnung in Heinrich von Kleists Drama „Penthesilea“ und zeigt auf, wie das Scheitern des Amazonenstaates letztlich eine Bestätigung des patriarchalischen Weltbildes darstellt und das Drama zum „advocatus diaboli“ seiner selbst werden lässt.
- Die traditionelle Geschlechterordnung um 1800
- Transgression der Geschlechterordnung auf kollektiver und individueller Ebene
- Die Ambivalenzen des Amazonengesetzes
- Penthesileas Gefühle für Achill und die tragische Schlussszene
- Das Scheitern des Amazonenstaates als Bestätigung des patriarchalischen Weltbildes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in Kleists „Penthesilea“ und erläutert, wie das Drama durch die Überschreitung von Grenzen, insbesondere der Geschlechterordnung, die ästhetischen Grenzen zeitgenössischer Literaturvorstellungen verletzt.
Im zweiten Kapitel wird die traditionelle Geschlechterordnung um 1800 skizziert, wobei sowohl philosophische und rechtliche Schriften als auch Kleists eigene Haltung in diesem Diskurs anhand seiner Briefe sowie der Einfluss der Französischen Revolution auf die Amazonenthematik beleuchtet werden.
Kapitel 3 untersucht die Transgressionen der Geschlechterordnung auf kollektiver Ebene, indem es die Opposition von Amazonen und Griechen sowie die Ambivalenzen des Amazonengesetzes analysiert.
Kapitel 4 richtet den Blick auf die individuelle Transgression der Protagonistin Penthesilea und analysiert ihre Gefühle gegenüber Achill sowie die tragische Schlussszene mit dem Tod beider Protagonisten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der Geschlechterordnung, der Transgression, dem Amazonenstaat, der Französischen Revolution, den Werken Heinrich von Kleists, dem Drama „Penthesilea“, den Figuren Penthesilea und Achill sowie dem „advocatus diaboli“.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2020, Die Transgression der Geschlechterordnung in Heinrich von Kleists Drama 'Penthesilea'. Eine Analyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/992004