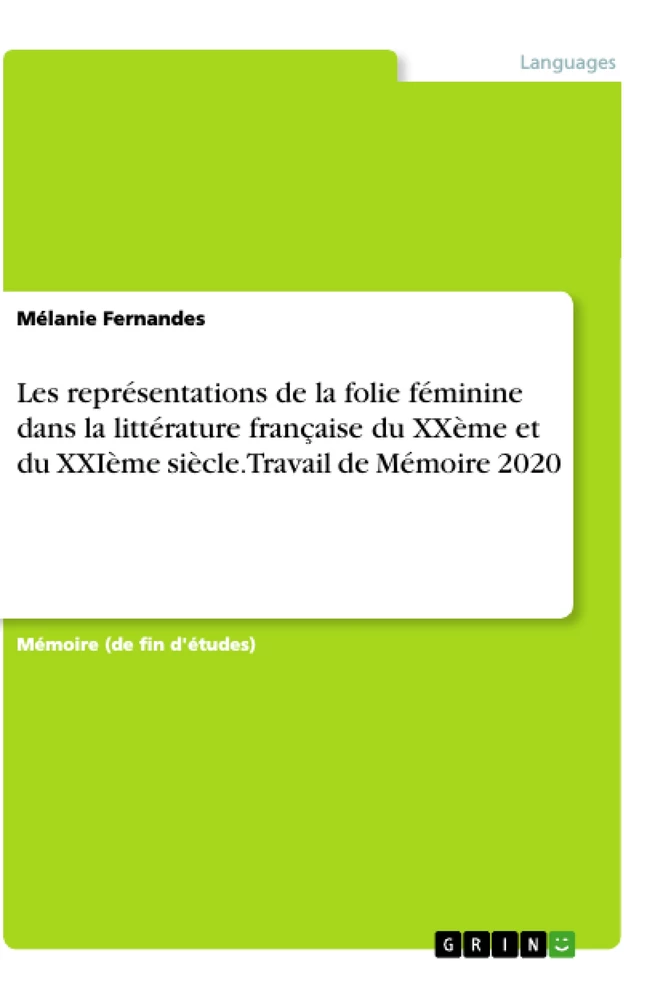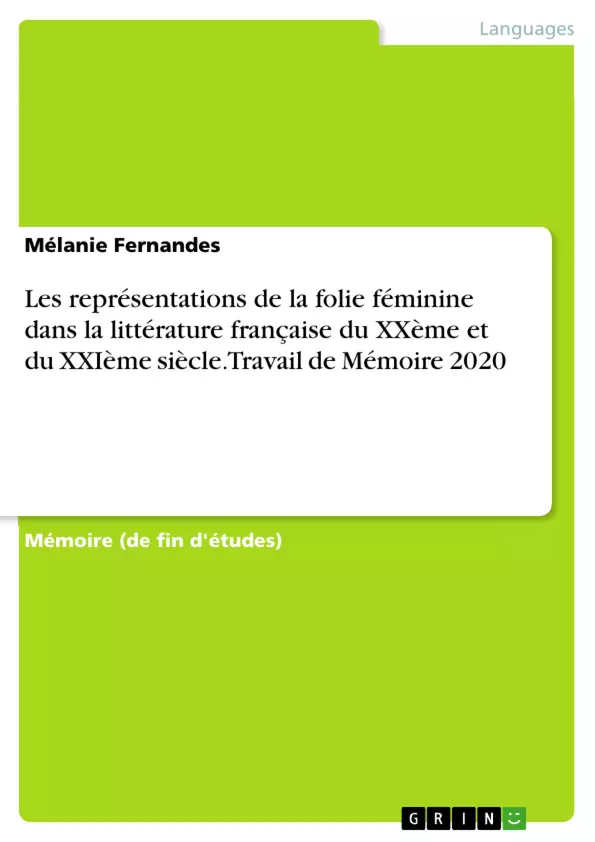Dans quelle mesure la représentation de la folie féminine dans la littérature contemporaine peut-elle remettre en question les préjugés à l’égard de la place de la femme ?
Nous allons nous pencher sur cette question en nous référant à trois œuvres contemporaines : "Le bal des folles" de Victoria Mas, "Le Ravissement de Lol V. Stein" de Marguerite Duras et "Suzy Storck" de Magali Mougel selon une chronologie qui suit le temps de l’histoire narrée. Celles-ci nous exposeront à trois formes de folies différentes, notamment l’hystérie, la dépersonnalisation et la dépression post-partum. L’objectif ciblé de cette analyse est de pouvoir trouver un fil conducteur commun entre ces œuvres, qui servira à justifier une représentation de la folie perçue comme un régulateur social.
Pour appréhender cette problématique, nous devrons établir des rapprochements entre littérature, sociologie et langage. Ainsi nous nous baserons surtout sur des conférences données par Michel Foucault, et des théories sociologiques d’Erving Goffman en rapport avec la stigmatisation, la folie et l’interaction sociale.
Même si les auteures de ces œuvres n’indiquent pas forcément adopter une vision féministe dans leurs travaux, il nous faudra admettre la présence de certaines idées qui semblent appeler à une volonté globale d’émancipation de la femme. De ce fait, je me référerai entre autres à une thèse écrite par Morag Fallows qui a pour sujet : "Women and Madness : an exploration of why women are commonly labelled as mad". L’étudiante graduée en Sociology and Social Policy y développe de façon ciblée la problématique de la surreprésentation de la femme dans le domaine de la folie.
Enfin, pour revenir à l’aspect littéraire de l’analyse, le choix d’un corpus primaire basé sur le genre de la fiction est volontaire afin de mettre en avant sa capacité de persuasion et d’évasion. Nous verrons, à travers les « mondes possibles » évoqués par Nelson Goodman et les caractéristiques de la fiction établies par Jean Marie-Schaeffer, que la fiction peut être un labyrinthe où l’on se perd ou dans lequel on se découvre. Il s’agira donc de considérer la fiction outre son aspect de divertissement comme un outil de compréhension capable d’ouvrir les portes de mondes inconnus au lecteur et de faire naître en lui un intérêt pour des débats qui restent encore actuels.
Inhaltsverzeichnis
- La Folie au Féminin
- Le Bal des Folles : Un Système Arbitraire dans l'Œuvre de Victoria Mas
- Le Bal des Illusions
- L'Asile, entre Refuge et Emprisonnement
- Le Patriarcat au XIXe Siècle
- La Littérature en tant que Remède
- À la Recherche du Bonheur dans Le Ravissement de Lol V. Stein de Marguerite Duras
- Femme Fascinante ou Objet d'Étude
- Derrière l'Apparence d'une Femme Ordinaire
- Le Bonheur Réside dans la Déraison
- La Folie d'Écrire
- Suzy Storck, une Maternité par Obligation dans l'Œuvre de Magali Mouguel
- L'Engrenage du Quotidien
- Mère à Tout Prix
- « Médée Contemporaine »
- L'Exposition de la Vie Privée
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von weiblicher „Folie“ in der europäischen Literatur und Kultur. Sie analysiert, wie gesellschaftliche Normen und patriarchale Strukturen die Wahrnehmung und Zuschreibung von psychischer Erkrankung bei Frauen beeinflusst haben. Die Arbeit befasst sich mit konkreten literarischen Beispielen, um diese komplexen Zusammenhänge zu beleuchten.
- Die gesellschaftliche Konstruktion von „Folie“
- Die geschlechtsspezifische Zuschreibung von psychischer Erkrankung
- Der Einfluss patriarchaler Strukturen auf die Darstellung weiblicher Figuren in der Literatur
- Die Rolle der Literatur als Spiegel und kritischer Kommentar gesellschaftlicher Verhältnisse
- Die historische Entwicklung des Verständnisses von „Folie“ und ihren Auswirkungen auf Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
La Folie au Féminin: Der einführende Abschnitt legt die Grundlage der Arbeit, indem er die gesellschaftliche Konstruktion von „Folie“ nach Foucault diskutiert und die Frage nach der überproportionalen Zuschreibung von „Folie“ an Frauen in der westlichen Gesellschaft aufwirft. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung dieser Zuschreibung, mit Beispielen wie der Hexenjagd und dem Konzept der Hysterie, um den Kontext für die folgenden Kapitel zu schaffen. Der Abschnitt betont die soziale und kulturelle Bedingtheit des Begriffs „Folie“ und dessen Bedeutung für die Interpretation der folgenden literarischen Analysen.
Le Bal des Folles : Un Système Arbitraire dans l'Œuvre de Victoria Mas: Dieses Kapitel analysiert Victoria Mas' Roman „Le Bal des Folles“ und untersucht, wie das Werk die willkürlichen Mechanismen der psychiatrischen Institutionen des 19. Jahrhunderts darstellt, die Frauen oft ungerechtfertigt als „verrückt“ einstuften. Der Text beleuchtet die sozialen und politischen Faktoren, die zur Unterdrückung und Stigmatisierung von Frauen beitrugen. Die Analyse konzentriert sich auf die Erfahrungen der Patientinnen in der Anstalt, den Umgang mit ihrer Krankheit, und wie die Literatur die Mechanismen des Patriarchats aufdeckt. Die Rolle der Literatur als Gegenmittel wird dabei ebenfalls betrachtet.
À la Recherche du Bonheur dans Le Ravissement de Lol V. Stein de Marguerite Duras: Die Analyse von Marguerite Duras' „Le Ravissement de Lol V. Stein“ fokussiert sich darauf, wie die weibliche Figur Lol V. Stein dargestellt wird und welche gesellschaftlichen Erwartungen an sie gestellt werden. Das Kapitel untersucht die Ambivalenz der Darstellung der weiblichen Protagonistin zwischen Faszination und Objekt der Studie, zwischen scheinbarer Normalität und innerer Zerrissenheit. Der Text analysiert den Zusammenhang zwischen ihrer „Folie“ und ihrem Streben nach Glück, sowie die expressionistische Schreibweise der Autorin als Ausdruck des psychischen Zustands der Hauptfigur.
Suzy Storck, une Maternité par Obligation dans l'Œuvre de Magali Mouguel: In diesem Kapitel wird Magali Mougels Werk über Suzy Storck untersucht, um die Aspekte von Zwangsmütterlichkeit und den Druck auf Frauen darzustellen. Die Analyse befasst sich mit dem alltäglichen Leben von Suzy Storck und wie die gesellschaftlichen Erwartungen an sie als Mutter ihr Handeln prägen und sie in eine Situation zwingen, die zu ihrer psychischen Belastung beiträgt. Die Darstellung einer „modernen Medea“ unterstreicht die Themen des gesellschaftlichen Drucks und die Folgen der Unterdrückung von Frauen.
Schlüsselwörter
Folie, Frauen, Literatur, Patriarchat, Gesellschaft, Stigmatisierung, psychische Erkrankung, Hysterie, Hexenjagd, soziale Konstruktion, literarische Darstellung, 19. Jahrhundert, Mütterlichkeit, Unterdrückung.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse weiblicher "Folie" in der europäischen Literatur
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung weiblicher „Folie“ in der europäischen Literatur und Kultur. Sie untersucht, wie gesellschaftliche Normen und patriarchale Strukturen die Wahrnehmung und Zuschreibung von psychischen Erkrankungen bei Frauen beeinflusst haben. Die Analyse stützt sich auf konkrete literarische Beispiele.
Welche literarischen Werke werden untersucht?
Die Arbeit untersucht drei literarische Werke: „Le Bal des Folles“ von Victoria Mas, „Le Ravissement de Lol V. Stein“ von Marguerite Duras und ein Werk von Magali Mouguel über Suzy Storck. Die Analysen konzentrieren sich auf die Darstellung weiblicher Figuren und deren Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Erwartungen und psychischen Belastungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Themen: die gesellschaftliche Konstruktion von „Folie“, die geschlechtsspezifische Zuschreibung psychischer Erkrankungen, der Einfluss patriarchaler Strukturen auf die Darstellung weiblicher Figuren, die Rolle der Literatur als Spiegel und kritischer Kommentar gesellschaftlicher Verhältnisse und die historische Entwicklung des Verständnisses von „Folie“ und ihren Auswirkungen auf Frauen.
Wie wird die „Folie“ in den ausgewählten Werken dargestellt?
Die Analyse untersucht, wie die „Folie“ in den Werken jeweils dargestellt wird, z.B. als Folge gesellschaftlicher Unterdrückung, als Ausdruck innerer Zerrissenheit oder als Reaktion auf patriarchale Strukturen. Es wird untersucht, wie die jeweiligen Autorinnen die psychischen Zustände ihrer weiblichen Figuren literarisch ausdrücken.
Welche Rolle spielt das Patriarchat in der Arbeit?
Das Patriarchat spielt eine zentrale Rolle, indem es die gesellschaftlichen Normen und Strukturen beleuchtet, die zur Stigmatisierung und Unterdrückung von Frauen beitragen und die Wahrnehmung von „Folie“ beeinflussen. Die Arbeit untersucht, wie diese Strukturen in den literarischen Werken zum Ausdruck kommen und sich auf das Leben der weiblichen Figuren auswirken.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: ein einführendes Kapitel („La Folie au Féminin“), welches die gesellschaftliche Konstruktion von „Folie“ beleuchtet, gefolgt von Kapiteln, die jeweils ein ausgewähltes literarisches Werk detailliert analysieren. Jedes Kapitel untersucht die spezifischen Aspekte der Darstellung von weiblicher „Folie“ im jeweiligen Kontext.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, wie die Darstellung von weiblicher „Folie“ in der Literatur eng mit gesellschaftlichen Normen und patriarchalen Strukturen verknüpft ist. Sie verdeutlicht, wie die Zuschreibung von „Folie“ als Mittel der Unterdrückung und Stigmatisierung von Frauen verwendet wurde und wird. Die Literatur dient dabei als Spiegel und kritischer Kommentar dieser gesellschaftlichen Verhältnisse.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Folie, Frauen, Literatur, Patriarchat, Gesellschaft, Stigmatisierung, psychische Erkrankung, Hysterie, Hexenjagd, soziale Konstruktion, literarische Darstellung, 19. Jahrhundert, Mütterlichkeit, Unterdrückung.
- Quote paper
- Mélanie Fernandes (Author), 2020, Les représentations de la folie féminine dans la littérature française du XXème et du XXIème siècle. Travail de Mémoire 2020, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/992284