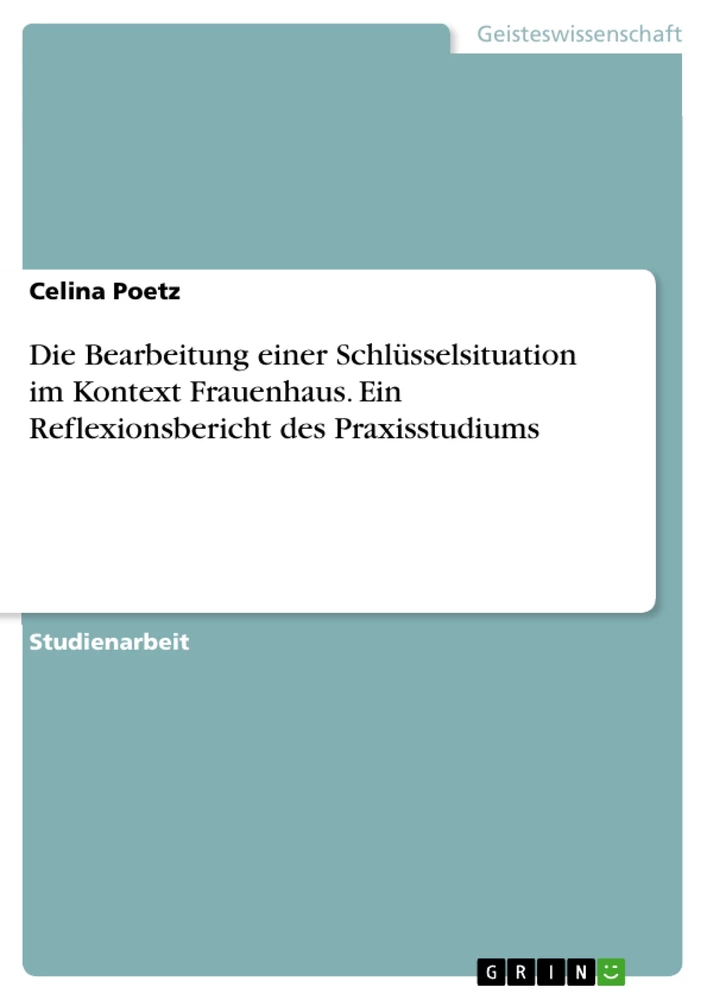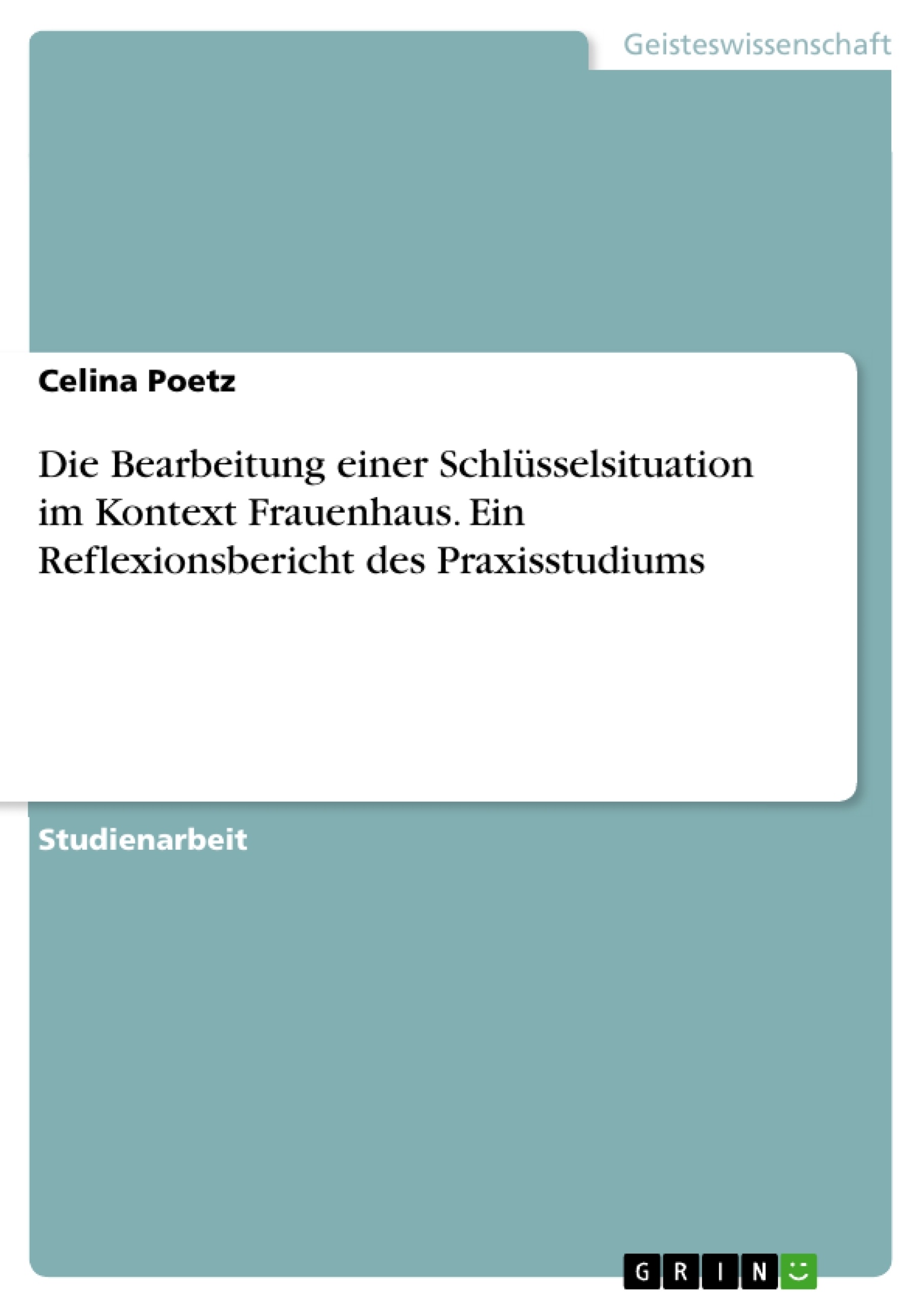Im ersten Teil der Hausarbeit wird eine Schlüsselsituation, also eine immer wiederkehrende Situation im Kontext Frauenhaus, bearbeitet. Der zweite Teil besteht aus einem Reflexionsbericht.
Das Modell der Schlüsselsituation soll zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit beitragen. Dies wird gefördert durch die reflexive Arbeit mit Schlüsselsituationen. Für Studierende trägt das Modell der Schlüsselsituation dazu bei, zu professionell Handelnden zu werden und für Fachkräfte kann es dazu beitragen, dass ihre professionellen Kompetenzen weiterentwickelt werden. Allgemein werden Schlüsselsituationen definiert als Situationen, die die Fachkräfte der Sozialen Arbeit als zentrale, wiederkehrende Situationen betrachten und die trotz ihrer Individualität gemeinsame, allgemeine Merkmale aufweisen. Im ersten Teil dieser Hausarbeit wird eine Schlüsselsituation, also eine immer wiederkehrende Situation im Kontext Frauenhaus, bearbeitet. Der zweite Teil besteht aus einem Reflexionsbericht. Das Reflexionsmodell der Schlüsselsituation besteht aus acht Prozessschritten, auf die im Folgenden eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in das Modell der Schlüsselsituation
- Titel der Situation
- Situationsmerkmale
- Situationsbeschreibung mit Kontext und Ausgangslage
- Situationsbeschreibung mit Reflection in Action in Handlungssequenzen
- Erste Sequenz: Begrüßung
- Zweite Sequenz: Gesprächseinleitung
- Auswertung der Reflection in Action
- Erklärungswissen
- Gewaltkreislauf nach Walker
- Macht als ein soziales Problem nach Staub-Bernasconi
- Interventionswissen – Gesprächsführung und das Krisengespräch nach Widulle
- Erfahrungswissen
- Organisations- und Kontextwissen
- Fähigkeiten
- Organisatorische, infrastrukturelle, zeitliche und materielle Voraussetzungen
- Wertewissen
- Qualitätsstandards
- Reflexion anhand der Qualitätsstandards
- Handlungsalternativen
- Reflexion des Praxissemesters
- Persönliche Motivation für das Praxisstudium im Frauenhaus
- Reflexion des eigenen Lernprozesses im Praxisstudium
- Fazit zum Praxissemester
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit bearbeitet eine Schlüsselsituation im Kontext Frauenhaus und reflektiert den Praxisstudiengang. Ziel ist es, die Anwendung des Schlüsselsituation-Modells zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit zu demonstrieren und den eigenen Lernprozess kritisch zu analysieren.
- Anwendung des Schlüsselsituation-Modells in der Praxis
- Reflexion der eigenen Handlungskompetenz im Umgang mit gewaltbetroffenen Frauen
- Analyse des Kontextes Frauenhaus und dessen spezifischer Herausforderungen
- Gewaltkreisläufe und Machtstrukturen als soziale Probleme
- Krisenintervention und Gesprächsführung
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung in das Modell der Schlüsselsituation: Die Arbeit nutzt das Modell der Schlüsselsituation zur Professionalisierung in der Sozialen Arbeit. Es dient Studierenden zur Entwicklung professionellen Handelns und Fachkräften zur Kompetenzweiterentwicklung. Schlüsselsituationen werden als zentrale, wiederkehrende Situationen definiert, die trotz Individualität gemeinsame Merkmale aufweisen. Die Arbeit analysiert eine solche Situation im Frauenhauskontext und liefert einen Reflexionsbericht.
Titel der Situation: Der Titel der bearbeiteten Schlüsselsituation lautet: „Erstkontakte gestalten im Kontext Frauenhaus - Das Abholen einer Familie an einem neutralen Treffpunkt zum Einzug ins Frauenhaus.“ Dieser Titel verdeutlicht den Fokus auf den ersten Kontakt mit gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern und die damit verbundenen Herausforderungen.
Situationsmerkmale: Die Schlüsselsituation ist durch Unsicherheit bei den Klient*innen, einen Erstkontakt mit emotionaler Befindlichkeitsunklarheit, den Bedarf an Hilfestellung und den Wendepunkt des Einzugs in eine Gemeinschaftsunterkunft gekennzeichnet. Eine vorausgegangene Bedrohungssituation mit Polizeibeteiligung prägt den Kontext. Diese Merkmale unterstreichen die Komplexität der Situation und die Notwendigkeit professionellen Handelns.
Situationsbeschreibung mit Kontext und Ausgangslage: Die Situation findet an einem neutralen Treffpunkt statt, um die Anonymität zu gewährleisten. Das Frauenhaus bietet Schutz und Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder. Die Polizei vermittelt den Kontakt, nachdem eine Frau und ihr Sohn Schutz benötigen. Die Beschreibung verdeutlicht die Notwendigkeit von Kooperation zwischen Polizei und Frauenhaus und die Dringlichkeit der Situation.
Situationsbeschreibung mit Reflection in Action in Handlungssequenzen: Dieser Abschnitt beschreibt den Erstkontakt mit der Frau (K.) und ihrem Sohn (A.). Die Reflexion in Action analysiert die Emotionen und kognitiven Zustände aller Beteiligten, die sich durch Unsicherheit, Angst und Traurigkeit auszeichnen. Die professionelle Sozialarbeiterin versucht durch ein freundliches und einfühlsames Vorgehen, Vertrauen aufzubauen und die Angst zu verringern. Die Beschreibung der einzelnen Sequenzen zeigt die Notwendigkeit für professionelles und sensibles Handeln in dieser Situation.
Schlüsselwörter
Schlüsselsituation, Frauenhaus, Soziale Arbeit, Gewalt gegen Frauen, Krisenintervention, Gesprächsführung, Reflexion, Professionalisierung, Erstkontakt, Machtstrukturen, Gewaltkreislauf.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: "Erstkontakte gestalten im Kontext Frauenhaus"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert eine Schlüsselsituation im Kontext eines Frauenhauses, konkret den Erstkontakt mit einer gewaltbetroffenen Frau und ihrem Kind bei der Aufnahme ins Frauenhaus. Sie dient der Demonstration der Anwendung des Schlüsselsituation-Modells zur Professionalisierung in der Sozialen Arbeit und der kritischen Reflexion des eigenen Lernprozesses im Praxisstudium.
Welches Modell wird angewendet?
Die Arbeit verwendet das Modell der Schlüsselsituation zur Analyse und Reflexion des professionellen Handelns. Dieses Modell dient der systematischen Betrachtung und Professionalisierung sozialpädagogischer Praxis.
Welche Schlüsselsituation wird untersucht?
Die untersuchte Schlüsselsituation trägt den Titel: „Erstkontakte gestalten im Kontext Frauenhaus - Das Abholen einer Familie an einem neutralen Treffpunkt zum Einzug ins Frauenhaus.“ Der Fokus liegt auf dem Erstkontakt mit gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern und den damit verbundenen Herausforderungen.
Welche Aspekte werden in der Situationsbeschreibung behandelt?
Die Situationsbeschreibung umfasst den Kontext (Frauenhaus, Polizeiliche Vermittlung, neutraler Treffpunkt), die Ausgangslage (Unsicherheit, Angst, emotionale Befindlichkeitsunklarheit), die Handlungssequenzen (Begrüßung, Gesprächseinleitung) und die Reflexion des eigenen Handelns (Reflection in Action).
Welche theoretischen Konzepte werden herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf relevante theoretische Konzepte wie den Gewaltkreislauf nach Walker, Macht als soziales Problem nach Staub-Bernasconi, Gesprächsführung und Krisengespräch nach Widulle.
Welche Aspekte der Reflexion werden behandelt?
Die Reflexion umfasst die Analyse des eigenen Erklärungswissens, Interventionswissens, Erfahrungswissens, Organisations- und Kontextwissens, Fähigkeiten, organisatorischer Voraussetzungen, Wertewissens, Qualitätsstandards und Handlungsalternativen. Die Reflexion bezieht sich auch auf den gesamten Praxissemesterverlauf, die persönliche Motivation und den Lernprozess.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schlüsselsituation, Frauenhaus, Soziale Arbeit, Gewalt gegen Frauen, Krisenintervention, Gesprächsführung, Reflexion, Professionalisierung, Erstkontakt, Machtstrukturen, Gewaltkreislauf.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: Einführung in das Modell der Schlüsselsituation, Titel der Situation, Situationsmerkmale, Situationsbeschreibung mit Kontext und Ausgangslage, Situationsbeschreibung mit Reflection in Action, Auswertung der Reflection in Action, Erfahrungswissen, Organisations- und Kontextwissen, Fähigkeiten, Organisatorische Voraussetzungen, Wertewissen, Qualitätsstandards, Reflexion anhand der Qualitätsstandards, Handlungsalternativen, Reflexion des Praxissemesters und Literaturverzeichnis.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die Demonstration der Anwendung des Schlüsselsituation-Modells zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit und die kritische Analyse des eigenen Lernprozesses im Umgang mit gewaltbetroffenen Frauen im Kontext Frauenhaus.
- Quote paper
- Celina Poetz (Author), 2018, Die Bearbeitung einer Schlüsselsituation im Kontext Frauenhaus. Ein Reflexionsbericht des Praxisstudiums, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/992376