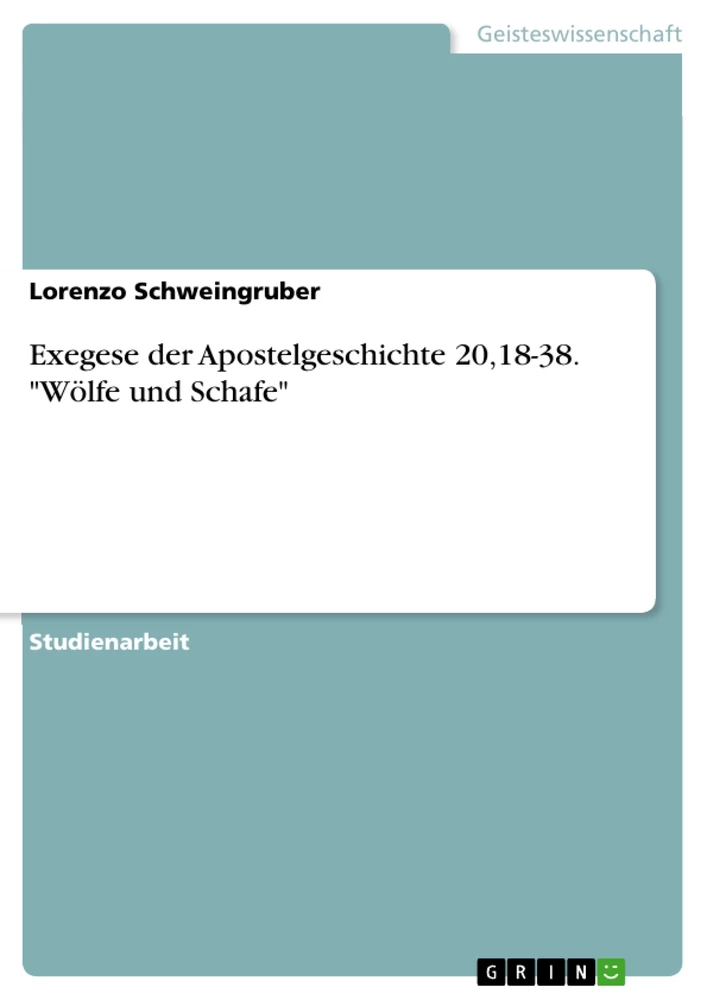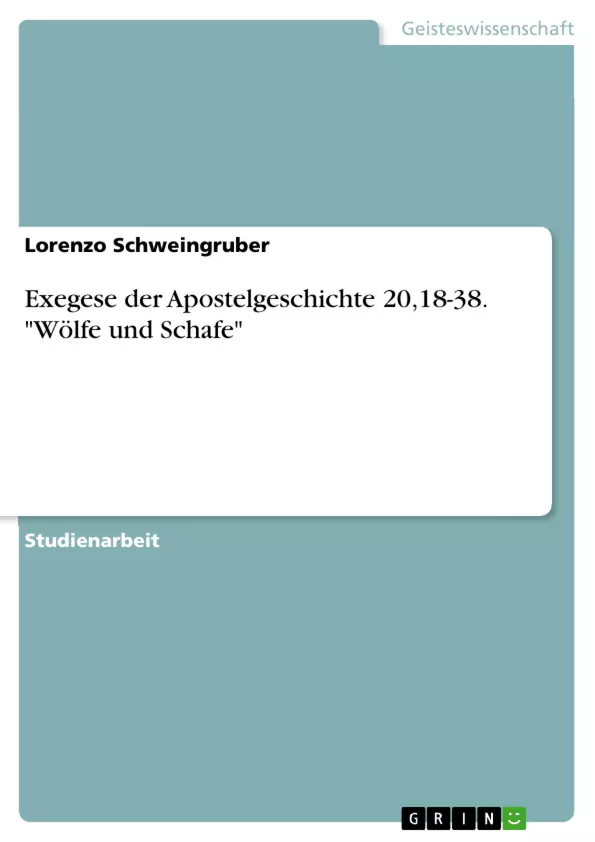In dieser Arbeit wird das Thema "Bereich Umwelt Neues Testament" analysiert und ausgearbeitet. Des Weiteren wird eine angewandte Exegese, die auf eine bestimmte Forschungsfrage fokussiert ist, zum Bibeltext "Apostelgeschichte 20,18-38", erstellt.
Die Exegese bearbeitet Apostelgeschichte 20,18-38, jedoch wird der Hauptfokus der Arbeit auf Apostelgeschichte 20,28-31 gelegt, um die Forschungsfrage gewinnbringender zu untersuchen. Für die Exegese wir die ganze Texteinheit, Apostelgeschichte 20,18-38, berücksichtig und beigezogen.
In Apostelgeschichte 20,18-38 treffen wir Paulus an, der eine Abschiedsrede in einer Gemeinde hält, in welcher er zu Besuch war. In dieser Abschiedsrede geht Paulus auf verschiedene Thematiken ein, die mit der Gemeinde zusammenhängen. In dieser Rede in Apostelgeschichte 20,28-30 warnt Paulus auch vor Gefahren, die auf die Gemeinde und deren Leiter zukommen würden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Aufbau der jüdischen Gesellschaft
- Gruppierungen
- Die Hierarchie im Tempel
- Apostelgeschichte
- Startpunkt
- Textthema
- Übersetzungsvergleich
- Kommunikationssituation
- Kontext
- Textart
- Auslegung
- Anwendung
- Reflexion
- Lektüre
- Abkürzungsverzeichnis
- Biblische Bücher
- Allgemeine Abkürzungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit befasst sich mit dem Thema „Bereich Umwelt NT“ in Zusammenarbeit mit S. M. und analysiert den Aufbau der jüdischen Gesellschaft. Darüber hinaus enthält sie eine angewandte Exegese, die auf eine bestimmte Forschungsfrage fokussiert, zum Thema „Apostelgeschichte“.
- Der Aufbau der jüdischen Gesellschaft
- Die verschiedenen Gruppierungen innerhalb der jüdischen Gemeinschaft
- Die Bedeutung der Apostelgeschichte als Text
- Die Anwendung der Exegese auf die Apostelgeschichte
- Die Reflexion auf die Erkenntnisse der Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der Facharbeit ein und beschreibt die Zusammenarbeit mit S. M. sowie die gewählte Forschungsfrage. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Aufbau der jüdischen Gesellschaft und analysiert die verschiedenen Gruppierungen, die innerhalb dieser Gemeinschaft existierten. Das dritte Kapitel widmet sich der Apostelgeschichte und behandelt Themen wie den Startpunkt, das Textthema, den Übersetzungsvergleich, die Kommunikationssituation, den Kontext, die Textart, die Auslegung und die Anwendung.
Schlüsselwörter
Jüdische Gesellschaft, Gruppierungen, Apostelgeschichte, Exegese, Textanalyse, Anwendung, Reflexion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Inhalt von Apostelgeschichte 20,18-38?
Dieser Bibeltext beschreibt die Abschiedsrede des Apostels Paulus vor den Ältesten der Gemeinde in Ephesus, in der er auf seine Arbeit zurückblickt und vor Gefahren warnt.
Worauf liegt der Fokus der Exegese in dieser Arbeit?
Der Hauptfokus liegt auf den Versen 28-31, in denen Paulus die Gemeindeleiter auffordert, wachsam gegenüber „reißenden Wölfen“ zu sein, die die Herde bedrohen.
Wie war die jüdische Gesellschaft zur Zeit des Neuen Testaments aufgebaut?
Die Arbeit analysiert die verschiedenen Gruppierungen innerhalb der Gemeinschaft sowie die Hierarchie im Tempel, um den kulturellen Hintergrund der Apostelgeschichte zu verdeutlichen.
Was bedeutet „Exegese“ in dieser Facharbeit?
Exegese bezeichnet die wissenschaftliche Auslegung und Analyse des Bibeltextes unter Berücksichtigung von Kontext, Textart, Übersetzung und historischer Umwelt.
Welche Rolle spielt die Metapher „Wölfe und Schafe“?
Sie dient als Bild für die Bedrohung der christlichen Gemeinde durch Irrlehren oder äußere Einflüsse, vor denen die Leiter (die Hirten) die Gemeinde schützen müssen.
Wurde für die Analyse ein Übersetzungsvergleich herangezogen?
Ja, die Arbeit beinhaltet einen Übersetzungsvergleich, um Nuancen des Textes besser zu verstehen und für die Auslegung fruchtbar zu machen.
- Arbeit zitieren
- Lorenzo Schweingruber (Autor:in), 2020, Exegese der Apostelgeschichte 20,18-38. "Wölfe und Schafe", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/992382