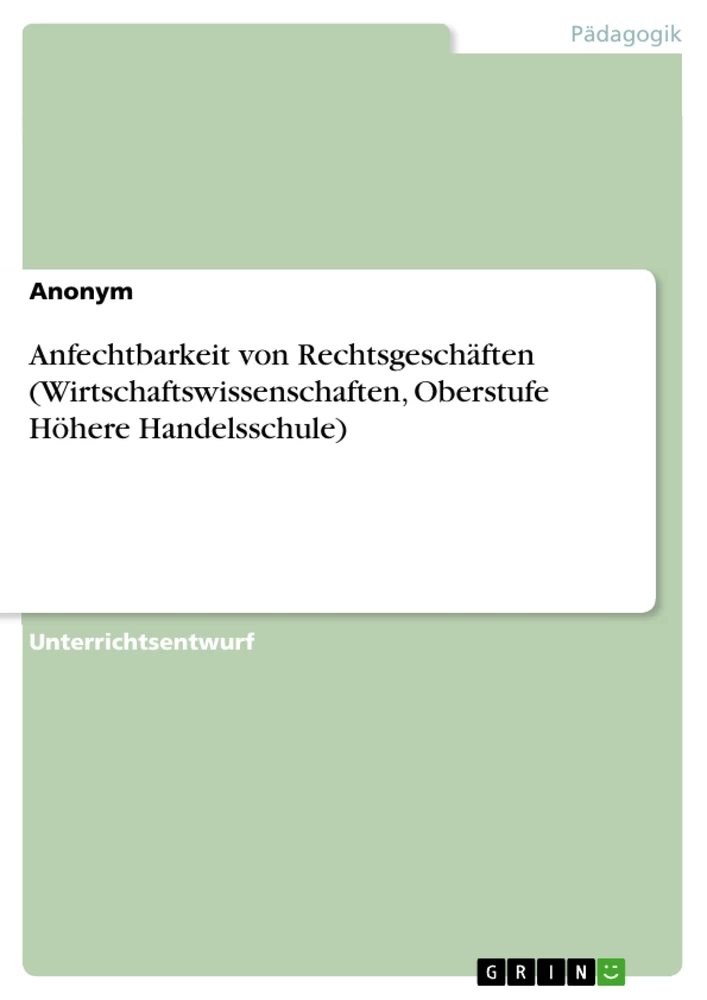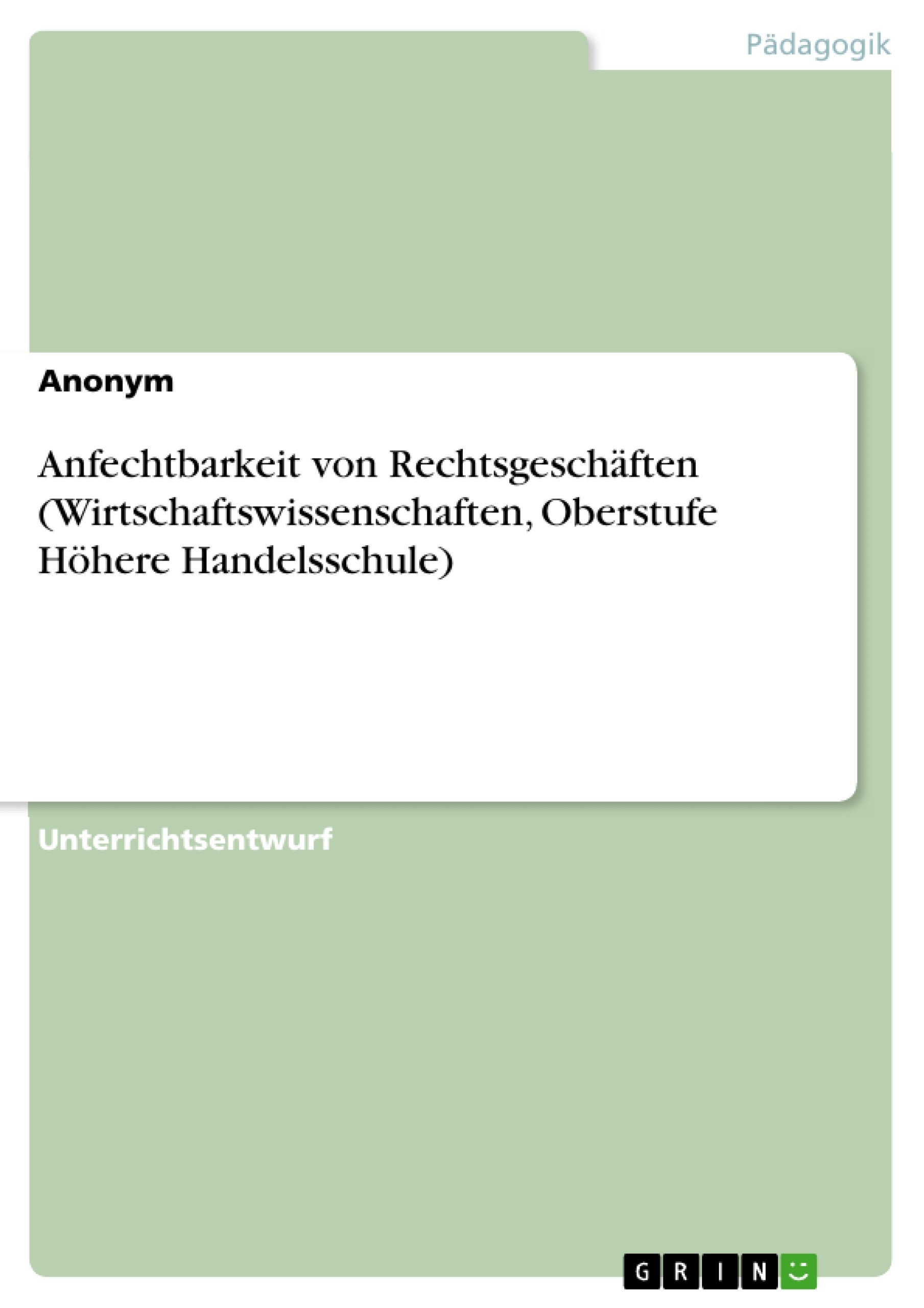Es handelt sich um einen Unterrichtsentwurf zur Unterrichtspraktischen Prüfung in der Oberstufe der Höheren Handelsschule. Ziel der Stunde ist es, dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, mithilfe des Stationenlernens und von Gesetzestexten die Bedeutung der Anfechtbarkeit bei Rechtsgeschäften zu erkennen und zu erläutern. Außerdem können sie Gründe für anfechtbare Rechtsgeschäfte nennen und fallorientiert anwenden.
Das Ziel für die Bildungsgänge der Anlage C APO-BK ist der Erwerb umfassender Handlungskompetenzen, insbesondere solcher, welche selbstständiges sowie fachliches Planen und Arbeiten im beruflichen Kontext beziehungsweise in entsprechenden Studiengängen ermöglichen. Hierbei erwerben die Schülerinnen und Schüler der zweijährigen Bildungsgänge der Berufsfachschule berufliche Kenntnisse und streben den schulischen Teil der Fachhochschulreife (FHR) an. Vor diesem Hintergrund liegt der Schwerpunkt der vorliegenden Anforderungssituation "Rechtlich verbindliche Kaufverträge abschießen" in der Vermittlung von fachtheoretischem Wissen und Fertigkeiten, wozu auch die selbstständige Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen zählen (fachspezifische Ziele).
Inhaltsverzeichnis
- Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
- Leitgedanken und Intentionen zur Anforderungssituation
- Berücksichtigung schulischer Vereinbarungen/curriculare Legitimierung
- Tabellarische Darstellung des längerfristigen unterrichtlichen Zusammenhangs
- Prozess- und Kompetenzorientierung der Anforderungssituation
- Fachkompetenz
- Methodenkompetenz
- Sozialkompetenz
- Nachhaltigkeit des Lern- und Entwicklungsprozesses
- Überprüfung des Lern- und Kompetenzzuwachses
- Schriftliche Planung der Unterrichtsstunde
- Diagnose der Lernausgangslage
- Begründung der didaktisch-methodischen Entscheidungen der Unterrichtsstunde
- Stundenziel
- Synoptische Darstellung der geplanten Unterrichtsstunde
- Quellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Schriftliche Arbeit im Fach Wirtschaftswissenschaft befasst sich mit dem Unterrichtsvorhaben „Rechtlich verbindliche Kaufverträge abschließen“. Das Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern der Oberstufe der zweijährigen Berufsfachschule (Anlage C der APO-BK) ein tieferes Verständnis von Rechtsgeschäften, insbesondere Kaufverträgen, zu vermitteln. Der Fokus liegt dabei auf der Erarbeitung von Kriterien für die Anfechtbarkeit von Rechtsgeschäften, um den Lernenden ein Bewusstsein für ihre Rechte und Pflichten im Kontext von Kaufverträgen zu schaffen.
- Die Bedeutung von Willenserklärungen im Kaufvertrag
- Die Unterscheidung von Angebot, Annahme und Vertrag
- Die rechtlichen Grundlagen der Anfechtbarkeit von Kaufverträgen
- Die Bedeutung von Formvorschriften im Kaufvertrag
- Die Rolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) im Kaufvertrag
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer detaillierten Darstellung des längerfristigen unterrichtlichen Zusammenhangs, in dem das Unterrichtsvorhaben „Rechtlich verbindliche Kaufverträge abschließen“ eingebettet ist. Hier werden Leitgedanken und Intentionen zur Anforderungssituation vorgestellt, sowie die Berücksichtigung schulischer Vereinbarungen und die curriculare Legitimierung des Vorhabens erläutert. Im zweiten Kapitel wird die schriftliche Planung der Unterrichtsstunde vorgestellt. Hier werden die Diagnose der Lernausgangslage, die didaktisch-methodischen Entscheidungen, das Stundenziel sowie eine synoptische Darstellung der geplanten Unterrichtsstunde erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie Anfechtung von Rechtsgeschäften, Kaufvertrag, Willenserklärung, Angebot, Annahme, Formvorschriften, AGB, Rechte und Pflichten, Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Fachhochschulreife, Berufsfachschule, und Bildungsgänge.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Anfechtbarkeit von Rechtsgeschäften?
Anfechtbarkeit bedeutet, dass ein eigentlich wirksames Rechtsgeschäft (z. B. ein Kaufvertrag) aufgrund bestimmter Mängel (wie Irrtum oder Täuschung) rückwirkend nichtig gemacht werden kann.
Was sind typische Gründe für eine Anfechtung?
Zu den gesetzlichen Gründen gehören Inhaltsirrtum, Erklärungsirrtum, Eigenschaftsirrtum sowie arglistige Täuschung oder widerrechtliche Drohung.
Wie kommt ein rechtlich verbindlicher Kaufvertrag zustande?
Ein Kaufvertrag entsteht durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen: das Angebot und die Annahme.
Welche Rolle spielen AGB bei Kaufverträgen?
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind vorformulierte Vertragsbedingungen, die die Rechte und Pflichten der Vertragspartner standardisieren und ergänzen.
Warum sind Formvorschriften im Recht wichtig?
Formvorschriften (z. B. Schriftform oder notarielle Beurkundung) dienen dem Beweis, dem Schutz vor Übereilung und der Klarheit bei wichtigen Rechtsgeschäften.
Was lernen Schüler im Bereich Wirtschaftswissenschaften über Verträge?
Schüler lernen fachliches Planen, die Anwendung von Gesetzestexten auf Fälle und entwickeln ein Bewusstsein für ihre Rechte und Pflichten als Marktteilnehmer.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Anfechtbarkeit von Rechtsgeschäften (Wirtschaftswissenschaften, Oberstufe Höhere Handelsschule), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/992460