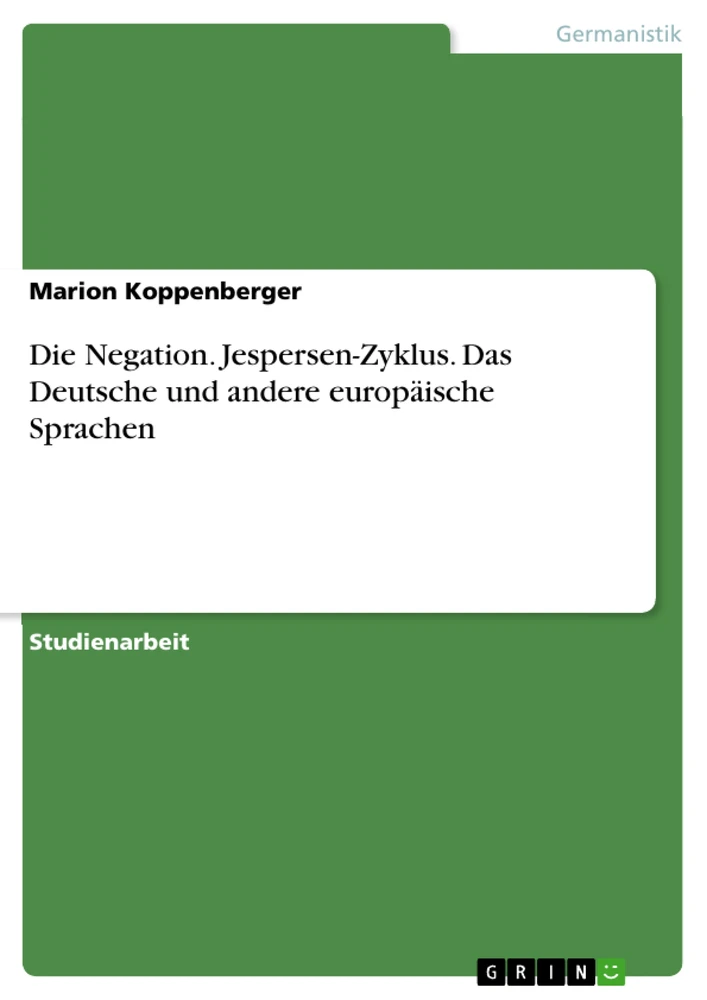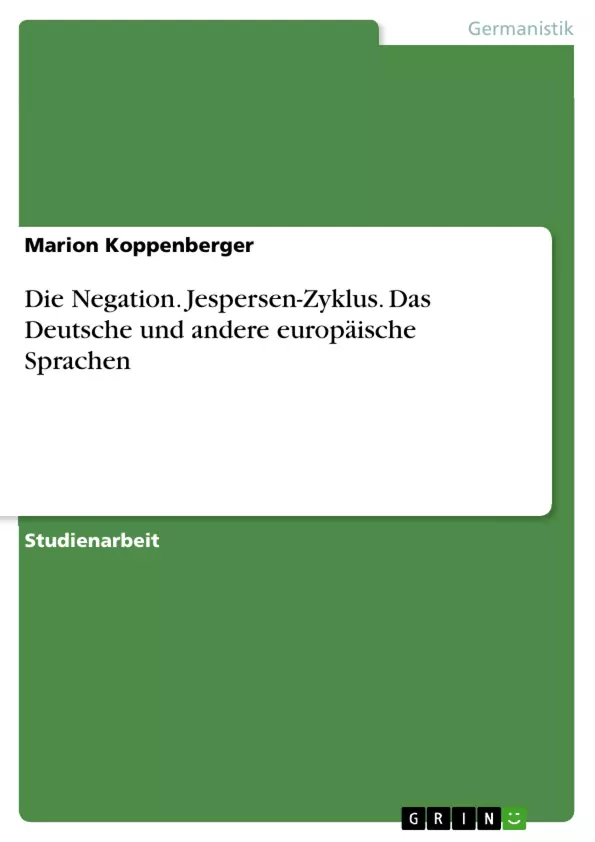Die hier vorliegende Arbeit beschäftigt sich im Folgenden mit der diachronen Entwicklung der Negation in verschiedenen europäischen Sprachen, wie dem Deutschen, dem Englischen und dem Französischen. In diesem Kontext wird lediglich die Satznegation untersucht, da die Berücksichtigung der Verneinung mit Indefinita oder der Sondernegation zu weit führen würde.
Zunächst werden also die Entwicklungen in den Einzelsprachen aufgezeigt, bevor sie mit Hilfe des Jespersen Zyklus in einen größeren Zusammenhang eingebettet werden, wodurch sich nun Parallelen oder Differenzen hinsichtlich der Evolution ergeben können.
Die Verneinung gilt als sprachliches Universale, also etwas, das es in allen natürlichen Sprachen gibt. Tatsächlich verfügt jede Sprache über eine Satznegation mit denkbar simpler Semantik. Negiert wird die Proposition eines Satzes, indem ihr ihr Komplement, d.h. die Menge der Situationen, in denen sie nicht wahr ist, zugewiesen wird.
Das Phänomen der Negation beruht darauf, dass ihre universalen Qualitäten im syntaktischen, semantischen, prosodischen sowie morphologischen Bereich zu finden sind.
Als syntaktische Kategorie kann für die Negation eine feste strukturelle Position innerhalb eines Satzes in Bezug auf die Verbalphrase (VP) angenommen werden, wodurch die Proposition des Satzes in ihren Bereich rückt. Auch in der generativen Grammatik wird eine spezielle Negationsphrase vorausgesetzt, die eine Stellung in der Hauptprojektionslinie von V (Verb) nach C (Komplementierer) einnimmt, zumeist zwischen IP (Flexionsphrase) und VP.
Im semantischen Bereich der Negation muss zwischen den Begriffen Geltungsbereich oder Skopus und Fokus unterschieden werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Diachrone Entwicklung der Negation in diversen Sprachen
- Die Negation im Deutschen
- Negation mit einfacher, präverbaler Partikel
- Negation durch präverbale + freie Partikel
- Negation durch freie Partikel
- Die Negation im Französischen
- Die Negation im Englischen
- Die Negation im Deutschen
- Der Jespersen-Zyklus
- Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die diachrone Entwicklung der Satznegation im Deutschen, Englischen und Französischen. Ziel ist es, die Entwicklungen in den einzelnen Sprachen darzustellen und diese im Kontext des Jespersen-Zyklus zu analysieren, um Parallelen und Unterschiede in der Evolution der Negation aufzuzeigen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Satznegation und lässt Sondernegationen außer Betracht.
- Diachrone Entwicklung der Negation in verschiedenen Sprachen
- Vergleichende Analyse der Negation im Deutschen, Englischen und Französischen
- Anwendung des Jespersen-Zyklus als analytisches Modell
- Untersuchung syntaktischer, semantischer und morphologischer Aspekte der Negation
- Identifizierung von Parallelen und Unterschieden in der Entwicklung der Negation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Negation als sprachliches Universale ein und erläutert die grundlegenden semantischen und syntaktischen Aspekte der Negation. Sie hebt die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Geltungsbereich und Fokus der Negation hervor und illustriert dies anhand von Beispielsätzen. Die Einleitung legt den Fokus auf die bevorstehende Untersuchung der diachronen Entwicklung der Negation in ausgewählten europäischen Sprachen und den Bezug zum Jespersen-Zyklus.
Diachrone Entwicklung der Negation in diversen Sprachen: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Negation in den einzelnen Sprachen (Deutsch, Französisch, Englisch). Es werden verschiedene Arten der Negation, wie die Negation mit einfachen Partikeln, präverbalen und freien Partikeln, vorgestellt und im Kontext der jeweiligen Sprachgeschichte beleuchtet. Die Analyse beinhaltet sowohl syntaktische als auch morphologische Aspekte, um ein umfassendes Bild der Entwicklung der Negation in jeder Sprache zu präsentieren. Die einzelnen Abschnitte zu Deutsch, Französisch und Englisch bilden die Grundlage für den anschließenden Vergleich mittels des Jespersen-Zyklus.
Der Jespersen-Zyklus: Dieses Kapitel betrachtet die Entwicklung der Negation durch die Linse des Jespersen-Zyklus. Es werden die in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Entwicklungen der Negation in Deutsch, Französisch und Englisch im Lichte dieses Modells analysiert. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Entwicklungspfade und der Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in Bezug auf den Jespersen-Zyklus. Das Kapitel diskutiert die Übereinstimmung und Abweichung der einzelnen Sprachen von den im Zyklus beschriebenen Phasen und möglichen Erklärungen für diese Variationen.
Schlüsselwörter
Negation, Jespersen-Zyklus, Diachronie, Deutsch, Englisch, Französisch, Satznegation, Syntax, Semantik, Morphologie, Sprachvergleich, Sprachentwicklung, Präverbale Partikel, Freie Partikel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Diachrone Entwicklung der Negation im Deutschen, Englischen und Französischen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die diachrone (zeitliche) Entwicklung der Satznegation in drei europäischen Sprachen: Deutsch, Englisch und Französisch. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Entwicklungsverläufe und der Anwendung des Jespersen-Zyklus als analytisches Modell.
Welche Sprachen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Entwicklung der Negation im Deutschen, Englischen und Französischen. Sondernegationen werden dabei nicht berücksichtigt.
Was ist der Jespersen-Zyklus?
Der Jespersen-Zyklus ist ein Modell, das die typische Entwicklung der Negation in Sprachen beschreibt. Die Arbeit analysiert, inwiefern die Entwicklung der Negation in den untersuchten Sprachen diesem Zyklus folgt oder davon abweicht.
Welche Aspekte der Negation werden untersucht?
Die Analyse umfasst syntaktische (Satzbau), semantische (Bedeutungs-) und morphologische (Wortbildungs-) Aspekte der Negation. Es werden verschiedene Arten der Negation, wie die Negation mit einfachen, präverbalen und freien Partikeln, betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur diachronen Entwicklung der Negation in den drei Sprachen, ein Kapitel zum Jespersen-Zyklus und eine Schlussfolgerung (Conclusio).
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema ein, erläutert grundlegende semantische und syntaktische Aspekte der Negation und hebt die Bedeutung des Geltungsbereichs und Fokus der Negation hervor. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit auf die diachrone Entwicklung und den Bezug zum Jespersen-Zyklus.
Was wird im Kapitel zur diachronen Entwicklung der Negation behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Negation in Deutsch, Englisch und Französisch. Es werden verschiedene Negationsarten vorgestellt und im Kontext der jeweiligen Sprachgeschichte beleuchtet. Die Analyse beinhaltet syntaktische und morphologische Aspekte.
Was wird im Kapitel zum Jespersen-Zyklus behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Negation anhand des Jespersen-Zyklus. Es vergleicht die Entwicklungspfade der drei Sprachen und identifiziert Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Bezug auf den Zyklus. Übereinstimmung und Abweichungen von den im Zyklus beschriebenen Phasen werden diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Zu den Schlüsselwörtern gehören: Negation, Jespersen-Zyklus, Diachronie, Deutsch, Englisch, Französisch, Satznegation, Syntax, Semantik, Morphologie, Sprachvergleich, Sprachentwicklung, Präverbale Partikel, Freie Partikel.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die diachrone Entwicklung der Satznegation in Deutsch, Englisch und Französisch darzustellen, diese im Kontext des Jespersen-Zyklus zu analysieren und Parallelen sowie Unterschiede in der Evolution aufzuzeigen.
- Arbeit zitieren
- Marion Koppenberger (Autor:in), 2013, Die Negation. Jespersen-Zyklus. Das Deutsche und andere europäische Sprachen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/992507