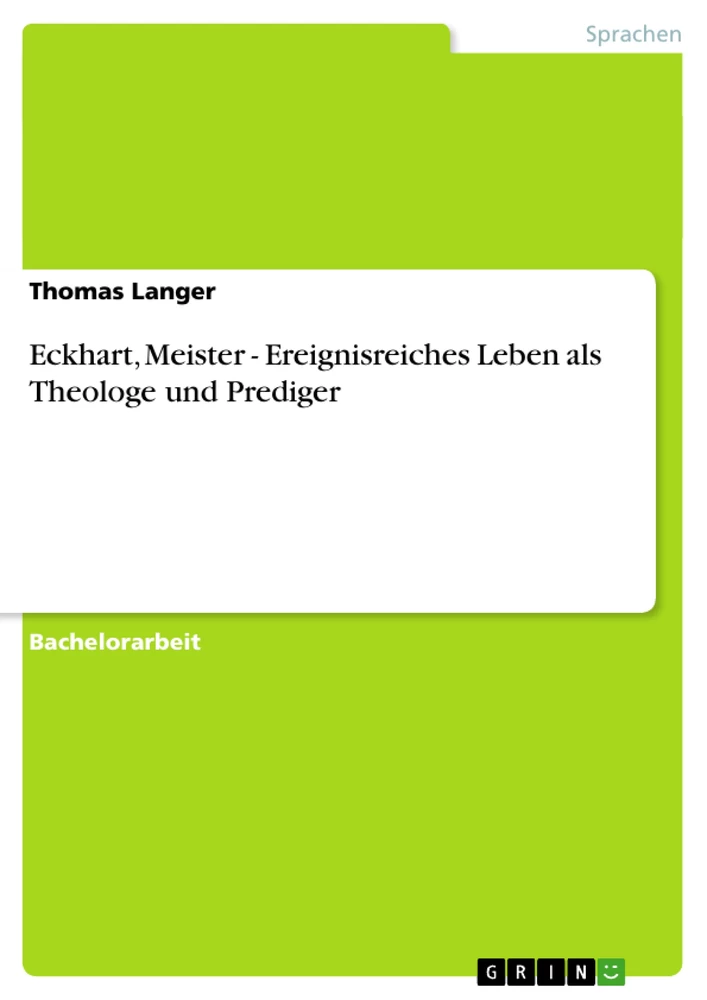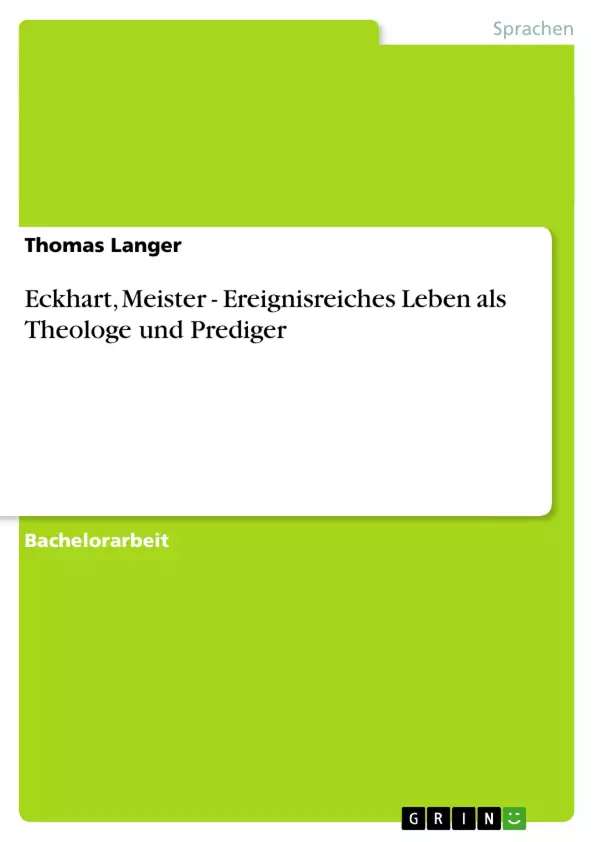Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG
2 SEINE GELEHRTEN- UND ÄMTERLAUFBAHN
2.1 ECKHART IN PARIS
2.2 ECKHART IN DEUTSCHLAND
2.3 ECKHART IN STRAßBURG
2.4 AUFENTHALT IN KÖLN
3 DER INQUISITIONSPROZEß
3.1 NIKOLAUS VON STRAßBURG - DER ERSTE ANKLÄGER
3.2 INQUISITIONSPROZEß IN KÖLN
3.3 DAS ENDE EINES MEISTERS
4 DIE MYSTIK ECKHARTS
4.1 ZUM BEGRIFF MYSTIK
4.2 WAR ECKHART EIN MYSTIKER?
4.3 ECKHARTS PHILOSOPHISCHE GRUNDAUSSAGEN
5 ECKHARTS WIRKUNG AUF DIE NACHWELT
6 SCHLUßBETRACHTUNG UND AUSBLICK
7 LITERATURVERZEICHNIS
1 Einleitung
Meister Eckhart, der große Theologe und Prediger, gestern wie heute beliebt bei Gottsuchern verschiedenster Glaubensrichtungen, trat in die Fußstapfen eines der größten Theologen des Christentums, Thomas von Aquin, als er zweimal an die Sorbonne berufen wurde. Eine kurze Darstellung der bekannten vita des Meisters soll der Zweck dieser Arbeit sein. Ausgangspunkt wird seine erste namentliche Erwähnung in Paris sein, weitere Stationen in seinem Leben sollen kurz und überschaubar skizziert werden. Ein zweiter Teil der Arbeit will sich mit dem Gedankengut Eckharts beschäftigen. Einige zentrale Ideen werden hier vorgestellt. In diesem Rahmen soll auch sporadisch sein Einfluß auf andere Denker gezeigt werden.
2 Seine Gelehrten- und Ämterlaufbahn
2.1 Eckhart in Paris
Trotzdem dieser große Denker und Mystiker des Mittelalters im vollen Rampenlicht der Geschichte steht, gibt es keine Aufzeichnungen über sein Leben, die über sein 30. Lebensjahr zurückführen. Daß sich aber überhaupt eine belegbare Biographie rekonstruieren läßt, das hebt ihn deutlich ab von anderen Dichtern seiner Zeit.
Über sein genaues Geburtsdatum lassen sich nur Rückschlüsse machen. Das Dominikaner-kloster in Erfurt war sein Heimatkloster. Falls man die übliche Ausbildungszeit, sie beinhaltet Lateinschule, Noviziat, Hausstudium (Studium logicale, naturale, biblicum) und schließt mit der Priesterweihe ab, voraussetzt und einen Klostereintritt im Knabenalter annimmt, so dürfte Eckhart um 1260 geboren sein.1
Erstmals genannt wird Eckhart als Redner der theologischen Fakultät in Paris. Am 18. April des Jahres 1294 hält frater Ekhardus als lector sentiarum die Festpredigt am Ostertag. Dies geht aus dem Cod. 83 der Stiftsbibliothek Kremsmünster hervor. Es handelt sich hierbei um eine Pariser Sammlung von Predigten und Collationen.
Eckhart war zu diesem Zeitpunkt also bereits Sentenzenlektor, er hatte damit bereits ein gehobenes Amt der Universitätslaufbahn inne. Alles davor liegende läßt sich nur mit Hilfe von Rückschlüssen rekonstruieren. Da er an der Sorbonne Baccalarius der Theologie geworden ist, kann man durchaus annehmen, daß der junge Dominikanermönch sein vierjähriges Theologiestudium gänzlich an der Pariser Universität absolviert hat. Ob er sein Studium der Theologie in Köln begonnen hat, wie es für deutsche Nachwuchstheologen seiner Zeit normalerweise der Fall war, läßt sich nicht belegen. Da er jedoch sein Artes-Studium an der Universität in Paris gemacht hat, stellt sich die Frage, warum er nicht sein ganzes Studium an der Sorbonne absolviert haben soll, muß er es doch dort abgeschlossen haben, um ein Baccalarius dieser Universität zu sein.2 Doch auch die Annahme, Eckhart habe in Köln und in Paris studiert, ist heute noch eine weit verbreitete Meinung in diversen Forschungskreisen.3
Als Sentenzenlektor war es seine Aufgabe das akademische Lehrbuch der Theologie, die Libriquatuor Sententiarum zu erklären. Von diesen Unterweisungen ist nur die Collatio in librosSententiarum erhalten. In dieser Collatio, sie thematisiert als Einführung den Gegenstand der Vorlesung, stellt Eckhart die vier Bücher der Sentenzen vor.
!302 war das Jahr, in dem Meister Eckhart sich ein weiteres Mal nach Paris begab, um an der berühmtesten Universität des Abendlandes zu unterrichten. Während seiner Pariser Jahre wohnte Eckhart im Dominikanerkonvent St. Jaques, ein Gebäude gegenüber der Sorbonne.
Er erhielt eine Lizenz für das theologische Doktorat und konnte somit einen Lehrstuhl für ein Jahr übernehmen. Es handelte sich hierbei um den für Nichtfranzosen reservierten Lehrstuhl für Dominikaner. Die bedeutendsten Schriften aus dieser Zeit, die erhalten geblieben sind, sind drei Quaestionen. Diese Streitfragen müssen als im Hörsaal vorgetragen und mit Hilfe dialektischer Mittel zu lösen gedacht werden.
Die erste Quaestio handelt vom Sein und Erkennen in Gott: Utrum in Deo sit idem esse et intellegere. Er argumentiert hier, Gott könne als Ursache des Seins nicht dieses selbst sein. Er führt seine Beweise weiter und kommt schließlich zu dem Schluß „daßGott das Sein nicht zukommt und daßer kein Seiendes ist, sondern er ist etwas Höheres als das Seiende“.4
Die zweite Quaestio bezieht sich auf die Engel: Utrum intellegere angeli, ut dicit actionem, sit suum esse. Um diese Frage zu lösen verwendet er ähnliche Argumente wie zur Lösung der ersten Quaestio. Interessanterweise spricht er nur in der Thesenformel von Engel, in der weiteren Argumentation spricht er immer vom intellectus.
Bei der dritten Quaestio handelt es sich um ein Streitgespräch mit dem Franziskaner Gonsalvus Hispanus. Er stellt folgende Frage: Utrum laus die in patria sit nobilior eius dilectione in via. Der Franziskaner versteht unter Lobpreis die Schau Gottes. Somit bezieht sich diese aif den ersten Blick als Spitzfindigkeit anzusehende Frage auf den zentralen Punkt der Doktrin, in der sich Franziskaner und Dominikaner unterschieden - ist dem Willen oder dem intellectus Vorrang zu geben in der Beziehung zwischen Mensch und Gott.
2.2 Eckhart in Deutschland
Bevor an dieser Stelle sein Betätigungsfeld in Deutschland kurz dargestellt werden soll, soll noch die Frage nach seiner Herkunft geklärt werden.
In dem Explicit jener Festpredigt, das er am 28. August 1303 in Paris zu Ehren des hl. Augustinus gehalten hat, findet sich ein deutlicher Hinweis auf seinen Geburtsort: „Iste sermo sic reportatus abore magistri Eckardi de Hochheim, die beati Augustini.“ 5 Was zunächst so einfach zu deuten zu sein scheint erweist sich bald als nicht mehr ganz so einfach. Der Name seines Geburtsortes ist auf jeden Fall Hochheim. Ein Blick auf die Landkarte verrät jedoch, daß es zwei Dörfer dieses Namens gibt. Eines liegt bei Erfurt, das andere bei Gotha.
Aus dieser Situation ergab sich eine Diskussion, die die Eckhartforschung lange beschäftigen sollte. Verwirrung stiftete diesbezüglich eine Urkunde einer Äbtissin der Zisterzienserinnen. In dieser Urkunde wird erklärt, der „Herr Eckhart, Ritter, genannt von Hochheim“ habe dem Kloster eine Schenkung zuteil werden lassen. Bei diesem Ritter handelt es sich aber um einen 1305 Verstorbenen. Interessant wird es erst später. Der Beichtvater des Ritters war ein gewisser „Magistri Eckhardi“. Der Beichtvater Eckhart fungierte offenbar als Repräsentant der Familie des Verstorbenen. Ob Meister Eckhart jetzt wirklich von adeliger Herkunft ist und aus welchen Hochheim er nun stammt, darüber läßt sich noch keine eindeutige Aussage machen.6
Zurück zu seinen Ämtern in Deutschland. Nach seiner Rückkehr von seinem ersten Paris-aufenthalt 1293/94 wird Eckhart als Prior von Erfurt eingesetzt und vom Provinzial der Teutonia zum Vikar für Thüringen ernannt. 1298 wurde auf dem Generalkapitel die Unvereinbarkeit dieser beiden Ämter angeordnet. Welches Amt er daraufhin weiter inne hatte ist nicht geklärt. Seine spätere
Ämterlaufbahn war jedoch eher durch die Aufgaben eines Vikars bestimmt. Außerdem wurden in der Teutonia 1300 alle Konventsprioren abgelöst.
Zum zweiten Mal aus der französischen Hauptstadt zurückgekehrt, bekleidete Meister Eckhart nun das Amt eines Provinzials. Von der zu groß gewordenen Teutonia wurde die Saxonia abgespalten. Eckhart wurde ihr erster Provinzial. Amtssitz war das Dominikaner-kloster in Erfurt.
Als Provinzial mußte Eckhart zahlreiche Aufgaben wahrnehmen. Zu ihnen zählten beispielsweise die Organisation, Durchführung und Leitung des jährlichen Provinzialkapitels. Des weiteren gründete Meister Eckhart während seiner Amtszeit drei Frauenkonvente. Von seinen Klostergründungen ist heute jedoch nichts mehr zu sehen. Im Zuge der Reformation wurden Kirchen und Klöster samt der klösterlichen Archive zerstört.
1307, also noch während seiner Amtszeit als Provinzial von Saxonia, wurde Eckhart als Generalvikar nach Böhmen geschickt. Mit besonderen Vollmachten ausgestattet führte er dort anscheinend dringliche Reformen durch.
1310 wurde Eckhart zum Provinzial der Teutonia gewählt. Er wurde somit als Nachfolger des bedeutenden Theologen Johannes von Lichtenberg bestimmt. Das Generalkapitel von Neapel, abgehalten 1311, bestätigte diese Wahl jedoch nicht. Es entband Eckhart sogar noch seines sächsischen Provinzialamtes und schickte ihn abermals nach Paris. Mit der Wahrnehmung eines zweiten Magisteriums an der Sorbonne wurde ihm eine Ehre zuteil, die vor ihm nur Thomas von Aquin auszeichnete. Eckhart hielt sich hier von 1311 bis 1313 auf.
Während dieser zweiten Amtszeit in Paris wird Eckhart erstmals mit den Inquisitions-prozessen gegen die Beginen konfrontiert. Die Beginen und Begarden sind zu jener Zeit in großer Zahl als Bettler unterwegs und vertraten nicht selten Glaubensauffassungen, die mit der Lehre der katholischen Amtskirche nicht konform gingen. Während des Konzils von Vienne (1312/13) wurde ein Antrag auf das Verbot der Begarden und ihres weiblichen Anhangs gestellt. Die acht „ ErroresBeguardorum et Beguinarum de statu perfectionis“ formulierte man dort.7
Zu jener Zeit wurden auch bereits die ersten Anhänger dieser Orden Opfer der Inquisition.
Beispielsweise wurde die Begine Maguerite Porete 1310 am Scheiterhaufen verbrannt.8 Obwohl der Konzilsbeschluß vorerst nur die umherschweifenden Brüder und Schwestern betraf, mußten die Leiter der Orden auch auf die ihnen unterstehenden Frauenklöster achten, in welchen die Spiritualität zu überwuchern begann.
2.3 Eckhart in Straßburg
Zurück aus Frankreich durfte Eckhart nicht mehr in seine Provinz Saxonia heimkehren. Die Ordensleitung beauftragte ihn mit einer Sonderaufgabe in Straßburg. Dort wurde ihm als Generalvikar die seelsorgerische Betreuung jener Frauenklöster und -konvente, die dem Orden unterstellt waren, übertragen.
Eckhart sah sich dort mit einer Frauenmystik konfrontiert, die mit ihrer überzogenen Askese, den Ekstasen und Visionen häufig recht problematisch war. Manche Formulierungen, die die Vereinigung mit Gott betrafen, brachten den Predigerorden in ernsthafte Gefahr, standen sie doch in der Nähe der als Ketzerei verurteilten Aussagen der Beginen9. Eine mögliche Aufgabe Eckharts könnte es gewesen sein, „ berechtigte mystischen Anliegen der frommen Frauen zu wahren, aber doch ihr Abgleiten zu verhindern “.10
Vor diese schwierige Aufgabe gestellt muß man seine Predigten verstehen. Er versucht ständig die mystischen Erfahrungen weg von allem nur Emotionalen zu bringen, fort von freigeistiger Überheblichkeit. Dazu bemüht er alle wissenschaftlichen Argumente, die ihm zur Verfügung stehen. Und unter diesen Gesichtspunkten bedient er sich auch dem Medium der Predigt, als eine Form der Vermittlung mystischen Gedankenguts. Als Beispiel möge dieser kurze Auszug einer Predigt Eckharts dienen:
„Nun sagen gewisse Leute:“Habe ich Gott und die Gottesliebe, so kann ich recht wohl alles tun, was ich will“. Die verstehen das Wort nicht recht. Solange du irgend etwas vermagst, das wider Gott und wider sein Gebot ist, solange hast du die Gottesliebe nicht; du magst die Welt wohl betrügen, als habest du sie. Der Mensch, der da in Gottes Willen steht und in Gottes Liebe, dem ist es lustvoll, alles das zu tun, was Gott lieb ist und alles zu lassen, was wider Gott ist, und ihm ist’s ebenso unmöglich, irgend etwas zu unterlassen, was Gott getan haben will, wie irgend etwas zu tun, was wider Gott ist.“ 11
Da Eckhart nur während seiner Visitationen seine Meinung vertreten konnte, bleibt sein Einfluß trotz seiner großen Bemühen eher gering. Dennoch wandten sich zahlreiche Nonnen an den Meister in seiner Funktion als Beichtvater. Etwa Anna von Ramschwag, die heimlich an sein Beichtfenster tritt und ihm drei Fragen vorgelegt, deren Antwort „ von so hohen, unbegreiflichen Dingen“ 12 gewesen sein sollen, daß die Chronistin sie nicht verstehen kann.
Nicht nur diese Chronistin war eine von denen, die Meister Eckhart nicht unbedingt verstanden. Eine Nonne schreibt nach einer Predigt Eckharts:
Der wise meister Hechard
Wil uns von nihte san;
Der das niht enverstat, Der mag es gote clan; In dem hat niht geluchtet Der godeliche schin!“ 13
Am 18. Jänner 1319 verbot der Bischof von Straßburg den Beginenstand in seiner Diözese. Die Betroffenen sahen sich aufgefordert, ihre geistliche Tracht abzulegen und ihre religiösen Pflichten in den Stadtkirchen zu erfüllen. Dem Predigerorden wurde verboten, die geistliche Betreuung, die sie bis dahin den Beginen erwiesen, fortzuführen. Daß Meister Eckhart von diesen Maßnahmen direkt betroffen war, muß man allein wegen seiner Tätigkeit in Straßburg annehmen.
2.4 Aufenthalt in Köln
Frühestens Ende 1322, manche Forscher nehmen überhaupt erst 1323 an, wurde Meister Eckhart nach Köln geschickt. Dort sollte auch bald der Prozeß gegen ihn anlaufen, davon jedoch später.
Unsicher ist die Forschung, was für eine Funkton Meister Eckhart in Köln inne hatte. Einige sind der Meinung, er sollte dort als Nachfolger des Albertus Magnus fungieren und das Generalstudium seines Ordens leiten.14 Für solch eine Tätigkeit gibt es aber keinen Beweis. Als einzig angesehenes Zeugnis gilt eine Anspielung, die er in einer Predigt getätigt hat:
„Ein vrâge war gester in der schuole under grôzen pfaffen. ,Mich wundert’, sprach ich, , daz diu geschrift alsôvol ist, daz nieman daz allerminste wort ergründen enkan’ [ ... ] “. 15
Da alle Dominikaner an derartigen Disputationen teilnehmen mußten, kann die obige Erwähnung noch nicht als Nachweis für Lektorentätigkeit gesehen werden.16
3 Der Inquisitionsprozeß
3.1 Nikolaus von Straßburg - der erste Ankläger
Nikolaus von Straßburg wurde am 1. August 1325 zum päpstlichen Visitator der Teutonia berufen. Köln, wo sich Eckhart zu jener Zeit ja aufhielt, gehörte zur Teutonia. Wie oben erläutert, wird ja angenommen, Meister Eckhart hätte eine Stelle als Lektor des General-studiums wahrgenommen, Nikolaus von Straßburg wurde vom Papst als „ olim lector(em) in conventu Coloniensi“ 17 bezeichnet. Einerseits waren die beiden also gewissermaßen Kollegen, andererseits war der Visitator Nikolaus der Überprüfer von Eckharts Lehren.
Ohne besonderen Auftrag führte Nikolaus von Straßburg 1325/26 ein Verfahren gegen Eckhart. Das Verfahren hatte den Zweck, Eckharts Lehren auf ihre Rechtsgläubigkeit zu überprüfen. Im Vordergrund der Anklage stand der ,Liber benedictus’, eine deutsche Schrift Eckharts. Das Verfahren endete mit Freispruch.
Warum hatte Nikolaus von Straßburg aus heiterem Himmel ein Verfahren gegen Meister Eckhart eingeleitet? Er setzte sich als Ordensbruder damit dem Vorwurf der Illoyalität aus und beschwor vielleicht sogar krisenhafte Zustände der Ordensschule herauf. Sicherlich müssen es schwerwiegende Gründe gewesen sein, die ihn trotzdem zur Anklage veranlaßte. Eine mögliche Erklärung wäre folgende:
„Die Quellen schweigen darüber, aber aus dem weiteren Verlauf derEreignisse um Eckharts Rechtgläubigkeit kann nur geschlossen werden, daßNikolaus einer Anklage des Kölner Erzbischofs zuvor kommen wollte. Er klagte also an, um mit einem Freispruch das erzbischöfliche Inquisitionsverfahren zu verhindern.“ 18
Eine andere Meinung gründet sich auf dem Umstand, daß es Nikolaus als Visitator nicht möglich war, aus eigenem Antrieb ein Disziplinarverfahren gegen Eckhart einzuleiten. Dazu war er nicht ermächtigt. In seiner Tätigkeit als Visitator mußte sich Nikolaus von Straßburg die von Konventmitgliedern vorgebrachten Beschwerden und Beschuldigungen anhören. Sollten also im Rahmen der Visitation Beschuldigungen gegen Eckhart von einigen seiner Ordensbrüdern erhoben worden sein, so war es Pflicht des Visitators, diesen nachzugehen.19
Die Beschuldigungen bezogen sich auf Eckharts Predigtweise. Offenbar haben viele seiner Mitbrüder, die seine spekulative Mystik nicht nachvollziehen konnten, ihn in seinen Predigten nicht verstanden. Dies findet sogar Erwähnung in einer der Schriften Eckharts:
„Daz ander wort, daz ich meine, daz maniger grop mensche sol
sprechen, daz vil wort, diu ich an disem buoche un ouch anderswâgeschriben hân, niht wâr ensîn.“ 20
Weiter unten im ,Liber benedictus’ bedient er sich der Worte des hl. Augustinus um noch einmal auf die unverständigen Brüder einzugehen:
„Waz mac ich, ob ieman daz niht enverstât? [...] Mit genüeget, daz in mir und in gote wâr sîn, daz ich spriche und schribe. Der einen stapschaft sihet gestôzenen in ein wazzer, den dunket der stap krump sîn, aleine er gar reht sî, und kumet daz dâvon, daz wazzer gröber ist dan luft;“ 21
Hinzu kommt sicherlich auch noch, daß Eckhart auf der Seite des Visitators für eine Reform eintrat. Reformunwillige Brüder könnten sozusagen als Gegenschlag Nikolaus gezwungen haben, ein Untersuchungsverfahren gegen Eckhart einzuleiten.
Welche Umstände nun auch verantwortlich dafür waren, daß es zu einer solchen Anklage durch Nikolaus von Straßburg kam, das Urteil ist eine Tatsache. Es handelte sich, wie bereits erwähnt, um einen Freispruch. Und weil es sich bei diesem Prozeß nicht um einen Straf-prozeß handelte, hatte das Urteil auch keine Rechtswirksamkeit.22
3.2 Inquisitionsprozeß in Köln
1326, noch im Jahre des ersten Prozesses gegen ihn, eröffnet der Erzbischof von Köln, Heinrich II. von Virneburg, den Inquisitionsprozeß gegen Meister Eckhart. Die Komissare sind Reinerius Friso, Doktor der Theologie, und der Franziskanertheologe Petrus de Estate sowie dessen Nachfolger Albert von Mailand.
Heinrich von Virneburg war während seiner gesamten Amtszeit (1304 - 1332) als „erfolgreicher Ketzerhammer“ 23 tätig. Auf sein Konto gehen zahlreiche Verurteilungen von Beginen, die, nachdem sie der Ketzerei überführt worden waren, verbrannt oder im Rhein ertränkt wurden. Daß er seiner Sorge darüber, die Kurie könnte nach Eckharts Tod den Prozeß gegen den Meister einstellen, in einem Schreiben an den Papst so deutlich Ausdruck verleiht, könnte ein Indiz für ein starkes, persönliches Interesse an Eckharts Verurteilung gewesen sein.24 Andererseits war es den Bischöfen auch vorgeschrieben, streng gegen vermeintliche Ketzer vorzugehen. Der Bischof von Köln wurde aus dieser Sichtweise gleichsam von der kirchlichen Gesetzgebung dazu gezwungen gegen Eckhart vorzugehen.25
Aus seinem eigenem Orden stellten sich seine Kölner Mitbrüder Hermann de Summo und Wilhelm von Nidecken als Ankläger und Zeugen zu Verfügung. Laut einer Anklageschrift des päpstlichen Generalprokurators des Dominikanerordens sind die beiden jedoch als „notorische Intriganten, Zuträger, Falschzeugen, Verleumder“ 26 bekannt.
Wie stand nun der eigene Orden dem Prozeß gegen einem seiner berühmtesten Prediger gegenüber? Eine offizielle Loyalitätsbekundung wäre während eines Inquisitionsprozesses wohl nicht möglich gewesen. So war die Haltung des Ordens Meister Eckhart gegenüber zunächst zurückhaltend distanziert. Seine Schriften wurden nicht in den Schriftstellerkatalog aufgenommen und man schwieg zum Verfahren gegen einen seiner größten Brüder. Andererseits unterstützte der Orden Eckhart während des Prozesses so gut er konnte. Gerhard von Podahn weiß so über Eckhart folgendes zu sagen: „niemand der Eckharts Leben kenne, könne an seinem Glauben und der Heiligmäßigkeit (sanctitas) der Lebensführung zweifeln“.27 Außerdem dachte die Ordensleitung keineswegs daran, eigene originäre Gedankengänge zu unterbinden, trotzdem sie darauf bestand, die Lehre des Thomas von Aquin zu vertreten.28
Interessant erscheint hier zu sein, daß Eckhart nicht in Haft genommen wurde, war dies doch gegen einen der Häresie Verdächtigten ein durchaus legitimes Vorgehen. Auch seine Funktionen als Priester wurden nicht geschmälert.
Bei dem Verfahren gegen Meister Eckhart handelte es sich um einen Inquisitionsprozeß. Diese von Papst Innozenz III. anstelle des Infamationverfahren gesetzten Prozeßform ermöglichte dem Beschuldigten nicht nur alle Möglichkeiten der Verteidigung, sie verlangte auch von den Klägern eine rationale Beweisführung. Der Inquisitionsprozeß gegen Meister Eckhart ist jedoch kein normaler, es handelt sich in seinem Fall um ein Ketzerverfahren. Diese Sonderform schränkt nicht nur die Verteidigungsmöglichkeiten des Beschuldigten erheblich ein, es läßt auch das Einreden des Angeklagten gegen den Denunzianten unbeachtet. Obschon Glaubensprozesse gegen Theologen beinahe an der Tagesordnung standen, ist Eckhart der einzige wichtige Theologe gegen den ein Ketzerverfahren eingeleitet wurde. Warum wurde gerade Meister Eckhart Opfer eines solchen? Die Antwort scheint nahe zu liegen. Eckhart war ja nicht nur Theologe, er war vor allem ein Volksprediger. Er vermittelte seine „Irrtümer“ den Laien.
Angeklagt wurde Eckhart mit Hilfe von vier (oder fünf) Listen, die seine Häretischen Aussagen in Sätzen formulieren.29 Eckhart antwortet auf die Anklage, indem er an den päpstlichen Stuhl appelliert. Die Appellation wurde abgelehnt.30 In eineröffentlichen Predigt widerrief er jene Sätze, derentwegen er vor Gericht stand. Dies mußte er tun, weil „deröffentliche Widerruf der als häretisch erkannten Sätze erfolgen mußte, wollte der Angeschuldigte vermeiden, persönlich als Häretiker verurteilt zu werden“.31 Meister Eckhart konnte von nun an nicht mehr als Ketzer verurteilt werden.
3.3 Das Ende eines Meisters
Die Ablehnung der Appellation zwang Eckhart aber nicht, sich weiterhin der Jurisdiktion in Köln zu unterstellen. Das zu tun hatte er anscheinend auch nicht länger im Sinn. Eckhart zieht in Begleitung einiger Mitbrüder nach Avignon.
Die vorgelegte Kölner Anklageliste zu überprüfen lag nun am Konsistorium, der päpstlichen Gerichtsinstanz. Die Listen wurden stark reduziert. Waren noch 49 Sätze auf Liste eins, gar 59 auf Liste zwei, so war im Konsistorium nur noch von 29 Sätzen die Rede. Diese wurden dann auch verurteilt. In diesem Verfahren, nunmehr lediglich ein Zensurverfahren, ging es nur noch um die Formulierung der einzelnen Sätze. „ [ H ]ereticus , pruot sonat“ 32 lautet so auch schließlich das Urteil. Dieses päpstliche Urteil erging in der Bulle ,In argo dominico’ vom 27. März 1329. Die endgültige Verurteilung seiner Aussagen erlebte Eckhart nicht mehr. Meister Eckhart starb vermutlich 1328.
4 Die Mystik Eckharts
4.1 Zum Begriff Mystik
Das, was in diesem Kontext unter Mystik verstanden wird, meint vor allem die Erfahrung Gottes in der Ekstase. Bonaventura von Bagnorea, der große Franziskanertheologe eine Generation vor Meister Eckhart, drückt dies sehr schön mit den Worten „cognitio Dei experimentalis“ aus. Das sich hier alles im Bereich der christlichen Mystik bewegt, sollte hier auch noch deutlich betont werden.
Der Begriff Mystik wird in der Forschungsgeschichte aber meist als Bewegung gesehen. Was die Geistesgeschichte betrifft, so spricht man gar von einer Epoche, dem „Zeitalter der deutschenMystik“. Diese Bezeichnung kann aber in ihrer Allgemeinheit nicht mehr aussagen als vergleichbare andere Universalbegriffe, die Romantik möge hier als Beispiel dienen.33
4.2 War Eckhart ein Mystiker?
Von seinen eigenen mystischen Erfahrungen spricht Meister Eckhart nie. Doch kann man wirklich annehmen, daß Eckhart keine mystischen Erfahrungen hatte, nur weil er nie davon sprach? Hätte er den vielen Mystikerinnen, die er als Seelsorger zu betreuen hatte, wirklich als solcher dienen können, wenn er nicht Bescheid darüber gewußt hätte, wovon die Nonnen sprachen? Auf jeden Fall nimmt er eine abwehrende Haltung gegenüber den Entrückungen, den Visionen und Auditionen in den von ihm betreuten Frauenkonventen ein. Er verurteilt ihre eigensüchtige Frömmigkeit mit harten Worten.
„Daz schînet sêre las innichheit und andâht und jubilieren und enist alwege daz beste niht; wan es enist von minne niht, sunder ez kumet von natûre etwenne, daz man solchen smak und süezicheit hât, [...]. “ 34
Als ein weiteres Indiz für Eckharts eigene mystische Erfahrungen soll noch auf seine Predigtweise hingewiesen werden. Müssen nicht eigene, von ihm natürlich verschwiegene, mystische Erfahrungen vorausgesetzt werden, will man Eckharts Predigten nicht eine innere Wahrheit absprechen?. Immer wieder betont er den Wahrheitsgehalt dessen, was er predigt.
„Daz ich iu geseit hân, daz ist wâr; des setze ich iu die wârheit ze einem geziugen und mîne sêle ze einem pfande.“ 35
Im „ buoch der goetlîchen troestung“ bezieht Meister Eckhart ein Augustinus-Zitat offenbar auf sich und seine mystischen Erfahrungen:
„Sant Augustînus sprichet: swerâne allerleie gedenke, allerleie lîphafticheit und bilde inne bekennet, daz keinûzerlich sehen îngetragen enhât, der weiz, daz ez wâr ist. Der aber des niht enweiz, der lachet und spottet mîn, und ich erbarme michüber in.“ 36
Er bezieht sich hier auf eine innere Bekenntnis jenseits der Begriffs- und Sinneswahrheit. Diese Anspielung auf eine intuitiv erfahrene Wahrheit kann nur ein Hinweis auf seine eigenen mystischen Erfahrungen sein.
4.3 Eckharts philosophische Grundaussagen
An dieser Stelle können nur einige wenige Aussagen von ihm äußerst kurz dargestellt werden. Eine tiefer gehendere Beschäftigung mit dieser Thematik würde nicht nur den Rahmen dieser Arbeit weit sprengen, sie würde auch nicht ganz dem Zweck dieser Arbeit dienen. Da es aber, vor allem was seinen Einfluß auf die Nachwelt betrifft, genau diese Spekulationen sind, die Eckhart so deutlich von seinen Zeitgenossen hervorhebt, kann man an ihnen nicht so einfach vorbeigehen.
Im Gegensatz zu den von ihm betreuten mystisch veranlagten Frauen besticht Eckhart durch eine klare Ausdrucksweise. Er hält sich streng an die theologische Sprache seiner Zeit. Trotzdem kam es zu einer Reihe von paradoxen und provokativen Aussagen, die schließlich zum Prozeß gegen ihn führten.
Eckharts Philosophie steht stark unter dem Einfluß von Albertus Magnus und Thomas von Aquin. Auch die neuplatonische Tradition beeinflußte ihn stark. Trotzdem gab es auch deutliche Unterschiede zu diesen. Beispielsweise stimmte er mit Thomas darüber überein, daß sich erst im Erkennen das Wesen des Menschen vollendet und der Mensch schließlich die Seligkeit erreicht, während aber für Thomas dies erst im Jenseits erreichbar ist, verlegt Eckhart den Schritt zu dieser Einheit mit Gott schon in das Diesseits.37
Ein zentraler Gedanke Eckharts ist die Freiheit. Es geht um die Freiheit vom Haben. Immer wieder nahm er bezug auf diese Freiheit. Was er meint, wenn er vom „Freisein von“ spricht, erläutert er selbst in einer seiner Predigten. In der Predigt „Intravit Jesus in templum“ (Mt 21, 12) thematisiert er dies in sehr schöner Art und Weise.
„Dirre tempel, dâgot inne hêrschen will gewalticlîche nâch sînem willen, daz ist des menschen sêle, die er sôrehte glîch nâch im selber gebildet und geschaffen hât, [...]. “ 38 Gott will die Seele frei wissen. Da Gott in allen seinen Werken frei ist, will er auch den gottverbundenen Menschen so frei sehen.
„Alsôtuot ouch dirre mensche, der mit got vereinet ist; der stât ouch ledic und vrîin allen sînen werken [...]. “ 39
Der mit Gott vereinte Mensch empfängt seinen Antrieb nicht mehr von außen, er kommt aus ihm selbst heraus.40 Indem der Mensch konsequent alles losläßt und frei in der Welt lebt, hört er auf irgend etwas haben zu wollen und „ensuochet des sînen niht“.41 Diese Freiheit bezieht er dann auch auf das Freisein von religiösen Werten, auch Gott kann nichts mehr „Haben“. In diesem Punkt stellt sich Eckhart in die Nähe der Brüder und Schwestern vom Freien Geiste.42
Als eine weiterer wichtiger Punkt in Eckharts Philosophie soll seine Spekulation über Gott und das Sein angerissen werden. Im Prolog seines Werkes Opus tripartitum stellt Eckhart die These auf, Gott und das Sein seien identisch. „Esse est deus.“ 43 Gott ist alles, er ist die Fülle des Seins. Er erläutert , daß Gott nicht wäre, wenn das Sein etwas anderes wäre als Gott. Das Sein ist nicht näher zu definieren. Eckhart schließt seine Ausführungen mit einem Bibelzitat:
„Praemissis alludit illud Exodi 3: ,ego sum qui sum’.“ 44
5 Eckharts Wirkung auf die Nachwelt
Eckharts Wirken auf die Nachwelt hat bis heute nichts von ihrer Stärke eingebüßt. In Zeiten wieder stärker werdenden Spiritualität, die weite Schichten der Gesellschaft zu erfassen scheint, wird der Meister wieder aktueller denn je. Nicht selten taucht Eckhart auch wieder in einem kirchlichen Kontext auf. Offenbar reagieren die Mitglieder der Kirche auf die immer größer werdende Esoterikwelle mit ihren eigenen Esoterikern, die natürlich nicht als solche bezeichnet werden. Doch bieten diverse Volkshochschulen und Bildungshäuser der katholischen Kirche immer wieder Kurse und Seminare über diesen großen Denker an.
Im Zuge der Eckhart-Erhöhung, die sich nun schon über Jahrhunderte hindurch zieht, konnte sich auch das Vermächtnis Meister Eckharts einer Pervertierung durch die Nazis nicht erwehren. Eckhart muß erdulden, vom Nazi-Chefideologen Alfred Rosenberg für sein Werk „Mythos des 20. Jahrhunderts“ in Anspruch genommen zu werden. Rosenberg bezeichnet ihn als den „größte [n] Apostel des nordischen Abendlandes“, er sei „die größte Seelenkraft, der schönste Traum des deutschen Volkes“.45
1980 starb ein anderer Denker, der sich ebenfalls stark von Eckhart beeinflussen ließ. Im Gegensatz zu Rosenberg mußte er aber während der Nazizeit emigrieren. Der Soziologe, Psychologe und Denker Erich Fromm schrieb als sein letztes Werk „Haben oder Sein“. Schon der Titel ist dem Buch „die rede der underscheidunge“ entnommen. Als Motto für sein Werk setzt er Meister Eckhart zwischen Lao-Tse und Karl Marx: „Die Menschen sollen nicht soviel nachdenken, was sie tun sollen, sie sollen vielmehr bedenken, was sie sind.“ 46 Nicht nur, daß er sich in seinem Werk immer wieder auch Eckhart bezieht beziehungsweise seine Ideen weiterführt, er widmet ihm sogar drei Kapitel seines Buches. Wie Eckhart weist auch Fromm immer wieder auf die Sehnsucht des Menschen zu sein hin.
„Wir Menschen haben ein angeborenes, tief verwurzeltes Verlangen zusein: unseren Fähigkeiten Ausdruck zu geben, tätig zu sein, auf andere bezogen zu sein, dem Kerker der Selbstsucht zu entfliehen. Für die Wahrheit dieser Behauptung gibt es so viele Beweise, daßman leicht ein ganzes Buch damit füllen könnte.“ 47
Und diese Beweise führt er auch an, wenngleich sie auch nicht ein ganzes Buch füllen. Wenn der Mensch es schafft, seine Kräfte frei zu machen, dann entsteht der neue Mensch. Diesen fordert Fromm gegen Ende seine Buches.
In die direkte Nachfolge Eckharts konnte ein anderer Dominikanerpater treten. Auch seine Werke wirkten, größtenteils in protestantischen Kreisen, ungebrochen bis in das 19. Jahrhundert hinein. Johannes Tauler mußte Meister Eckhart während dessen Tätigkeiten in Straßburg predigen gehört haben und hatte sicher auch persönlichen Umgang mit ihm48. Er verteidigt Eckhart dann auch:
„Euch belehrt und zu euch spricht ein liebwerter Meister, aber ihr begreift nichts davon. Er sprach aus der Ewigkeit, und ihr vertsteht es nach der Zeit.“ 49
Auch von einem anderen, nicht minder bedeutenden Dominikaner wird angenommen, daß er Kontakt zu Meister Eckhart hatte. Im Gegensatz zu Tauler gilt Heinrich Seuse als enger Schüler Eckharts. Meister Eckhart erschien ihm auch nach dessen Tod in einer Vision, wie er in seiner Vita schreibt.50 Seuse mußte Eckhart schon in Straßburg gekannt haben, und nicht erst in Köln, wo er als Verteidiger Eckharts auftrat. Aufgrund seiner engen Verbunden mit Meister Eckhart wurde er 1329 dann auch seines Amtes als Lektor in Konstanz enthoben. Es wird vermutet, daß ohne seine Verstrickung in den Eckhart-Prozeß und seine Folgen Seuse die akademische Laufbahn offengestanden wäre.51
6 Schlußbetrachtung und Ausblick
Meister Eckhart hat sich als überaus tätiger Mann erwiesen, der streng den Geboten seines Ordens und der Kirchenspitze folgte, wenngleich er auch mit verschiedenen Aussagen versuchte zu provozieren. Nie aber trachtete er sich gegen die Kirche und den von ihr vertretenen Glauben aufzulehnen. Im Gegenteil, ,Revoluzzertum’ und ,Eigenbrötlerei’ wurden von ihm heftig bekämpft. Der deutsche Predigerorden hatte in ihm wohl einen seiner berühmtesten Brüder gehabt.
Vieles mußte übergangen werden, manches wurde unzulänglich dargestellt. Auf eine Darstellung der einzelnen Werke Eckharts wurde gänzlich verzichtet. Eine nähere Beschäftigung mit diesen wäre ein interessantes Betätigungsfeld für die Philosophie-geschichte einerseits, die Sprachwissenschaft und Altgermanistik andererseits. Eine weites Forschungsgebiet würde der Vergleich mit anderen Religionen ergeben. Die von Eckhart vertretene Seinslehre findet sich in vielen Glaubensrichtungen wieder.
7 Literaturverzeichnis
Ernst von Aster, Geschichte der Philosophie. Stuttgart 1975.
F. C. Copleston, Geschichte der Philosophie im Mittelalter. München 1976. Erich Fromm, Haben oder Sein. München 1976.
Niklaus Largier (Hg.), Meister Eckhart. Werke I. Frankfurt am Main 1993. Niklaus Largier (Hg.), Meister Eckhart. Werke II. Frankfurt am Main 1993. Kurt Ruh, Geschichte der abendländischen Mystik. Bd. 3. München 1996. Kurt Ruh, Meister Eckhart. Theologe, Prediger, Mystiker. München 1985.
Winfried Trusen, Der Prozeß gegen Meister Eckhart. Vorgeschichte, Verlauf und Folgen. Paderborn u.a. 1988.
Eckard Wolz-Gottwald, Meister Eckhart und die klassischen Upanishaden. Würzburg 1984.
[...]
1 vgl. Kurt Ruh, Meister Eckhart. Theologe, Prediger, Mystiker. S. 20.
2 vgl. Kurt Ruh, (Fn. 1), S. 20.
3 vgl. F. C. Copleston, Geschichte der Philosophie im Mittelalter. München 1976 vgl. Ernst von Aster, Geschichte der Philosophie. Stuttgart 1975.
4 Kurt Ruh, (Fn. 1). S. 23.
5 Winfried Trusen, Der Prozeß gegen Meister Eckhart. Vorgeschichte, Verlauf und Folgen. Paderborn u. a. 1988. S.
6 vgl. Winfrid Trusen (Fn 5). S. 11ff. vgl. Kurt Ruh (Fn 1). S. 21.
7 Kurt Ruh, Geschichte der abendländischen Mystik. Bd. 3. München 1996. S. 240.
8 vgl. Kurt Ruh, (Fn. 7). S. 240.
9 s. Winfried Trusen (Fn 5). S.21.
10 Winfried Trusen (Fn. 5). S. 41.
11 Dt, Pr. 29, 291.
12 Kurt Ruh (Fn 1). S. 12.
13 Winfried Trusen (Fn. 5). S. 53.
14 vgl. Winfried Trusen, (Fn. 5), S. 62.
15 Predigt 22, DW I, S. 258.
16 vgl. Walter Senner, Meister Eckhart in Köln. in: Klaus Jacobi (Hg.), Meister Eckhart: Lebensstationen - Redesituationen. Berlin 1997. S. 207.
17 Winfried Trusen (Fn. 5). S. 63.
18 Kurt Ruh (Fn. 1). S. 169.
19 Winfried Trusen (Fn. 5), S. 66.
20 Liber benedictus, Werke II. S. 310.
21 ebd. S. 310
22 vgl. Kurt Ruh (Fn. 7), S. 245.
23 Kurt Ruh (Fn 7), S. 245.
24 vgl. Kurt Ruh (Fn. 7), S. 245.
25 vgl. Winfried Trusen (Fn. 5), S. 71.
26 Kurt Ruh (Fn 1), S. 170.
27 Kurt Ruh (Fn 7), S. 246.
28 vgl. Winfried Trusen (Fn 5), S.69.
29 vgl. Kurt Ruh (Fn 1), S. 175.
30 dazu Winfried Trusen, (Fn 5), S. 99ff.
31 Winfried Trusen (Fn. 5), S. 107.
32 ebd. S. 118.
33 vgl. Kurt Ruh (Fn 1), S. 187.
34 Traktate 2, Werke II, S. 362.
35 Predigt 2, Werke I, S. 36
36 Traktat 1, Werke II, S. 312.
37 vgl. Ernst von Aster (Fn. 3), S. 169f.
38 Predigt 1, Werke I, S. 10.
39 Fn 33, S. 12f.
40 vgl. Eckard Wolz-Gottwald, Meister Eckhart und die klassischen Upanishaden. Würzburg 1984. S. 52.
41 Fn. 33, S.14.
42 vgl. Kurt Ruh (Fn 1), S. 191.
43 Prologus generalis, Werke II, S. 472.
44 ebd. S. 474.
45 Kurt Ruh (Fn 1), S. 14.
46 Erich Fromm, Haben oder Sein. München 1976. S.5.
47 ebd. S. 100.
48 Kurt Ruh (Fn. 7), S.479.
49 Kurt Ruh (Fn. 1), S. 11.
50 vgl. Kurt Ruh (Fn. 7), S. 418.
Häufig gestellte Fragen zu Meister Eckhart
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Übersicht über das Leben und Wirken von Meister Eckhart, einem bedeutenden Theologen und Prediger des Mittelalters. Sie behandelt seine akademische Laufbahn, den Inquisitionsprozess gegen ihn, seine mystischen Lehren und seinen Einfluss auf die Nachwelt.
Wo begann Eckharts akademische Laufbahn?
Eckharts erste namentliche Erwähnung findet sich als Redner an der theologischen Fakultät in Paris im Jahr 1294.
Was waren Eckharts Aufgaben als Sentenzenlektor?
Als Sentenzenlektor war Eckhart für die Erklärung des akademischen Lehrbuchs der Theologie, der *Libri quatuor Sententiarum*, zuständig. Von diesen Unterweisungen ist nur die *Collatio in libros Sententiarum* erhalten.
Welche Ämter bekleidete Eckhart in Deutschland?
Nach seiner Rückkehr aus Paris wurde Eckhart Prior von Erfurt und Vikar für Thüringen. Später wurde er Provinzial der Saxonia und der Teutonia.
Was war der Anlass für den Inquisitionsprozess gegen Eckhart?
Der Inquisitionsprozess wurde aufgrund von Zweifeln an der Rechtgläubigkeit seiner Lehren eingeleitet, insbesondere im Hinblick auf den *Liber benedictus*.
Wer waren die Hauptakteure im Inquisitionsprozess?
Zu den Hauptakteuren gehörten Nikolaus von Straßburg, der Erzbischof von Köln Heinrich II. von Virneburg, sowie die Inquisitionskommissare Reinerius Friso, Petrus de Estate und Albert von Mailand.
Wie endete der Inquisitionsprozess?
Eckhart appellierte an den päpstlichen Stuhl und widerrief öffentlich jene Sätze, derentwegen er vor Gericht stand. Papst Johannes XXII. verurteilte in der Bulle *In agro dominico* vom 27. März 1329 einige seiner Aussagen, jedoch erst nach Eckharts Tod.
Was sind die zentralen Aspekte von Eckharts Mystik?
Eckharts Mystik betont die Erfahrung Gottes in der Ekstase und die Freiheit von allem Haben. Ein zentraler Gedanke ist die Identität von Gott und Sein ("Esse est deus").
Welchen Einfluss hatte Eckhart auf die Nachwelt?
Eckharts Lehren beeinflussten zahlreiche Denker und Mystiker, darunter Johannes Tauler, Heinrich Seuse und Erich Fromm. Auch in der modernen Spiritualität und Theologie findet Eckhart weiterhin Beachtung.
Welche Werke Eckharts werden in der Arbeit erwähnt?
Genannt werden u.a. die *Collatio in libros Sententiarum*, die *Quaestionen* aus seiner Zeit in Paris und der *Liber benedictus*.
Wo liegt der Geburtsort von Meister Eckhart?
Es gibt zwei Dörfer namens Hochheim. Eines liegt bei Erfurt, das andere bei Gotha. Die genaue Herkunft Eckharts ist nicht eindeutig belegt.
- Citar trabajo
- Thomas Langer (Autor), 1998, Eckhart, Meister - Ereignisreiches Leben als Theologe und Prediger, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99271