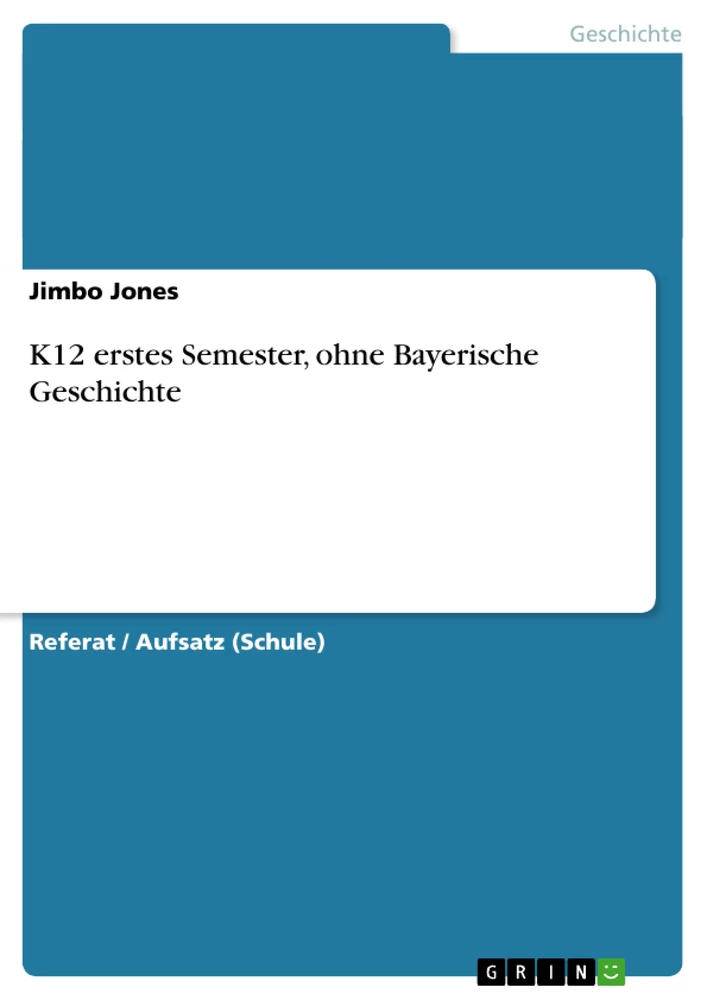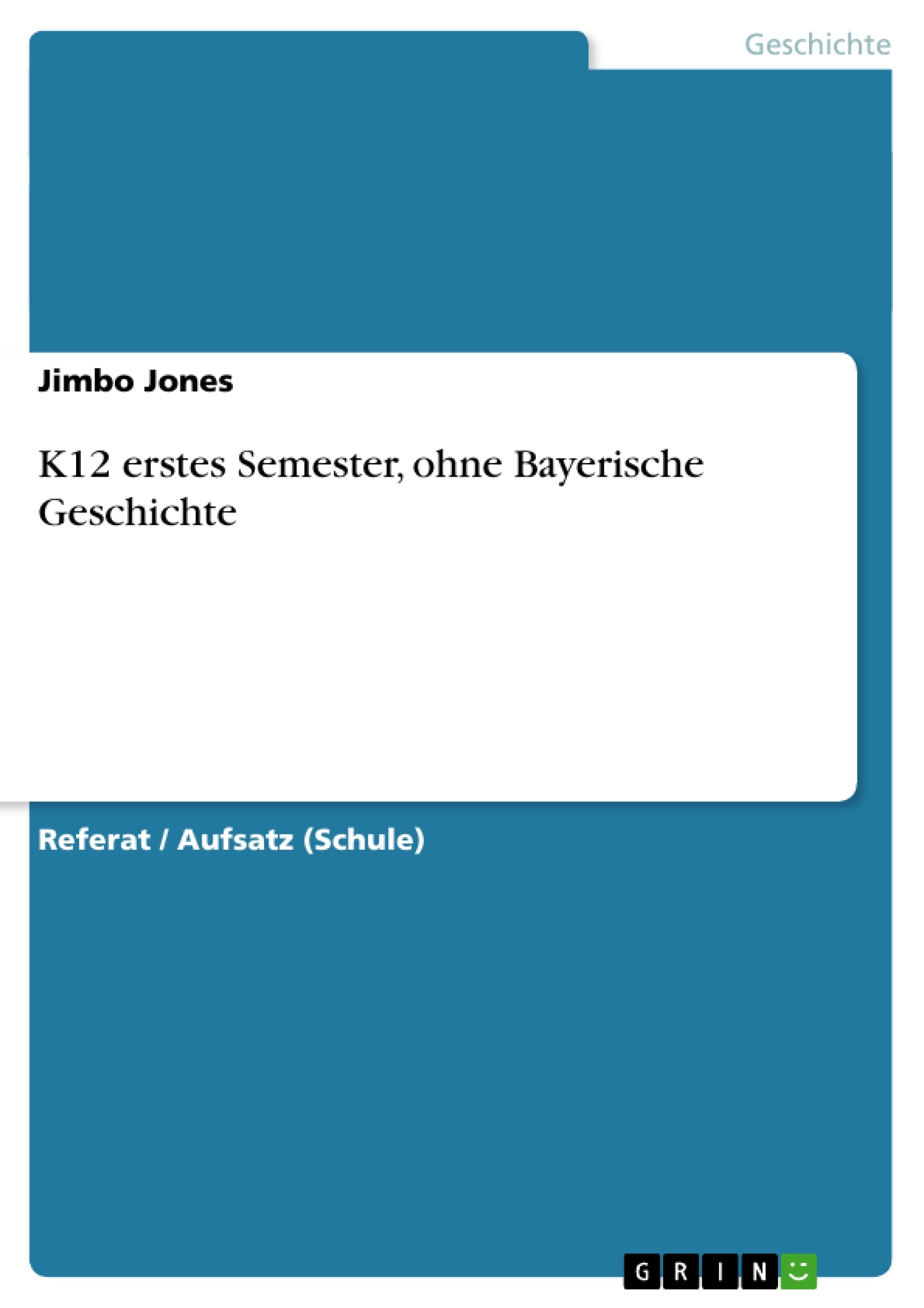M. Pinzhoffer '00
1. Das Jahrzehnt der Reaktion im deutschen Bund 1850-1860
- Fehlschlag der Revolutionen von '48, jedenfalls was den äußeren und unmittelbaren Erfolg betrifft
- Aber: die demokratische Bewegung (= mehr Bürgerrechte und -freiheiten) blieb lebendig.
- Der ,,Sieg" der restaurativen Kräfte führte ab '49 zu einer Repressionspolitik: Freiheits- und Rechtsgarantien wurden wieder abgebaut und Lierale und Demokraten strafrechtlich verfolgt => Flüchtlingswelle
- Eine ,,Fürstenunion" sollte unter Preußens Führung eine deutsche Einigung herbeiführen. Der Plan kam über die Ansätze nicht hinaus.
- Dresdner Konferenzen 50/51 legen die Schwerpunkte Restaurativer Politik im Dt. Bund:
- Monarchisches Prinzip (Gottesgnadentum)
- Abbau der demokratischen Elemente (Grundrechte, Presse- und Vereinigungsfreiheit)
- Preußen:
- 1850 ,,Oktroyierte Verfassung" => 1918 · Dreiklassenwahlrecht
- Monarchisches Prinzip (S. 47)
- Individualrechte zum Teil gesichert (Gleichheit, Religionsfreiheit)
- Obwohl die Verfassungspraxis den reaktionären Zielen des Textes folgte, lebten insbesondere in Vereinen und Medien die demokrat. Zielsetzungen fort und beeinflussten das politische Geschehen
-österreich:
- ,,Oktroyierte Verfassung", die aber wieder zurückgenommen wird => 1918 ohne Verfassung
- Staat: zentralistisch, von Kaiser, Adel,Militär (Polizei) und Bürokratie straff geführt und beherrscht (Autoritäres System)
- Wachsender Widerstand in den Teilen der Donaumonarchie, Forderung nach mehr Selbständigkeit und demokrat. Rechten. In Ungarn werden die Probleme durch eine Doppelmonarchie aufgefangen; die italienischen Gebiete Venetien und Lombardei gingen imösterreichisch- italienischen Krieg (1859) verloren.
- Wirtschaftliche Entwicklung
- günstiger Verlauf durch Industrialisierung, Verkehrserschließung, Beseitigung von Hemmnissen (Zölle) =>
- Wohlstand im Bürgertum => moderate Einstellung zur Politik, Streben nach alten Zielen, aber nicht in revolutionärer Absicht =>
- Kulturelle, v. a. literarische Blüte in der 2. Jahrhunderthälfte, starke Neigung zum Historismus
2. Innen- und Außenpolitik Bismarcks
- Ziele:
- Expansion und Hegemonie Preussens (Schwächungösterreichs) · Einigung Deutschlands (kleindeutsche Lösung)
- Wahrung bzw. Stärkung der alten Gesellschafts- und Staatsform
- Mittel:
- Kabinett- und Geheimpolitik · Krieg
- Verfassungskonflikt von 1862 als Beginn der politischen Laufbahn Bismarcks
- Ausgangspunkt: Absicht des Königs die traditionellen Kräfte zu stärken =>
- Verlängerung der Wehrpflicht, Stärkung der adligen Offiziercorps, Schwächung der bürgerlichen Teile der Armee =>
- Ablehnung durch den Landtag (liberale Mehrheit) => · Zuspitzung über das ,,Budgetrecht"
- Auflösung des Parlaments und Neuwahl => · Großer Sieg der Liberalen =>
- Verfassungs- /Staatskrise =>
- Berufung Bismarcks zum Kanzler Preußens
- Regierung ohne Landtag (,,Lückentheorie")
- Spaltung der Liberalen 1867: die neugegründete Nationalliberale Partei stützt Bismarck und sichert ihm für seine ganze Amtszeit die parlamentarischen Mehrheiten
- Die wirtschaftlichen Erfolge (Widerbelebung des Zollvereins) hindern Bürger und Politiker am offenen Widerstand
3. Der Weg in die Reichsgründung
- Deutsch - Dänischer Krieg
- Streit um Schleswig mit dem dänischen König => Einmarsch Dänemarks
-österreich geht mit Preußen gegen Dänemark vor => Niederlage Dänemarks
- Schleswig und Holstein kommen unter preußische bzw.österreichische Verwaltung => Konflikt
- Preußisch-österreichischer Krieg
- Bismarcks Ziel: Schleswig und Holstein zu Preußen
- Unterlaufung aller Versucheösterreichs zur gütlichen Einigung
- Bismarck schließt Bündnisse mit Frankreich, Italien und Russland => · Preußen erklärt das Ende des dt. Bundes =>
- Krieg gegenösterreich und die nichtpreußischen Staaten => · Niederlageösterreichs und Verbündete bei Königgrätz
- Friedensvereinbarung: keine Gebietsansprüche anösterreich, Anerkennung der Auflösung des Dt. Bundes und der preußischen Hegemonie
- Gründung des Norddeutschen Bundes
- Bismarck verschafft sich die Rückendeckung des Parlaments (Indemnität) =>
- Annexionen: Schleswig-Holstein, Hannover, Nassau, Frankfurt
- Bedeutung: ,,Revolution von Oben" (Pragmatismus Bismarcks)
- Gründung des Norddt. Bundes mit Festschreibung der Vormachtstellung Preußens (Bismarcks eigene Verfassung) 1867
- Organe des Bundes: Bundesrat(föderatives Element) und Reichstag(demokratisch einheitliches Element)
- Trutz- und Schutzbündnisse, sowie verstärkung der wirtschaftl. und polit.
Zusammenarbeit mit den ,,Süd-Staaten" =>Vorbereitung eines Zusammenschlusses
- Der deutsch-französische Krieg
- Verschlechterung der Beziehung durch wachsende Sorge und Misstrauen gegenüber der preußischen Expansion
- Eskalation der Spannungen durch die Spanische Thronfolge (Hohenzoller als Kandidat => Umklammerung Frankreichs) =>
- Rücknahme der Kandidatur
- Trotzdem: Forderung Frankreichs nach Verzicht für alle Zeiten => · Ablehnung durch den preußischen König =>
- ,,Emser Depesche" an Bismarck, die dieser in gekürzter Form an die Presse gibt => · Kriegserklärung Frankreichs =>
- Sieg Preußens und seiner verbündeten
- Freide vom 10. 05. 1871: Frankreich muss Elsaß-Lothringen abtreten und sehr hohe Kriegsentschädigung zahlen
4. Die Reichsgründung
- Baden und Hessen treten 1870 dem norddt. Bund bei =>
- Beitritt Bayerns und Würtembergs (Zwangslage Ludwig II) =>
- Deutscher Bund, umbenannt in Deutsches Reich und begründet in der
- Kaiserproklamation am 17. 01. 1871 in Versailles => April '71: Reichsverfassung
- Ihre Prinzipien:
- Achtung des föderalistischen Aufbaus z.B. durch ,,Reservatrechte" · Bundesstaatlichkeit => Bundesrat
- Vorrang Preußens (preuß. Ministerpräsident ist Reichskanzler; Vetorecht) · Starke Position des Reichskanzlers (ebenso wie Bundesrat und Kaiser ohne parlamentarische Kontrolle)
- Reichstag: Unitarisches, demokratisches Prinzip (gewählt in freier, gleicher, geheimer Wahl)
- Dt. Reich: Konstitutionelle Monarchie und
- finanziell stark von den Einzelstaaten abhängig
- Auch die Reichsgründung (vgl. dt. Bund) vollzog sich ohne Mitwirkung des Volkes, war ausschließlich Ergebnis monarchischen Handelns
5. Innenpolitik Bismarcks
a. Kulturkampf
- Ursachen:
- traditionell Spannungen zwischen Protestanten und Katholiken
- Misstrauen Bismarcks gegenüber Ultramontanismus und Internationalität, d. h. der Bindung der Katholiken an Rom bzw. die Verbindung zu allen anderen katholischen Staaten
- Auslöser:
- Zusammenarbeit der deutschen Katholiken bzw. des Zentrums (= kath. Partei) mit polnischen Katholiken (Internationalismus)
- 1870 Unfehlbarkeitsdogma => Sorge vor massivem ultramontanem Einfluss auf die dt. Politik
- Verlauf der Kulturkampfmaßnahmen
- Kanzelparagraph (verbot, sich von der Kanzel politisch zu äußern) · Alle Beurkundungen des Personenstands gehen auf den Staat über · Verhaftung und Vertreibung von Bischöfen und Geistlichen · Aufhebung von Kirchen und Klöstern bzw. finanzielle Sanktionen
- Beendigung des Kulturkampfes wegen seiner Erfolglosigkeit und wegen eines neuen anderen Gegners =>
b. Sozialistengesetze
- Ursachen
- Zunehmende Bedeutung der sozialistischen Grippen: Sozialisten, Kommunisten, ,,Sozialdemokratie" =>
- Furcht vor Internationalismus aufgrund der engen internationalen Zusammenarbeit dieser Gruppen
- Furcht vor Unruhen, Umsturz
- Anlass: 2 Attentate auf den Kaiser
- Vorgehen:
- Verbot von Vereinen, Versammlungen und Schriften der sozialistischen
Gruppierungen. Mehrheit im Parlament durch die Konservativen und Liberalen · Einschüchterung, Kontrolle, Verhaftung
- Ergebniss:
- Das Gesetzliche Vorgehen blieb letztlich ohne Auswirkungen (auch wegen der internationalen Solidarität)
Häufig gestellte Fragen
Was behandelt das Jahrzehnt der Reaktion im Deutschen Bund 1850-1860?
Dieser Abschnitt behandelt die Repressionspolitik nach dem Scheitern der Revolutionen von 1848, den Abbau von Freiheits- und Rechtsgarantien sowie die Verfolgung von Liberalen und Demokraten. Weiterhin wird die "Fürstenunion" unter preußischer Führung und die restaurativen Prinzipien der Dresdner Konferenzen (monarchisches Prinzip, Abbau demokratischer Elemente) behandelt. Die preußische "oktroyierte Verfassung" von 1850 und die österreichische Politik, einschließlich des wachsenden Widerstands in der Donaumonarchie, werden ebenfalls erläutert. Abschließend wird die wirtschaftliche Entwicklung durch Industrialisierung und die kulturelle Blüte mit Neigung zum Historismus thematisiert.
Welche Ziele verfolgte Bismarcks Innen- und Außenpolitik?
Bismarcks Ziele waren die Expansion und Hegemonie Preußens, die Einigung Deutschlands unter Ausschluss Österreichs ("kleindeutsche Lösung") und die Wahrung/Stärkung der alten Gesellschafts- und Staatsform. Seine Mittel dazu waren Kabinett- und Geheimpolitik sowie Kriege. Der Verfassungskonflikt von 1862, die Spaltung der Liberalen 1867 und die wirtschaftlichen Erfolge werden in diesem Abschnitt näher betrachtet.
Wie gestaltete sich der Weg in die Reichsgründung?
Dieser Teil beschreibt den Deutsch-Dänischen Krieg, den Preußisch-Österreichischen Krieg (inklusive Bismarcks Bündnisse und der Schlacht bei Königgrätz), die Gründung des Norddeutschen Bundes mit Festschreibung der Vormachtstellung Preußens und den Deutsch-Französischen Krieg, ausgelöst durch die Spanische Thronfolge und die "Emser Depesche". Die Niederlage Frankreichs und die Abtretung von Elsaß-Lothringen werden ebenfalls thematisiert.
Welche Prinzipien kennzeichneten die Reichsgründung?
Die Reichsgründung erfolgte durch den Beitritt von Baden, Hessen, Bayern und Württemberg zum Norddeutschen Bund, die Umbenennung in Deutsches Reich und die Kaiserproklamation in Versailles am 17. Januar 1871. Die Prinzipien der Reichsverfassung von April 1871 waren Achtung des föderalistischen Aufbaus, Vorrang Preußens, starke Position des Reichskanzlers und ein Reichstag, der nach unitarisch-demokratischen Prinzipien gewählt wurde. Die Reichsgründung vollzog sich ohne Mitwirkung des Volkes und war ausschließlich Ergebnis monarchischen Handelns.
Was waren die Ursachen und Auswirkungen des Kulturkampfes?
Die Ursachen des Kulturkampfes lagen in den Spannungen zwischen Protestanten und Katholiken, Bismarcks Misstrauen gegenüber Ultramontanismus und Internationalität sowie der Zusammenarbeit deutscher Katholiken mit polnischen Katholiken. Die Maßnahmen umfassten den Kanzelparagraphen, die Übertragung der Beurkundungen des Personenstands auf den Staat, Verhaftung und Vertreibung von Bischöfen und Geistlichen sowie die Aufhebung von Kirchen und Klöstern. Der Kulturkampf wurde aufgrund seiner Erfolglosigkeit beendet.
Welche Ursachen und Folgen hatten die Sozialistengesetze?
Die Ursachen der Sozialistengesetze waren die zunehmende Bedeutung sozialistischer Gruppen, Furcht vor Internationalismus und Unruhen. Anlass waren zwei Attentate auf den Kaiser. Das Vorgehen umfasste das Verbot von Vereinen, Versammlungen und Schriften der sozialistischen Gruppierungen. Die gesetzliche Verfolgung blieb letztlich ohne Auswirkungen. Bismarcks Absicht, die sozialistischen Gruppen zu unterlaufen, führte zu seiner Sozialgesetzgebung (Kranken-, Unfall-, Invaliditäts- und Altersversorgungsgesetz).
- Quote paper
- Jimbo Jones (Author), 2000, K12 erstes Semester, ohne Bayerische Geschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99273