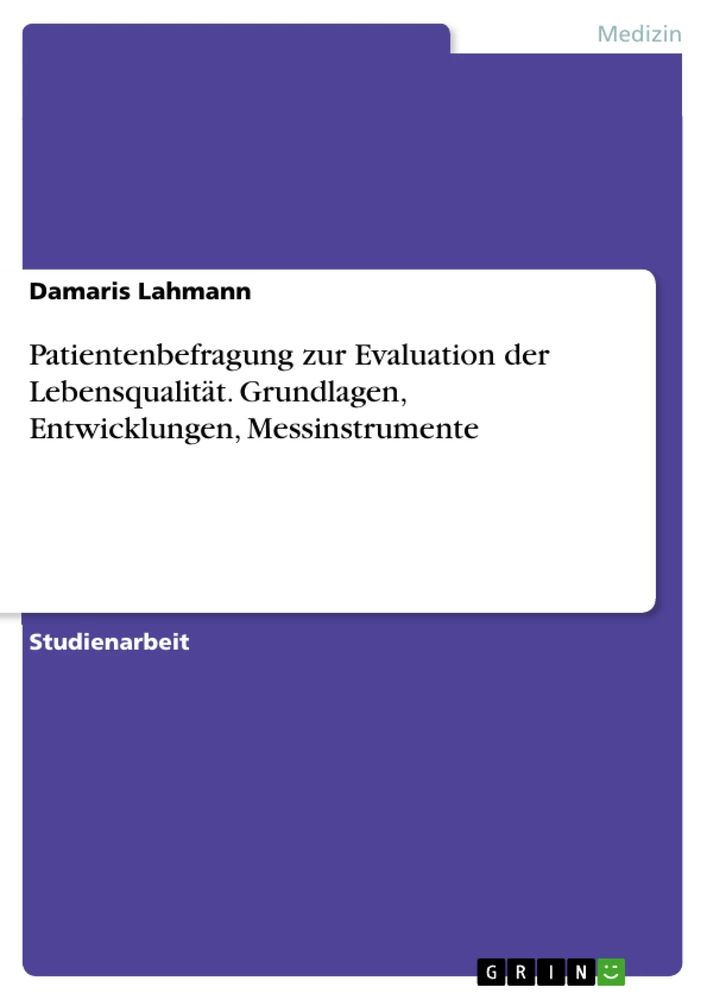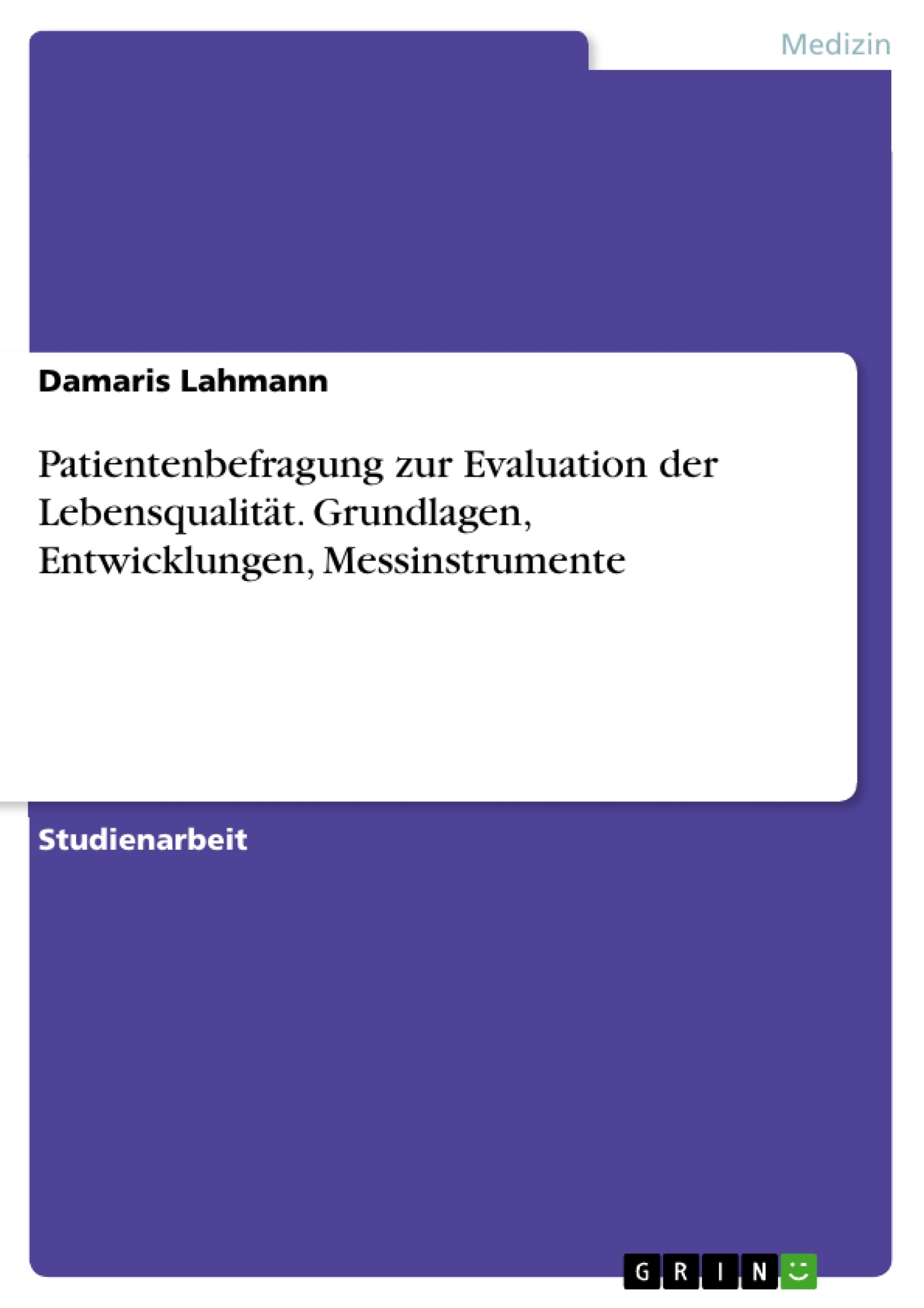Diese schriftliche Ausarbeitung legt dar, welche Inhalte zur Patientenbefragung gehören, was mit Lebensqualität im Zusammenhang mit Patientenbefragung gemeint ist und wie Patientenbefragung stattfinden kann. Dafür werden die geschichtlichen Hintergründe, Messinstrumente, klassische Fragestellungen und patientenberichtete Endpunkte näher erläutert.
Geht es bei Entscheidungen über Therapien und Behandlungen um Szenarien, die für eine ganze Gruppe von Patienten gelten sollen, ist es wichtig, dass die zugrunde liegende Behandlungsleitlinie einen gewissen Verbindlichkeitsgrad besitzt. Um diese Verbindlichkeit zu messen und daraus Empfehlungen ableiten zu können, werden in Deutschland Patienten direkt befragt. Eine Patientenbefragung fußt auf einer rechtlichen Verbindlichkeit und stellt eine Abbildung von Qualitäten da, zu der die Krankenkassen gesetzlich verpflichtet sind. 2010 berichtet Kohlmann darüber, dass für diesen Verbindlichkeitsgrad immer öfter patientenberichtete Endpunkte berücksichtigt werden, die im Rahmen von klinischen Studien als komplexes Konstrukt der gemessenen "Lebensqualität" erhoben wurden. Im weiteren Verlauf wird der Begriff gesundheitsbezogene Lebensqualität mit gLQ abgekürzt, beziehungsweise Lebensqualität als LQ.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Patientenbefragung
- Entwicklung und Grundlage
- Was sind Messinstrumente der Patientenbefragung?
- Was sind klassische Fragestellungen in der Patientenbefragung? Wie lauten die Endpunkte?
- Ziele der Patientenbefragung
- Probleme bei der Patientenbefragung?
- Diskussion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, einen umfassenden Einblick in die Patientenbefragung zu geben. Sie beleuchtet die historische Entwicklung und Grundlage der Patientenbefragung sowie die relevanten Messinstrumente und Fragestellungen. Darüber hinaus werden die zentralen Ziele der Patientenbefragung im Kontext der Gesundheitsversorgung erörtert.
- Die Entwicklung und Grundlage der Patientenbefragung im historischen Kontext
- Die Bedeutung der patientenberichten Endpunkte in der Bewertung von Therapien und Behandlungen
- Die verschiedenen Messinstrumente der Patientenbefragung und deren Eignung für unterschiedliche Fragestellungen
- Die klassischen Fragestellungen und Endpunkte in der Patientenbefragung
- Die Ziele der Patientenbefragung im Kontext der Qualitätssicherung in der Gesundheitsversorgung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von patientenorientierten Entscheidungen im Gesundheitswesen und die wachsende Relevanz der Patientenbefragung. Es wird die rechtliche Verbindlichkeit der Patientenbefragung in Deutschland erläutert sowie die Bedeutung patientenberichter Endpunkte im Kontext der Lebensqualität hervorgehoben.
Patientenbefragung
Entwicklung und Grundlage
Dieser Abschnitt untersucht die historische Entwicklung des Konzepts der Lebensqualität und die Bedeutung der Patientenperspektive in der Gesundheitsversorgung. Es wird die Entstehung des Begriffs "Lebensqualität" im 17./18. Jahrhundert und seine Relevanz im medizinischen Kontext der 1970er Jahre erläutert. Die Entwicklung der Patientenbefragung als integraler Bestandteil der Qualitätssicherung in der Gesundheitsversorgung wird ebenfalls beleuchtet.
Was sind Messinstrumente der Patientenbefragung?
Dieser Abschnitt befasst sich mit den verschiedenen Instrumenten zur Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (gLQ). Er beleuchtet die Vielfalt an verfügbaren Instrumenten, die Bandbreite der Messungen und die kritische Betrachtung der Validität und Anwendbarkeit dieser Instrumente. Der Abschnitt behandelt zudem die Unterscheidung zwischen generischen und krankheits- oder populationsspezifischen Instrumenten.
Häufig gestellte Fragen
Was sind patientenberichtete Endpunkte (PRO)?
Das sind Ergebnisse medizinischer Behandlungen, die direkt vom Patienten ohne Interpretation durch Dritte gemeldet werden, oft im Zusammenhang mit der Lebensqualität.
Warum sind Patientenbefragungen in Deutschland gesetzlich relevant?
Krankenkassen sind gesetzlich verpflichtet, die Qualität der Versorgung abzubilden. Patientenbefragungen dienen als Instrument zur Messung dieser Verbindlichkeit und Qualität.
Was ist der Unterschied zwischen generischen und krankheitsspezifischen Messinstrumenten?
Generische Instrumente messen die Lebensqualität allgemein über verschiedene Gruppen hinweg, während krankheitsspezifische Tools auf die Symptome einer bestimmten Erkrankung fokussieren.
Seit wann spielt der Begriff "Lebensqualität" in der Medizin eine Rolle?
Obwohl die Wurzeln im 17./18. Jahrhundert liegen, gewann der Begriff vor allem in den 1970er Jahren als integraler Bestandteil der medizinischen Bewertung an Bedeutung.
Welche Ziele verfolgt die Evaluation der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (gLQ)?
Ziele sind die Verbesserung der Patientenorientierung, die Qualitätssicherung in der Versorgung und die fundierte Ableitung von Behandlungsleitlinien.
- Quote paper
- Damaris Lahmann (Author), 2020, Patientenbefragung zur Evaluation der Lebensqualität. Grundlagen, Entwicklungen, Messinstrumente, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/992986