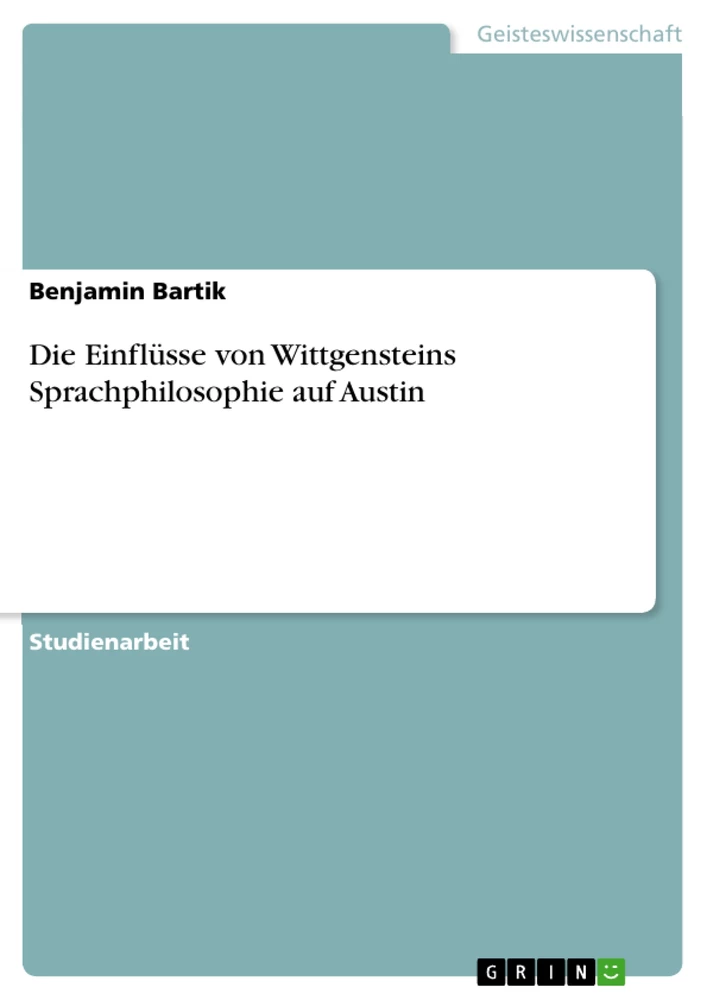Beide, Wittgenstein und Austin, beschäftigen sich mit der Performativität von Sprache. Ausgehend von Wittgensteins Konzept der Sprachspiele und seinen Überlegungen in Brown Book und Blue Book wird der Einfluss seiner Ideen auf Austin untersucht. Dabei wird festgestellt, dass wesentliche Gemeinsamkeiten der beiden Philosophen bestehen und Austins Konzeptionen durchaus als Weiterentwicklung Wittgensteins gesehen werden können, auf jeden Fall wird aber festgestellt, dass Wittgenstein der Begründer einer Sprachphilosophischen Richtung ist, die Austin weiterentwickelt hat und der seine Theorien zuzurechnen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Sprachphilosophischen Konzepte von Wittgenstein und Austin
- Wittgensteins Konzept von Sprache in den Philosophischen Untersuchungen
- Sprachspiele
- Bedeutung
- Austins Konzept von Sprache
- Bedeutung eines Wortes
- Sprechakttheorie
- Wittgensteins Konzept von Sprache in den Philosophischen Untersuchungen
- Einflüsse Wittgensteins auf Austin
- Bedeutung als Art der Verwendung
- Gegen die traditionelle Auffassung
- Die Konzeption der Bedeutung
- Die ,,Art der Verwendung"
- Wittgensteins Sprachphilosophie und Austins Sprechakttheorie
- Sprechhandlungen
- Kontextabhängigkeit bei Wittgenstein und Austin
- Die Rolle der Sprecherinnenautorität
- Bedeutung als Art der Verwendung
- Wie konkret ist der Einfluss?
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Sprachphilosophie von Ludwig Wittgenstein auf die Sprechakttheorie von John Langshaw Austin. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die grundlegenden Ansichten beider Philosophen zu vergleichen und aufzuzeigen, dass Austins Theorie auf Wittgensteins Ideen aufbaut. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Gemeinsamkeiten der beiden Theorien, insbesondere auf die Konzeption der Bedeutung als Art der Verwendung und auf die Beziehung zwischen Wittgensteins Sprachspielen und Austins Sprechakttheorie. Die Arbeit beleuchtet auch die Rolle des Kontexts und der Sprecherinnenautorität in beiden Theorien.
- Wittgensteins Sprachphilosophie in den Philosophischen Untersuchungen
- Austins Sprechakttheorie
- Die Rolle der Bedeutung in der Sprachphilosophie
- Der Einfluss des Kontexts auf sprachliche Bedeutung
- Die Rolle der Sprecherinnenautorität in der Sprachphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die beiden Philosophen Wittgenstein und Austin vor und skizziert den Fokus der Arbeit auf die Untersuchung der Einflüsse Wittgensteins auf Austins Theorie. Kapitel 2 behandelt die wesentlichen Aspekte der Sprachphilosophie von Wittgenstein und Austin. Es beleuchtet Wittgensteins Konzept von Sprache als System aus Sprachspielen und Austins Konzept von Sprache als Mittel zur Ausführung von Sprechhandlungen. Kapitel 3 untersucht die konkreten Einflüsse Wittgensteins auf Austin. Es analysiert die gemeinsame Vorstellung, dass die Bedeutung eines Wortes aus seiner Art der Verwendung abgeleitet wird, und stellt die Beziehungen zwischen Wittgensteins Sprachspielen und Austins Sprechakttheorie heraus.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Sprachphilosophie, insbesondere mit Wittgensteins Sprachspieltheorie, Austins Sprechakttheorie, der Bedeutung von Wörtern, dem Einfluss des Kontexts auf sprachliche Bedeutung und der Rolle der Sprecherinnenautorität. Die Arbeit befasst sich mit grundlegenden Konzepten der Philosophie der Sprache und analysiert die Beziehung zwischen den Werken von Wittgenstein und Austin.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste Wittgenstein die Sprechakttheorie von Austin?
Austins Theorie baut auf Wittgensteins Konzept der Sprachspiele und der Idee auf, dass Sprache eine Form des Handelns ist. Wittgensteins Fokus auf die Performativität legte den Grundstein für Austins Sprechakte.
Was versteht Wittgenstein unter „Sprachspielen“?
Sprachspiele bezeichnen die Einheit aus Sprache und den Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist. Die Bedeutung eines Wortes ergibt sich erst aus seinem Gebrauch innerhalb eines solchen Spiels.
Warum ist der Kontext für die Bedeutung entscheidend?
Sowohl Wittgenstein als auch Austin argumentieren, dass Wörter keine feste, abstrakte Bedeutung haben, sondern ihre Bedeutung erst durch die spezifische Situation und die Absicht des Sprechers erhalten.
Was bedeutet „Bedeutung als Art der Verwendung“?
Dies ist eine Abkehr von der traditionellen Auffassung, dass Wörter Namen für Gegenstände sind. Stattdessen wird Bedeutung als die Rolle verstanden, die ein Wort in der sozialen Interaktion spielt.
Welche Rolle spielt die Sprecherinnenautorität?
Die Arbeit untersucht, inwieweit der Status und die Autorität der sprechenden Person darüber entscheiden, ob eine Sprechhandlung (z.B. ein Versprechen oder ein Befehl) gelingt oder nicht.
Kann man Austin als Nachfolger Wittgensteins sehen?
Ja, die Arbeit stellt fest, dass Austin Wittgensteins Ideen systematisiert und zu einer eigenständigen sprachphilosophischen Richtung weiterentwickelt hat.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Bartik (Autor:in), 2020, Die Einflüsse von Wittgensteins Sprachphilosophie auf Austin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/993516