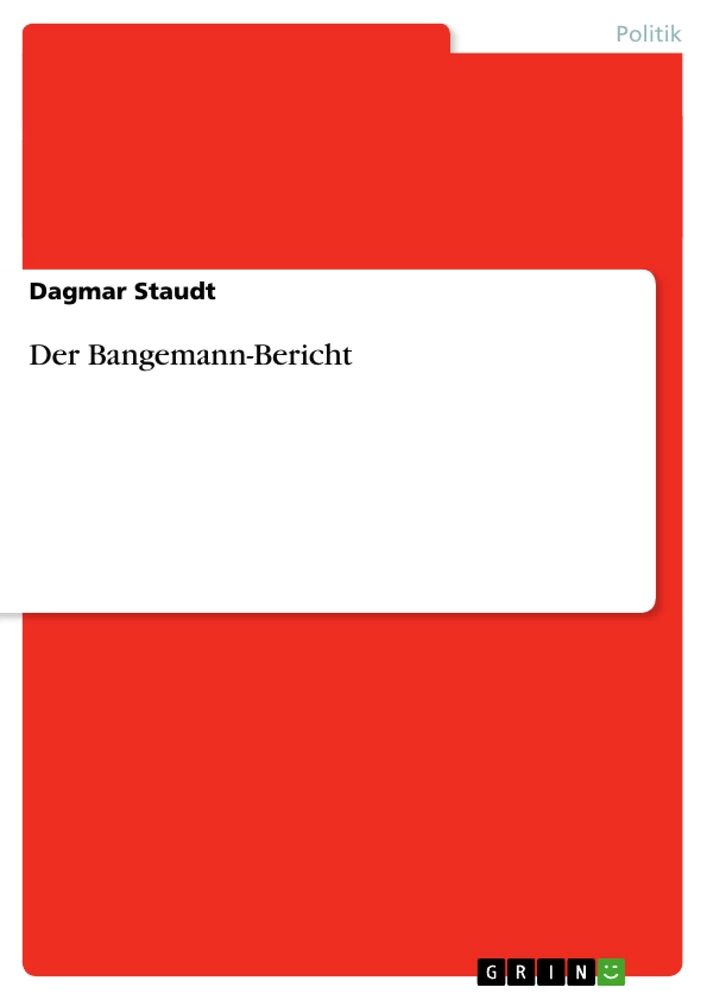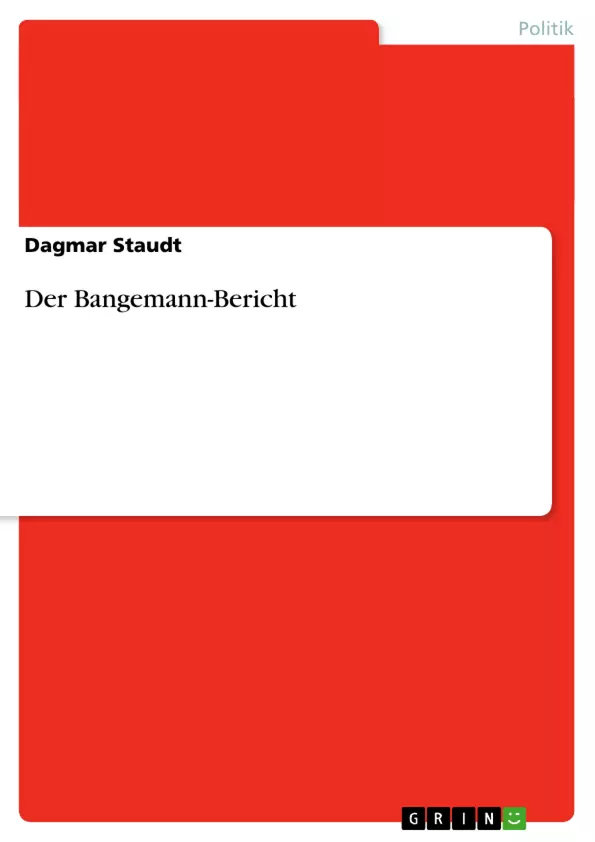Der Bangemann-Bericht
Der "Bangemann-Bericht" - Empfehlungen für den Europäischen Rat Die Europäische Union hat die Informationsgesellschaft in ihrem Weißbuch zu Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung als Kernstück des Entwicklungsmodells für das 21. Jahrhundert bezeichnet. Im diesem Weißbuch wurde auch die Einrichtung einer Task Force "Europäische Informationsstruktur" vorgeschlagen, die unter der Leitung von EU-Kommissar Dr. Martin Bangemann zusammentrat um für die Tagung des Europäischen Rates im Juni 1994 einen Bericht über konkrete Maßnahmen anzufertigen, die von der Gemeinschaft und den Mitgliedsstaaten in bezug auf die Informationsstrukturen in Betracht zu ziehen sind (sog. Bangemann-Bericht).
Dieser Bericht plädiert dafür, daß die Europäische Union auf ihrem Weg ins Informationszeitalter auf die Marktmechanismen als treibende Kraft vertraut.
Dazu müssen auf europäischer Ebene und von den Mitgliedstaaten Maßnahmen getroffen werden, damit verschanzte Positionen, die nur zu Wettbewerbsnachteilen führen, abgebaut werden. Das bedeutet,
- daß eine unternehmerische Mentalität gefördert werden muß, die das Entstehen neuer dynamischer Wirtschaftszweige ermöglicht,
- daß ein gemeinsame ordnungspolitisches Konzept für die Schaffung eines europaweiten wettbewerbsstarken Marktes für Informationsdienste entwickelt werden muß,
- daß in Zukunft nicht mehr öffentliche Gelder und finanzielle Unterstützung gewährt werden müssen, und daß Subventionen, Dirigismus oder Protektionismus keine Förderung erfahren.
Neben speziellen Empfehlungen schlägt die Gruppe einen Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen vor, bei denen privater und öffentlicher Sektor partnerschaftlich zusammenarbeiten, um Europa in die Informationsgesellschaft zu führen:
Aktionsplan - Zusammenfassung der Empfehlungen
Ordnungspolitischer Rahmen
Anpassung des ordnungspolitischen Rahmens
Die Mitgliedstaaten sollten die bereits begonnene Liberalisierung des Telekommunikationssektors beschleunigen, und zwar durch
- Öffnung für den Wettbewerb von Infrastrukturen und Diensten, für den noch ein Monopol besteht
- Befreiung der Telekommunikationsunternehmen von nichtkommerziellen politischen Auflagen und Finanzbelastungen
- Festlegung klarer Zeitpläne und Fristen für die Durchführung praktischer Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele.
Es sollte eine Autorität auf europäischer Ebene eingerichtet werden, über deren Aufgaben unverzüglich bestimmt werden sollte.
Netzverbund und Interoperabilität
Der Verbund von Netzen und die Interoperabilität von Diensten und Anwendungen sind als vorrangige Ziele der Europäischen Union anzusehen.
Die europäischen Normungsverfahren sollten überprüft werden, um diese zu beschleunigen und besser auf Marktanforderungen reagieren zu können.
Gebühren
Die Gebühren für internationale, Fern- und Mietleitungen sollten dringend auf das in anderen hochentwickelten Industrieregionen übliche Niveau gesenkt werden.
Die Anpassung der Gebühren sollte einhergehen mit einer gerechten Verteilung von öffentlichen Aufgaben auf die Betreiber.
Anregung der kritischen Nachfragemasse
Die Aufklärung der Öffentlichkeit ist zu fördern. Dabei sollten vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen, die öffentlichen Verwaltungen und die jüngere Generation angesprochen werden.
Gewährleistung der globalen Dimension
Im Gegensatz zur Öffnung des europäischen Marktes sollten die Märkte und Netze anderer Regionen in der Welt geöffnet werden. Für Europa ist es von vordringlicher Bedeutung, daß die notwendigen Schritte unternommen werden, damit auch anderswo gleiche Zugangsmöglichkeiten gewährleistet sind.
Was noch zu tun bleibt
Die Informationsgesellschaft ist eine globale Gesellschaft.
Aktionen der Union sollten dem Ziel dienen, innerhalb und, wo erforderlich, außerhalb Europas einen gemeinsamen Rechtsrahmen für den Schutz der geistigen Eigentumsrechte, der Privatsphäre und der Sicherheit von Informationen zu schaffen.
Schutz des geistigen Eigentums
Der Schutz der geistigen Eigentumsrechte muß den neuen Herausforderungen von Globalisierung und Multimedia gerecht werden und auf europäischer und internationaler Ebene weiterhin hohe Priorität genießen.
Schutz der Privatsphäre
Ohne die rechtliche Sicherheit eines unionsweiten Ansatzes wird der Vertrauensmangel auf seiten des Verbrauchers einer raschen Entwicklung der Informationsgesellschaft im Wege stehen. Da es sich beim Schutz der Privatsphäre um einen sehr wichtigen und sensiblen Bereich handelt, ist eine rasche Verabschiedung des Richtlinienvorschlags der Kommission über allgemeine Prinzipien des Datenschutzes durch die Mitgliedstaaten erforderlich.
Elektronischer Schutz, rechtlicher Schutz und Informationssicherheit Die auf europäischer Eben durchgeführten Arbeiten über den elektronischen und rechtlichen Schutz sowie über die Informationssicherheit sollten beschleunigt werden.
Eigentum an Medien
Die Frage, wie verhindert werden kann, daß unterschiedliche nationale Rechtsvorschriften über das Eigentum an Medien den Binnenmarkt unterminieren, muß dringend untersucht werden. Gefragt sind hier wirksame Bestimmungen zum Schutz von Pluralismus und Wettbewerb.
Wettbewerbspolitik
Die Wettbewerbspolitik ist ein Schlüsselelement in der Strategie der Union. Die Anwendung der Wettbewerbsregeln sollte die neu entstehenden globalen Märkte und die raschen Veränderungen des Umfelds reflektieren.
Bausteine der Informationsgesellschaft
Netze
Vorrangig muß die Verfügbarkeit des EURO-ISDN in Übereinstimmung mit aktuellen Kommissionsvorschlägen erhöht und Tarifsenkungen vorgenommen werden, um den Markt zu beleben. Der Rat sollte die Schaffung einer europäischen Breitband-Infrastruktur unterstützen und die Verbundfähigkeit mit allen europäischen Telekommunikations-, Kabelfernseh- und Satellitennetzen sicherstellen.
Ein europäischer Ausschuß für Breitband-Infrastruktur sollte eingesetzt werden, in dem alle relevanten Beteiligten vertreten sind. Die Aufgabe des Ausschusses sollte in der Entwicklung eines umfassenden Konzepts sowie der Verfolgung und Förderung seiner Umsetzung bestehen, insbesondere durch Pilotanwendungen sowie die Auswahl und Festlegung von Normen.
In den Bereichen Mobil- und Satellitenkommunikation wird folgendes empfohlen:
- eine Senkung der Mobilkommunikationstarife,
- die Förderung des GSM sowohl in Europa als auch auf internationaler Ebene,
- die Schaffung eines ordnungspolitischen Rahmens für die Satellitenhersteller, vorrangige Projekte gemeinsam zu erarbeiten und sich aktiv an der Entwicklung weltweiter Systeme zu beteiligen
Grunddienste
Durch kurzfristige und einheitliche Maßnahmen auf europäischer Ebene und in den Mitgliedstaaten sollte das Angebot und die breite Nutzung von standardisierten transeuropäischen Grunddiensten, z.B. elektronische Post, Dateitransfer, Videodienste, gefördert werden.
Die Kommission sollte ein "Europäisches Grunddienste-Forum" bilden, damit die Erstellung einheitlicher Normen für diese Grunddienste beschleunigt wird.
Anwendungen
Initiativen im Bereich der Anwendungen sind am besten dazu geeignet, zögerliche Entwicklungen von Nachfrage und Angebot zu beschleunigen. Anwendungen haben eine Demonstrationsfunktion. Diese hat positive Auswirkungen auf deren Nutzung. Die Gruppe schlägt folgende Initiativen vor:
- Telearbeit
- Fernlernen
- Ein Netzwerk für Hochschulen und Forschungszentren
- Telematikdienste für KMU
- Straßenverkehrsmanagement
- Flugsicherung
- Netze für das Gesundheitswesen
- Elektronische Ausschreibungen
- Transeuropäisches Netz öffentlicher Verwaltungen
- Informationsschnellstraßen für Städte
Finanzierung
Die Schaffung der Informationsgesellschaft in Europa sollte dem Privatsektor und den Marktkräften überlassen werden.
Die vorhandenen öffentlichen Mittel sind neu zu konzentrieren, um den spezifischen Anforderungen der Informationsgesellschaft stärker Rechnung zu tragen. Auf Ebene der Union müssen gegebenenfalls einige Umorientierungen bei der Vergabe der Mittel des Vierten Rahmenprogramms für Forschung und technologische Entwicklung sowie der Strukturfonds stattfinden.
Folgemaßnahmen
Angesichts des Umfangs und der Dringlichkeit der von uns liegenden Aufgaben sollte auf der Ebene der Europäischen Union ein Rat alle Fragen im Zusammenhang mit der Informationsgesellschaft behandeln. Vor diesem Hintergrund könnten die Mitgliedstaaten wünschen, einen einzigen Minister zu benennen, der sie auf dem der Informationsgesellschaft gewidmeten Rat vertritt. Die Kommission sollte entsprechend verfahren.
Häufig gestellte Fragen zum Bangemann-Bericht
Was ist der Bangemann-Bericht?
Der "Bangemann-Bericht" ist ein Bericht, der im Auftrag des Europäischen Rates von einer Task Force unter der Leitung von EU-Kommissar Dr. Martin Bangemann erstellt wurde. Er enthält Empfehlungen für die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten bezüglich der Informationsstrukturen und des Übergangs zur Informationsgesellschaft.
Was sind die Hauptaussagen des Berichts?
Der Bericht plädiert dafür, dass die Europäische Union bei der Entwicklung der Informationsgesellschaft auf Marktmechanismen als treibende Kraft setzt. Er fordert den Abbau von Wettbewerbsbeschränkungen, die Förderung unternehmerischen Denkens und die Schaffung eines europaweiten wettbewerbsfähigen Marktes für Informationsdienste. Der Bericht spricht sich gegen öffentliche Gelder und Subventionen aus.
Welche Maßnahmen empfiehlt der Bericht zur Liberalisierung des Telekommunikationssektors?
Der Bericht empfiehlt die Öffnung von Infrastrukturen und Diensten für den Wettbewerb, die Befreiung von Telekommunikationsunternehmen von nichtkommerziellen politischen Auflagen und Finanzbelastungen sowie die Festlegung klarer Zeitpläne für die Umsetzung dieser Maßnahmen.
Welche Rolle spielt der Netzverbund und die Interoperabilität?
Der Bericht betont, dass der Verbund von Netzen und die Interoperabilität von Diensten und Anwendungen vorrangige Ziele der Europäischen Union sein müssen. Europäische Normungsverfahren sollen beschleunigt und besser auf Marktanforderungen abgestimmt werden.
Wie sollen Gebühren angepasst werden?
Der Bericht fordert die Senkung der Gebühren für internationale, Fern- und Mietleitungen auf das in anderen hochentwickelten Industrieregionen übliche Niveau. Die Anpassung der Gebühren soll mit einer gerechten Verteilung von öffentlichen Aufgaben auf die Betreiber einhergehen.
Was wird zur Anregung der kritischen Nachfragemasse vorgeschlagen?
Der Bericht empfiehlt die Förderung der Aufklärung der Öffentlichkeit, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), öffentlichen Verwaltungen und der jüngeren Generation.
Welche globalen Dimensionen werden berücksichtigt?
Der Bericht fordert, dass im Gegenzug zur Öffnung des europäischen Marktes auch die Märkte und Netze anderer Regionen der Welt geöffnet werden. Europa soll sicherstellen, dass auch anderswo gleiche Zugangsmöglichkeiten gewährleistet sind.
Wie wird der Schutz des geistigen Eigentums behandelt?
Der Schutz der geistigen Eigentumsrechte muss den neuen Herausforderungen von Globalisierung und Multimedia gerecht werden und auf europäischer und internationaler Ebene hohe Priorität genießen.
Welche Rolle spielt der Schutz der Privatsphäre?
Der Bericht betont, dass ein unionsweiter Ansatz zum Schutz der Privatsphäre notwendig ist, um Vertrauen bei den Verbrauchern zu schaffen und die Entwicklung der Informationsgesellschaft nicht zu behindern. Die rasche Verabschiedung des Richtlinienvorschlags der Kommission über allgemeine Prinzipien des Datenschutzes wird gefordert.
Welche Maßnahmen werden im Bereich Netze empfohlen?
Der Bericht empfiehlt die Erhöhung der Verfügbarkeit von EURO-ISDN, Tarifsenkungen zur Belebung des Marktes und die Unterstützung der Schaffung einer europäischen Breitband-Infrastruktur. Ein europäischer Ausschuß für Breitband-Infrastruktur soll eingesetzt werden.
Welche Grunddienste sollen gefördert werden?
Der Bericht fordert die Förderung des Angebots und der breiten Nutzung von standardisierten transeuropäischen Grunddiensten wie elektronische Post, Dateitransfer und Videodienste. Ein "Europäisches Grunddienste-Forum" soll die Erstellung einheitlicher Normen beschleunigen.
Welche Anwendungen werden als besonders wichtig erachtet?
Der Bericht nennt folgende Anwendungen: Telearbeit, Fernlernen, ein Netzwerk für Hochschulen und Forschungszentren, Telematikdienste für KMU, Straßenverkehrsmanagement, Flugsicherung, Netze für das Gesundheitswesen, elektronische Ausschreibungen, ein transeuropäisches Netz öffentlicher Verwaltungen und Informationsschnellstraßen für Städte.
Wie soll die Finanzierung erfolgen?
Die Schaffung der Informationsgesellschaft soll primär dem Privatsektor und den Marktkräften überlassen werden. Vorhandene öffentliche Mittel sollen neu konzentriert werden, um den spezifischen Anforderungen der Informationsgesellschaft stärker Rechnung zu tragen.
Welche Folgemaßnahmen werden vorgeschlagen?
Der Bericht empfiehlt, dass auf Ebene der Europäischen Union ein Rat alle Fragen im Zusammenhang mit der Informationsgesellschaft behandelt. Ein Ausschuß mit Persönlichkeiten aus allen betroffenen Bereichen, einschließlich der Sozialpartner, soll eingesetzt werden, um an den Rahmenbedingungen für die Errichtung der Informationsgesellschaft zu arbeiten und die Aufklärung der Öffentlichkeit zu betreiben.
- Citar trabajo
- Dagmar Staudt (Autor), 2000, Der Bangemann-Bericht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99360