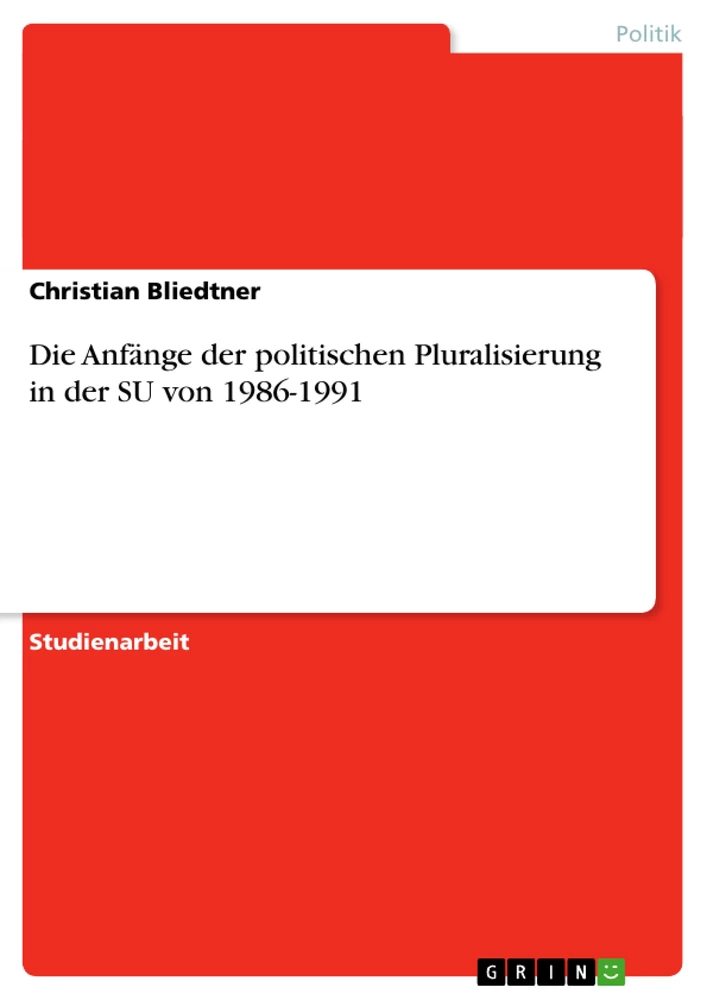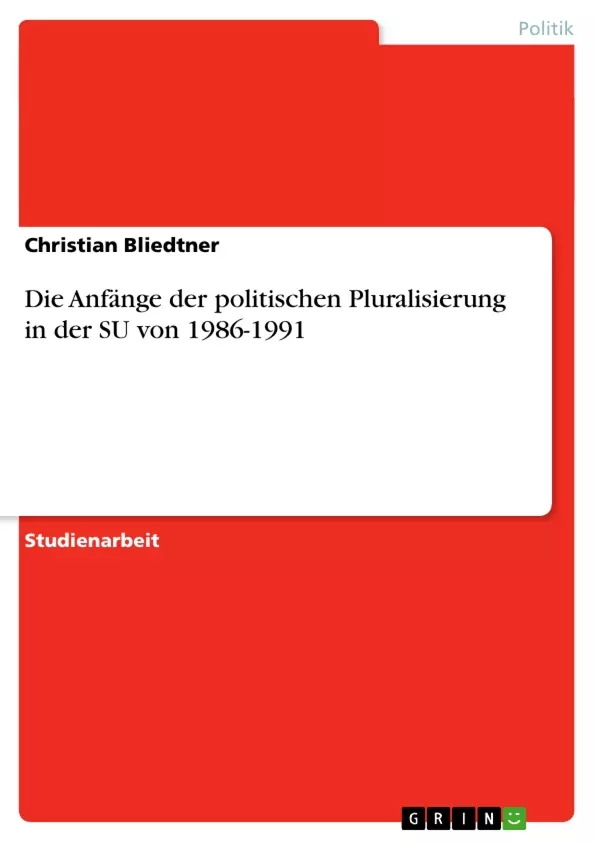Inhaltsverzeichnis
I. Parteien als ein entscheidender Akteur im Transformationsprozeß
II. Gorbatschows Reformen, welche den Wandel einleiteten
1. Glasnost
2. Perestrojka
3. Uskorenie
4. Demokratizacija
III. Die einzelnen Phasen der Perestrojka-Periode und die Genese neuer (Proto-) Parteien
1. Breshnew-Ära
2. Klubphase
3. Phase der Massenaktionen
4. Phase der Entstehung und Legalisierung von Parteien
IV. Starker Faktionalismus innerhalb der KPdSU
V. Cleavages
VI. Parteienentwicklung
1. Fazit
2.Ursachen für die Schwäche der russischen Parteien
Anhang: Literaturverzeichnis
I. Parteien als ein entscheidender Akteur im Transformationsprozeß
Diese Arbeit stellt den Versuch dar, einen groben Gesamtüberblick über die Anfänge der politischen Pluralisierung vor allem und nur der Parteien am Ende der Sowjetunion aufzuzeigen. Das es neben den Parteien auch noch andere gesellschaftliche Gruppen wie z.B. die Gewerkschaften gab, dessen Aufgaben und Wirken während der Amtszeit Gorbatschows ebenfalls sehr spannend zu untersuchen wäre, so konzentriert sich dieses Arbeit auf einen sehr speziellen Akteur im Transformationsprozeß, und zwar auf die Parteien und deren Genese. Der Leser möge bitte entschuldigen, aber auf Grund des Rahmens dieses Werkes ist es notwendig, das Augenmerk im wesentlichen auf Rußland zu lenken. Das Parteien ein ganz entscheidender Akteur zum Gelingen des Wandels von einem, wie im Falle Rußlands, kommunistischen Einparteiensystems zu einer Demokratie westlichen Sinne mit einem Mehrparteiensystems sind, ist aus der Politikwissenschaft bekannt. Erst wenn sich ein stabiles Mehrparteiensystem mit höchstens einer kleinen Zahl von Antisystemparteien herausgebildet hat, kann man von einem Abschluß der Demokratisierungsphase sprechen. Wer allerdings heutzutage nach Rußland blickt, muß zu der nüchternen Erkenntnis gelangen, daß dieses große Land noch ein Stück weit davon entfernt ist. Um dies zu verstehen, muß man sich die Geschichte der Parteienentwicklung ab ca. 1986 vergegenwärtigen. Deswegen möchte ich nun zuerst die Leistung und das Wirken Gorbatschows veranschaulichen, der mehr oder weniger bewußt das Klima für die Parteiengenese schuf und dieses in einzelne Phasen aufteilen und näher erläutern. Anschließend soll versucht werden die Konfliktlinien, an denen sich meist Parteien formieren, zu analysieren, um zum daraufhin ein Resümee der Parteiengenese zu ziehen. Letztlich sollen die folgenden Fragen geklärt werden, ob die neuentstanden Parteien eine tragende Rolle spielten, aus welchem Personenkreis diese sich rekrutierten und was sich innerhalb der KPdSU bis zu ihrem Verbot veränderte.
II) Gorbatschows Reformen, welche den Wandel einleiteten :
1) Mit der Wahl Gorbatschows zum Generalsekretär, gelang es selbst für sowjetische Verhältnisse einem recht jungen Mann der Weg an die Spitze der Partei. Dieser erkannte die ökonomischen und politischen Probleme in seinem Land und versucht diese im Rahmen des Sozialismus, den er immer für die bessere Alternative gegenüber des Kapitalismus hielt, zu beheben. Dies erkennen wir an den Leitvorstellungen, welche sich unter seiner Politik subsumiert haben. Glasnost dürfte das wohl bekannteste Schlagwort sein, welches in erster Linie "Transparenz" bedeutet. Gerhard Wettig meint, dies lasse sich auch mit "Offenheit und Publizität"1 charakterisieren. Es sollte also insgesamt mehr Öffentlichkeit hergestellt werden. Doch was bedeutet dies genau? Gorbatschow verfolgte die Absicht, diejenigen Funktionäre in Partei, Staat und Wirtschaft, die ihren Aufgaben nicht gerecht werden, unter einen publizistischen Druck zu setzen. Eine aus westlicher Sicht wünschenswerte Parallele Erscheinung dazu war, das unter diesem Grundsatz der Glasnost, erhebliche Lockerungen im geistigen und kulturellen Leben auftraten. Schließlich sollte dies noch ein entscheidender Wegbereiter für die "Klubphase" sein, auf die ich später noch zurückkommen werde. Wettig stellt zudem fest, das Transparenz auf zwei Weisen gehandhabt werden kann. Zum einen schränkt man das Ausmaß in dem Zensur betrieben wird ein, oder man versucht die eigene Politik durch werbedienliche Maßnahmen dem Publikum des In- und Auslandes besser zu vermitteln. Wichtig festzuhalten bleibt, daß diese Leitvorstellung sich in erster Linie an den Parteiapparat richtete, sich aber auch besonders stark in der Bevölkerung entfaltete und somit eine Grundstimmung schuf, in der sich ebenfalls kritische Stimmen äußern konnten.
2) In diesem Zusammenhang muß man Gorbatschows Perestrojka sehen. Er versuchte eine tiefgreifende "Umgestaltung", das ist es nämlich was Perestrojka bedeutet, in allen Bereichen der Politik und Wirtschaft. Nach Wettig, betraf dies in erster Linie personelle Änderungen des alten Kaders in der KPdSU2, welche sich natürlich gegen die Reformen Gorbatschows wehrten, da er ihnen ihre Privilegien beschneiden wollte. Jedoch sollte diese Umgestaltung viel weitreichender gehen und zwar die politischen, aber vor allen wirtschaftlichen Strukturen im ganzen Lande so zu erneuern, damit man wenigstens annähernd mit der ökonomischen Leistung der Vereinigten Staaten mithalten könne. Selbstverständlich war jedem klar, daß man den Wirtschaftsaufschwung der sechziger Jahre kaum so schnell wiederholen könne, doch erkannte man den ernst der Lage. Gorbatschow bemerkte zudem, daß der Pro-Kopf Verbrauch an Alkohol in der Sowjetunion um einiges höher lag, als noch zur Zarenzeit. Somit ging er gegen den steigenden Konsum von Alkohol und Drogen vor und wurde von der Bevölkerung als "Mineralsekretär" verspottet. In Bezug auf die Umgestaltung im Bereich der staatlichen Institutionen, geschah in Anbetracht der Allmachtsstellung der KPdSU etwas sehr außergewöhnliches. Gorbatschow wollte das legislative Moment in der UDSSR stärken und schuf somit den Kongreß der Volksdeputierten, welcher mit ein paar wenigen gesetzgeberischen Rechten ausgestattet war. Das die Wahl dorthin zudem interessanter wurde, das die Wähler sich aus einem Kandidatenkreis entscheiden durften, war zu damaliger Zeit revolutionär.
3) Wie sehr Gorbatschow besonders gegen den verkrusteten Kader vorgehen wollte, erkennt man an dem Schlüsselbegriff Uskorenie. Dieser bedeutet übersetzt "Beschleunigung". Laut Wettig kam es dem Generalsekretär darauf an, die Handlungsmöglichkeiten sowie die Hilfsquellen sinnvoller und rationeller einzusetzen. Demzufolge kann man Uskorenie auch mit dem eher westlichen Begriff der "Effizienz" gleichsetzen. Meines Erachtens läßt sich an diesem Beispiel wunderbar erkennen, wie schwer es doch oftmals war, Begriffe aus der sowjetischen Politik und deren Ideologie in gleichbedeutende Begriffe des Westens richtig zu übersetzen. Das es dabei oft zu Mißverständnissen kam, ist hiermit wohl verständlich geworden.
4) Eine der letzten Leitvorstellungen Gorbatschowscher Politik ist die Demokratizacija, sprich die "Demokratisierung". Wettig beschreibt dies so: "Diese Form der Umstrukturierung soll zunächst einmal die Auswahl der unteren und mittleren Kader des Partei-, Staats- und Wirtschaftsapparates neu regeln und dadurch für deren Leistungswillen und Verantwortungsbereitschaft einen veränderten Rahmen schaffen"3. Dies sollte aber noch ganz erhebliche Konsequenzen bei der Wahl zum neugeschaffenen Kongreß der Volksdeputierten haben, bei dem einigen reformerischen Kräften der Einzug gelang. Abschließend zu diesem Punkt möchte ich noch einmal hervorheben, daß mit der Wahl Gorbatschows zum Generalsekretär der KPdSU die Liberalisierungsphase in der Sowjetunion eingeleitet wurde. Da wir alle schon den Ausgang der Geschichte kennen, soll hierbei noch mal darauf hingewiesen werden, daß es bestimmt nicht die Absicht Gorbatschows war, den Zerfall der UDSSR einzuleiten, sonder sie zu reformieren und wirtschaftlich wieder erstarken zulassen. Leider ist die Idee eines sozialistischen Rechtstaates mit menschlichen Antlitz gescheitert.
III. Die einzelnen Phasen der Perestrojka-Periode und die Genese neuer (Proto-) Parteien
1) Bevor ich auf die "Klubphase" zu sprechen komme, sollte auf Grund der Vollständigkeit erwähnt werden, das sich zur Zeit der Breshnew-Ära viele erste Wurzeln für spätere Parteien herausbildeten. Galina Luchterhandt beschreibt, daß sich einige Dissidenten- bzw. Bürgerrechtsbewegungen entwickelten, zudem nationale und religiöse Widerstandsbewegungen. Dies mußte aber nicht zwangsläufig im Untergrund geschehen. Es entstanden ebenfalls sozialistische Zirkel und nationalistische Gruppen, welche mit Hilfe der erlaubten Ideologie versuchten, die UDSSR zu reformieren4. Das dabei insgesamt erste wichtige politische Akteure, Ideen und programmatische Überlegungen in Erscheinung traten, sollte später in der "Klubphase" erhebliche Bedeutung erlangen. Kennzeichnend für diese Zeit war, das die meisten Aktivitäten, solange sie nicht im Rahmen der KPdSU, Komsomol oder der Gewerkschaften abliefen, in der Illegalität stattfanden und in nicht selten Fällen einige dafür lange Zeit in das Gefängnis gehen mußten. Doch so wurden sie in den Widerstandsbewegungen schnell bekannt. Mit diesem Namen konnten sie später in der "Klubphase" manchen Bewegungen mehr Gehör verschaffen.
2) Nach Galina Luchterhandts Unterteilung der Perestrojka in vier Phasen, welche im übrigen meiner Gliederung zugrunde liegt, umfaßt die "Klubphase" ca. den Zeitraum von 1985-19875. Der Name entstand durch die Organisationsform der in dieser Zeit aktiven Gruppierungen, nämlich in Klubs. "Unmittelbar nach dem 27. Parteitag (der KPdSU) wurde im Mai 1986 eine Verordnungüber die Liebhaberinteressenvereinigung und Interessenklubs erlassen"6. Diese Form der Halblegalisierung schaffte eine Grauzone, wodurch private Initiativen und Gruppierungen registriert werden konnten. Nach Steinsdorff entwickelten diese "informellen Gruppen" ein unkontrolliertes und unkanalisiertes politisches Eigenleben7, obwohl es sich anfangs fast ausschließlich um ökologische und kulturelle Initiativen sowie um Interessengruppen im Nachbarschaftsbereich, ab ca.1987 dann aber auch um politische Diskussionsklubs handelte. Der Vergleich mit Honoratiorenklubs des 19. Jhdts.8 finde ich dabei nicht unzutreffend, denn schließlich waren die ersten Teilnehmer aus Bereichen der Intellektuellenschicht, der Prominenz aber auch der Dissidentenbewegung9. Dadurch ist unter anderem zu erklären, warum es zu verschiedenen Geschwindigkeiten zwischen Zentrum und Peripherie kam, da dieses Milieu fast ausschließlich im Zentrum zu finden gewesen sein dürfte. "Parallel dazu wuchsen Aktivitäten und Teilnehmerzahlen der von der KPdSU und dem KGB unterstützten Pamjat -Bewegung, deren Ideologie im Gegensatz zu den allgemeindemokratischen Vorstellungen, von einem _Sozialismus mit menschlichem Antlitzbis hin zum Liberalismus, radikal-nationalistisch, chauvinistisch sowie antisemitisch ist"10. Um das Spektrum der damals explosionsartig entstehenden Vereinigungen zu vervollständigen, müssen noch die Volksfronten, meist nach baltischem Vorbild, erwähnt werden. So schnell wie diese entstanden, teilten und zersplitterten oder lösten diese sich auch wieder auf. Bos/Steinsdorff begründen diese hohe Fluktuation "durch die Ambitionen einzelner Persönlichkeiten, die stärker als ideologische und programmatische Auseinandersetzungen zu den eigentlichen Kristallisationspunkten wurden"11.
Von einer wirklichen politischen Opposition kann bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Rede sein. Doch so konnten erste politische Ziele gefunden und geäußert werden und politisch Gleichgesinnte sich verbünden.
3) Bos/Steinsdorff stellen zudem fest, das manche Vereinigungen die Keimzelle spätere Parteien waren. So ist z.B. aus dem Moskauer Perestrojka-Klub heraus die erste politische Organisation entstanden, welche sich selbst als "Partei" bezeichnete, nämlich die "Demokratische Union"12. Erst ab hier sprechen die Politikwissenschaftler vom Beginn der eigentlichen Ära des Parteienpluralismus der Sowjetunion. Da die Demokratische Union zu Beginn starken Repressalien ausgesetzt war, sieht Galina Luchterhandt diese Partei als einen Indikator dafür, was zu dieser Zeit programmatisch als auch praktisch nicht mehr im Rahmen des Erlaubten ablief13. Somit befinden wir uns mitten in der "Phase der Massenaktionen und der Formierung politischer Massenbewegungen", welche ca. von 1988-1990 andauerte. Besonders erwähnenswert ist die sich im Herbst konstituierte Freiwillige Historisch- Aufklärende Gesellschaft Memorial unter Mitwirkung Andrej Sacharows. Ziel war zunächst eine politische Aufklärung über die Vergangenheit, was unter der Glasnost-Politik damals in den Bereich des "Erlaubten" fiel. Galina Luchterhandt stellt fest, das Memorial zwei wichtige Rollen spielte: Zum einen konnten sich unter dem "legalen" Dach einer nun auch auf Unionsebene agierende Memorial auch in der Provinz viele Gruppen entwickeln, die später zu Parteigründungen führen sollten. Zum anderen organisierte und mobilisierte sie die demokratischen Kräfte, so das sie auf Demonstrationen den größten Anteil bildeten14. Diese große Anzahl von Protesten und Aktionen muß man im Zusammenhang mit vielen politischen Ereignissen sehen, z.B. die Ablösung Jelzins vom Posten des Parteichefs in Moskau im Oktober 1987, der XIX. Unionsparteikonferenz im Juni 1988 und vor allem den Wahlen zum neu geschaffenen Volksdeputiertenkongreß (VDK) der UDSSR im April 1989. "Die Wahlen waren der entscheidende Impuls dafür, das sich aus dem breiteren Feld der gesellschaftlichen Bewegungen politische Vereinigungen und parteiähnliche Strukturen herauskristallisierten"15. Verstärkt wurde dies durch den eingangs schon erwähnten neuen Wahlmodus, der einen begrenzten Personenwettbewerb zuließ, so das einigen Reformern und Demokraten der Einzug gelang. So gewann der politische Pluralismus an Konturen, da im VDK die Reformer unter Boris Jelzin und Andrej Sacharow sich zur "Interregionalen Abgeordnetengruppe" und die konservativen Gegner sich in der Gruppe "Sojuz" zusammenschlossen. Aufgrund der Wahlen zum russischen VDK formierten sich viele Wählerklubs, so unter anderem auch die Dachorganisation "Moskauer Wählervereinigung" (MOI), welche ein wichtiger Vorläufer für die Wählerallianz "Demokratisches Rußland" (Demrossija) war. Dieser Wählerblock, der später eine lockere Vereinigung bleiben sollte, erreichte in den Großstädten eindrucksvolle Siege. Um diese Phase zu vervollständigen, muß das Verhalten des Machtapparates dargestellt werden: "Der KGB schleuste Spitzel in nichtformalen Gruppen ein; außerdem gründete er pseudodemokratische Vereinigungen, um die Kontrolle über die Bewegung zu behalten und manipulierend auf sie einwirken zu können, eine Methode die mit der Zeit immer breiter angewandt wurde"16. Als Beispiel dient hierfür die "Liberaldemokratische Partei Rußlands" unter Leitung Schirinowskij, welche im März 1989 unter zwielichtigen Umständen gegründet wurde17.
Als Fazit zu dieser Zeit konstatiert Galina Luchterhandt: "Die Bewegungen, Vereinigungen und "Parteien" haben keine breite soziale Basis"18. Gründe darin sieht sie in der atomisierten und destrukturierten Gesellschaft und dem mangelnden politischen Bewußtsein der Bevölkerung.
4) Somit befinden wir uns schon direkt in der Phase der Entstehung und Legalisierung von Parteien, welche von ca. 1989-1991 verlief. Bis zum Beginn dieses Abschnitts war die SU immer noch ein offizieller Einparteienstaat, in der die KPdSU das absolute Führungsmonopol besaß. Dies war verfassungsrechtlich in Artikel 6 der Union verankert, welcher erst im vergleich zu anderen osteuropäischen Staaten recht spät, also im März 1990, im Sinne einer Parteienpluralisierung verändert wurde. Die neu zugelassenen Parteien durften sich nicht gewaltsam gegen die Verfassungsordnung und Integrität des Sowjetstaates wenden19. Zudem ermöglichte die Neufassung des Artikel 51 eine Liberalisierung des Vereinigungsrechts. Diese ersten Schritte hin zur Demokratisierung und vor allem die Wahlen auch auf Republikebene lösten eine regelrechte Parteigründungswelle aus. So sind aus den beschriebenen Diskussionsklubs und Volksfronten "noch eine Reihe weiterer Protoparteien entstanden. So war aus dem Moskauer Perestrojka-Klub zunächst ein Sozialdemokratische Vereinigung hervorgegangen, die sich quasi als Reaktion auf die Streichung der Führungsrolle der KPdSU als Sozialdemokratische Partei Rußlands neu formierte20. Nach eigenen Angaben zufolge, soll die Partei Ende 1991 ca. 20 000 Mitglieder gezählt haben. Galina Luchterhandt stellt zudem fest: "Es wirkte sich ungünstig auf die Parteibildung das auf Unionsebene und in Rußland herrschende Mehrheitswahlsystem aus, das aufgrund seiner gesetzlichen Ausgestaltung im Kandidatenaufstellungsverfahren grundsätzlich keinen Unterschied zwischen Parteien, Bewegungen und sonstigen gesellschaftlichen Vereinigungen machte"21 Aus dem oben schon beschriebenen Wählerblock "Demokratisches Rußland" entstand nur eine politische Bewegung. Bos/Steinsdorff sehen die Gründe dafür zum einen in dem bei Abstimmungen disziplinlosen verhalten der Abgeordneten, welche sich als unabhängig verstanden und zum anderen trug die Haltung des neuen Parlamentspräsidenten Boris Jelzin nicht dazu bei dies zu stärken. "Obwohl Jelzin seine Wahl ... vor allem diesem Parlamentsblock verdankte, vermied er ein eindeutiges Bekenntnis zu diesem. Stattdessen betonte er, daß er in diesem Amt über den verschiedenen Parlamentsblöcken stehe"22. Sogar als er später die Präsidentschaftswahlen 1991 gewann, versäumte er die Bildung einer starken demokratischen Partei. Trotzdem war das "Demokratische Rußland" damals neben der KPdSU einer der größten Bewegungen mit ca. 300.000-400.000 Aktivisten. Nikolai Travkin vertrat jedoch die Meinung, "daß zur Stärkung der Opposition gegenüber der nach wie vor mächtigen Staatspartei ihre Vereinigung in eine dauerhaften Parteiorganisation nötig sei". "Seine Bemühungen, eine demokratische politische Partei zu formieren, führten im Mai 1990 zur Gründung der "Demokratischen Partei Rußlands" (DPR)23. Mitte 1991 hatte die DPR nach eigenen Angaben 36.000 Mitglieder und war in allen Regionen der Russischen Föderation vertreten.
So entstanden auch viele christliche Parteien, von denen die "Russische Christliche Demokratische Bewegung" die größte Bedeutung hatte. Interessant war ebenfalls zu beobachten, das einige Partein versuchten an "alte Zeiten" anzuknüpfen. So z.B. die "Konstitutionellen Demokraten". Dies mußte allerdings kläglich scheitern, da 70 Jahre SU- Diktatur und die kurze Zeitspanne der vorrevolutionären Periode eine zu große Hypothek darstellten. Dieter Segert beschrieb dies einmal als ein "Neuanfang ohne echt historische Wurzeln".
Bisher wurde kaum das linke Spektrum der Parteien angesprochen. Das liegt daran, das die KPdSU dies immer noch bis zu ihrem Verbot abdeckte und von mir im nächsten Punkt gesondert beschrieben wird.
IV) Starker Faktionalismus innerhalb der KPdSU
Dieser politische Differenzierungsprozeß innerhalb der KPdSU in Konservative und Demokraten wurzelt in der eingangs schon beschriebenen Perestrojka. Wichtig dabei zu wissen ist, das es dabei zu einem massiven Kaderauswechsel kam. "In der Zeitspanne zwischen seiner (Gorbatschows) Wahl zum Generalsekretär und der Einberufung des 27.
Parteitages wechselte er 67,6% der Kader des Politbüros aus (Chrustschow bracht es in seiner Amtszeit auf 35%, Breshnew auf 47,7%)"24. Auf dem 27. Parteitag nutzte Gorbatschow die Chance das 76,5% der Delegierten neu waren und reformierte so durch Wahlen das Zentralkomitee (ZK). In der zweiten Etappe der Perestrojka, welche vom 27. Parteitag bis zum ersten Kongreß der Volksdeputierten dauerte, wurde unter anderem das schon beschriebene Wahlsystem geändert, die Entflechtung von Staat und Partei massiv weiterbetrieben und das ZK um 22% reduziert. Erst mit diesem Vorwissen kann man den Zerfallsprozeß der KPdSU verstehen. Es war eben nicht mehr die alte Partei, sondern eine in sich zerrissene Partei und zwar in Reformgegner und Reformer. Diese Polarisierung in zwei Lager sollte aber nur von kurzer Dauer sein. Anfang 1990 stellte man schon 12 größere Gruppierungen und Fraktionen in der KPdSU fest, so das dies organisatorische Konsequenzen nach sich zog. So bildeten die radikalen Reformer die "Demokratische Plattform der KPdSU" unter Jelzin und zuvor die konservativen Parteifunktionäre schon die "Kommunistische Partei der Russischen Föderation" (KPRF) in der Ivan Polozkov den entscheidenden Einfluß übte. Erwähnenswert ist noch die "Marxistisch-Leninistische Plattform", welche sich als die Vertretung der Interessen der Arbeiterklasse definierte. "Auf dem 28. Parteitag der KPdSU wurde diese organisatorische Differenzierung offiziell anerkannt, indem den Mitgliedern das Recht zugestanden wurde, sich in derartigen Plattformen zusammenzuschließen"25. Zur gleichen Zeit kam es sogar zu ganzen Republiksparteiaustritten, da diese für ihre Unabhängigkeit kämpften.
Nach dem 28. Parteitag verließen viele Radikaldemokraten, unter ihnen Jelzin, Sobcak und Schewardnadse, die KPdSU. "Der Erneuerungsprozeß, den sie bisher aus der KPdSU heraus mitgetragen hatten, ließe sich nun so nicht mehr weitertreiben, lautete die übereinstimmenden Kritik Die Perestrojka, an der Gorbatschow festhielt, hatte sich überlebt"26. So kam es im November 1990 in Moskau zur Gründung der "Republikanischen Partei Rußlands", in der sich zahlreiche Mitglieder der "Demokratischen Plattform" versammelten. Einige Zeit später vereinigten sich die in der (ehemaligen) Staatspartei verbliebenen fortschrittlichen Kräfte unter dem Afghanistan-Kämpfer Aleksandr Ruzkoj zur Parlamentsgruppe "Kommunisten für Demokratie", aus der im Oktober 1991 die "Volkspartei Freies Rußland" hervorging. Wie jeder weiß, kam es im August 1991 zu einem gescheiterten Putschversuch der alten Nomenklatur, so das daraufhin die KPdSU verboten wurde. Natürlich meldeten sich danach viele neue kommunistische Parteien, die aber vor allem ein Recht auf das Vermögen der verbotenen Partei geltend machen wollten.
V) Cleavages
Wenn man sich bis hier hin die Geschichte der Parteiengenese genau betrachtet, so muß man zu der Erkenntnis gelangen, daß das traditionelle Modell der Konfliktlinien von Lipset und Rokkan nicht auf Rußland übertragbar ist. Dies besagt, das neue Parteien sich "normalerweise" an cleavages wie Staat versus Kirche oder Arbeit versus Kapital entlang entwickeln. Wenn man sich einmal letztes Beispiel vor Augen führt, so stellt man fest, das im Falle Rußlands das Kapital erst im Entstehen war und die Unternehmen noch in den Kinderschuhen steckten. So kam es zu der paradoxen Situation, das die "Sozialdemokratische Partei Rußlands" die Unternehmerinteressen anfangs mitvertrat. Deswegen entstanden ganz neue cleavages: Für die Zeit bis zur Überwindung des anciène Regimes herrschte eine dominierende Zweiteilung in "wir" gegen "sie" (my-oni) oder von "Beherrschten" gegen "Beherrschte". Ein schönes Beispiel ist auch der Komplex der Zukunftsfragen: sollte man eine Föderation oder einen Einheitsstaat wollen. Welche Wirtschaftsform sollte man anstreben? Eine Planwirtschaft oder eine Marktwirtschaft? Und wie soll dies Ausgestaltet werden? Selbst die so oft schon beschriebene Personalisierung der Politik tritt als neue cleavage auf: "pro-Jelzion" und "anti-Jelzin". Sogar politische Themen konnten dabei eine Rolle spielen: die "Partei des Krieges" gegen die "Partei des Friedens". Das "rechts-links" Schema greift hier schlicht einfach nicht. Besser ist in der Zeit Gorbatschows wirken die Unterscheidung in "Radikalreformer" (demokraty), Reformer/ gemäßigte Opposition (centristy) und Reaktionäre/ Reformgegner (patrioty/ kommunisty). Dies ist besonders gut an der Fraktionenbildung zum ersten gewählten VDK zu sehen.
VI) Parteienentwicklung
1) Wie aus dem Aufsatz schon hervorgegangen ist, spielten die Parteien in Rußland zwar eine bedeutende, lange jedoch nicht so eine zentrale Rolle wie in anderen osteuropäischen Ländern während des Transformationsprozesses. Die Mitgliederzahlen belegen dies deutlich, obwohl wie Falle des "Demokratischen Rußlands" sehr viele Menschen daran beteiligt waren, so ist diese Zahl im Verhältnis zur Bevölkerungszahl geringer als in anderen Ländern. Zudem spielten die Parteien in den Vertretungskörperschaften nur eine geringe, in der Exekutive so gut wie keine Rolle. Schließlich stellte sich der Institutionen- und Wahlkampf eher als ein Persönlichkeitskampf als ein Parteienwettbewerb dar. Dies wird sogar deutlich wenn man die politische Richtung einer Partei untersuchte. Dies wechselte nicht durch das Parteiprogramm, sondern durch den jeweiligen Vorsitzenden. Es sollen hier noch zwei extreme Beispiele für einen extremen Wandel von Politikern zur damaligen Zeit aufgeführt werden: Travkin entwickelte sich von einem populären antikommunistischen Trommler zum Streiter für den Erhalt der SU im Bündnis "Bürgerunion" neben Ruckoj. Oder Astaf`ev der vom Erfinder der Losung "Demokratisches Rußland" zum Mitglied der kommunistisch-nationalistischen "Front der nationalen Rettung". De facto gab es zunächst einfach zu viele Parteien, über die man leicht den Überblick verlieren konnte.
2) Manche Politikwissenschaftler kommen zu dem Ergebnis, das die Parteienlandschaft bis heute nur ein rudimentäres Parteiensystem sei, es sich sogar um ein "Parteiensystem ohne Parteien"27 handle. Worin liegen also die Ursachen dafür, das die Parteien nur eine periphere Rolle spielten? Dazu muß man zunächst den institutionellen Rahmen betrachten. Dieser wurde durch die Perestrojka-Politik "von oben" her liberalisiert, man erinnere sich an das Wahlsystem und das Vereinigungsrecht. "Die Organisation gesellschaftlicher Interessen in Form von funktionsfähigen, repräsentativen Parteien muß dann jedoch allmählich "von unten" wachsen"28. Jedoch behinderte die geringe Partizipationsbereitschaft und die aus westlicher Sicht mangelnde politische Kultur der Bevölkerung diesen Prozeß. Letzteres ist in der Vereinfachung der politischen Prozesses und in dem stereotypen Denken in "gut" und "böse" fast schon bewiesen. Wie sollte sich in 70 Jahren SU auch eine politische Kultur entwickeln? Stattdessen hatte sich die traditionelle Orientierung auf einen politischer Erlöser verstärkt. So dauerte die Liberalisierungsphase sehr lang und die anschließende Demokratisierungsphase verlief nur unvollständig und zögerlich. Rußland hatte allerdings auch mit einer schweren Hypothek zu kämpfen: "Obwohl sich das Problem der Ausgestaltung des eigenen staatlichen Institutionensystems ... besonders dringlich stellte, überlagerte bzw. verdrängte der Prozeß der Emanzipation von den Staatsorganen der Zentralmacht zunächst die dazu notwendige Diskussion. Das gilt ebenso für die unmittelbare gesetzliche Regelung parteipolitischer Tätigkeit wie auch für die Debatte um das anzustrebende Regierungssystem und das Wahlrecht"29.
Einen Vorwurf muß man auch den Politikern, vor allem den Demokraten, machen: Zum einen verstanden sich die Parlamentarier als unabhängig, so das diese keine Fraktionsdisziplin und somit keine Vorstufe zur Partei entwickelten. Zum anderen versäumte Boris Jelzin die Bildung einer starken demokratischen Partei. Jelzin selber sagte als russischer Präsident: "Es gibt nur Russen, keine Parteien". Somit entwickelte sich kein ernsthafter auf Dauer angelegter Gegenspieler zur KPdSU bzw. zu ihren kommunistischen Nachfolgeparteien, welche später ein spektakuläres Comeback feiern sollten. Zuletzt sollte sich durch den Verbot der KPdSU der tiefsitzende Antiparteieneffekt noch vertiefen.
Literaturverzeichnis:
os, Ellen/Steinsdorff, Sylvia von; "Zu viele Parteien- zu wenig System" in: Merkel, Wolfgang/ Sandschneider, Eberhard (Hrsg.), Opladen 1997: "Systemwechsel 3. Parteien im Transformationsprozeß"
Dimitris Th. Tsatsaos/ Zdzislaw Kedzia (Hrsg.), Baden-Baden 1994: "Parteienrecht in mittel- und osteuropäischen Staaten"
Hirscher Georg (Hrsg.), München 2000: "Kommunistische und postkommunistische Parteien in Osteuropa", Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen 14
Luchterhandt Galina, Ed. Temmen 1993: "Die politischen Parteien im neuen Rußland"
Luchterhandt Otto (Hrsg.), Berlin 1996: "Neue Regierungssysteme in Osteuropa und der GUS", Bd. 37
Segert, Dieter/ Machos, Csilla, Opladen 1995: "Parteien in Osteuropa"
Segert, Dieter/ Stöss, Richard/ Niedermayer, Oskar (Hrsg.), Opladen 1997:
"Parteiensysteme in postkommunistischen Gesellschaften Osteuropas"
Wettig Gerhard, München 1987: "Sowjetunion 1986/87" in BIOST "Einführung" S.9-25
[...]
1 Wettig, München 1987, S.13
2 Ebenda, S.14
3 Wettig, München 1987, S.14
4 Luchterhandt, Temmen 1993, S. 16
5 Ebenda, S.15
6 Bos/Steinsdorff, Opladen 1997, S.104
7 Bos/Steinsdorff, Opladen 1997, S. 102
8 Segert/Stöss/Niedermayer, Opladen 1997, S.288
9 Luchterhandt, Temmen 1993, S.16
10 Ebenda
11 Bos/Steinsdorff, Opladen 1997, S.111
12 Ebenda
13 Luchterhandt, Temmen 1993, S.17
14 Ebenda, S.18
15 Bos/Steinsdorff, Opladen 1997, S.111
16 Luchterhandt, Temmen 1993, S.18
17 Bos/Steinsdorff, Opladen 1997, S.116
18 Luchterhandt, Temmen 1993, S.19
19 Bos/Steinsdorff, Opladen 1997, S.105
20 Ebenda, S.116
21 Luchterhandt, Temmen 1993, S.24
22 Bos/Steinsdorff, Opladen 1997, S.113
23 Ebenda
24 Segert/Csilla, Opladen 1995, S.156-157
25 Bos/Steinsdorff, Opladen 1997, S.115
26 Segert/Csilla, Opladen 1995, S.158
27 Bos/Steinsdorff, Opladen 1997, S.103
28 Ebenda
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen Überblick über die Anfänge der politischen Pluralisierung, insbesondere der Parteien, am Ende der Sowjetunion. Sie konzentriert sich auf die Rolle der Parteien im Transformationsprozess und deren Entstehung in Russland.
Welche Reformen Gorbatschows leiteten den Wandel ein?
Gorbatschows Reformen umfassten:
- Glasnost (Transparenz und Offenheit)
- Perestrojka (Umgestaltung in Politik und Wirtschaft)
- Uskorenie (Beschleunigung, Effizienzsteigerung)
- Demokratizacija (Demokratisierung)
Welche Phasen der Perestrojka-Periode werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet vier Phasen:
- Breshnew-Ära: Entstehung erster Dissidenten- und Widerstandsbewegungen.
- Klubphase (1985-1987): Bildung von Interessenvereinigungen und Diskussionsklubs.
- Phase der Massenaktionen (1988-1990): Formierung politischer Massenbewegungen und erste "Parteien".
- Phase der Entstehung und Legalisierung von Parteien (1989-1991): Legalisierung von Parteien und Parteigründungswelle.
Welche Rolle spielte der Faktionalismus innerhalb der KPdSU?
Innerhalb der KPdSU gab es eine starke politische Differenzierung zwischen Konservativen und Demokraten, die zu Fraktionsbildungen und schließlich zum Zerfall der Partei führte.
Welche Konfliktlinien (Cleavages) prägten die Parteienentwicklung?
Die traditionellen Konfliktlinien (z.B. Arbeit vs. Kapital) waren in Russland nicht so relevant. Stattdessen entstanden neue Konfliktlinien wie "wir" gegen "sie", Föderation vs. Einheitsstaat, Planwirtschaft vs. Marktwirtschaft, pro-Jelzin vs. anti-Jelzin.
Wie war die Parteienentwicklung in Russland?
Die Parteien spielten eine bedeutende, aber nicht so zentrale Rolle wie in anderen osteuropäischen Ländern. Die Parteienlandschaft entwickelte sich nur rudimentär, und es gab eine geringe Partizipationsbereitschaft in der Bevölkerung. Auch die Politiker, vor allem die Demokraten, trugen durch mangelnde Fraktionsdisziplin und das Versäumnis zur Bildung einer starken demokratischen Partei zur Schwäche des Parteiensystems bei.
Was sind die Ursachen für die Schwäche der russischen Parteien?
Die Ursachen liegen in:
- Der Liberalisierung "von oben" durch die Perestrojka-Politik.
- Der geringen Partizipationsbereitschaft und mangelnden politischen Kultur der Bevölkerung.
- Der traditionellen Orientierung auf politische Erlöser.
- Dem Versäumnis der Politiker, starke Parteien zu bilden.
Welche Literatur wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Werke von Ellen Bos/Sylvia von Steinsdorff, Dimitris Th. Tsatsaos/Zdzislaw Kedzia, Georg Hirscher, Galina Luchterhandt, Otto Luchterhandt, Dieter Segert/Csilla Machos, Dieter Segert/Richard Stöss/Oskar Niedermayer und Gerhard Wettig.
- Arbeit zitieren
- Christian Bliedtner (Autor:in), 2000, Die Anfänge der politischen Pluralisierung in der SU von 1986-1991, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99371