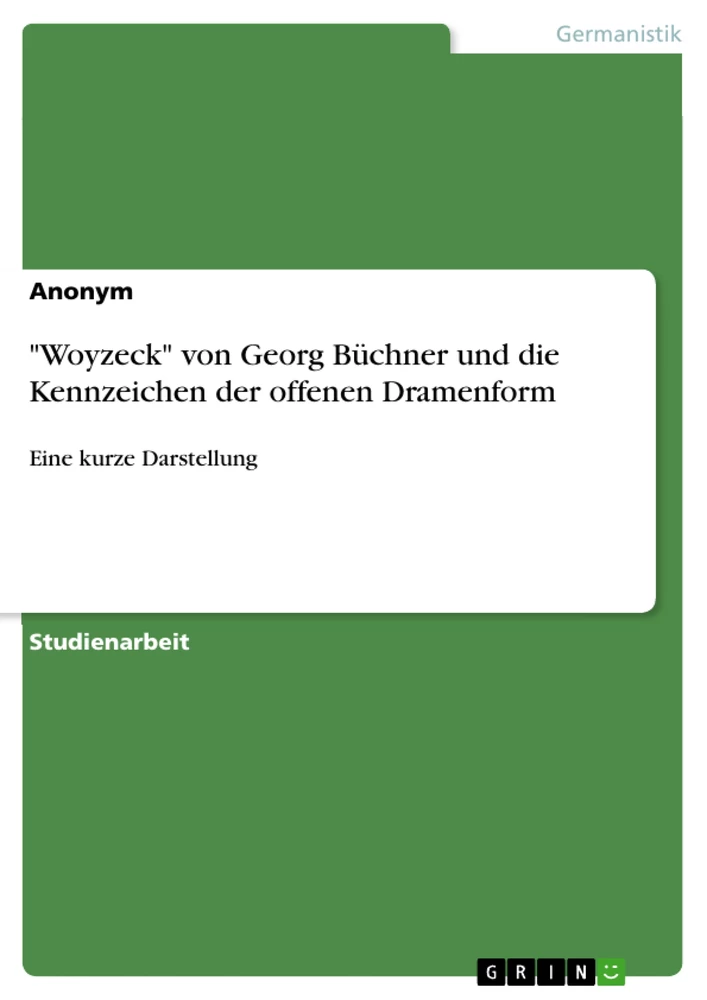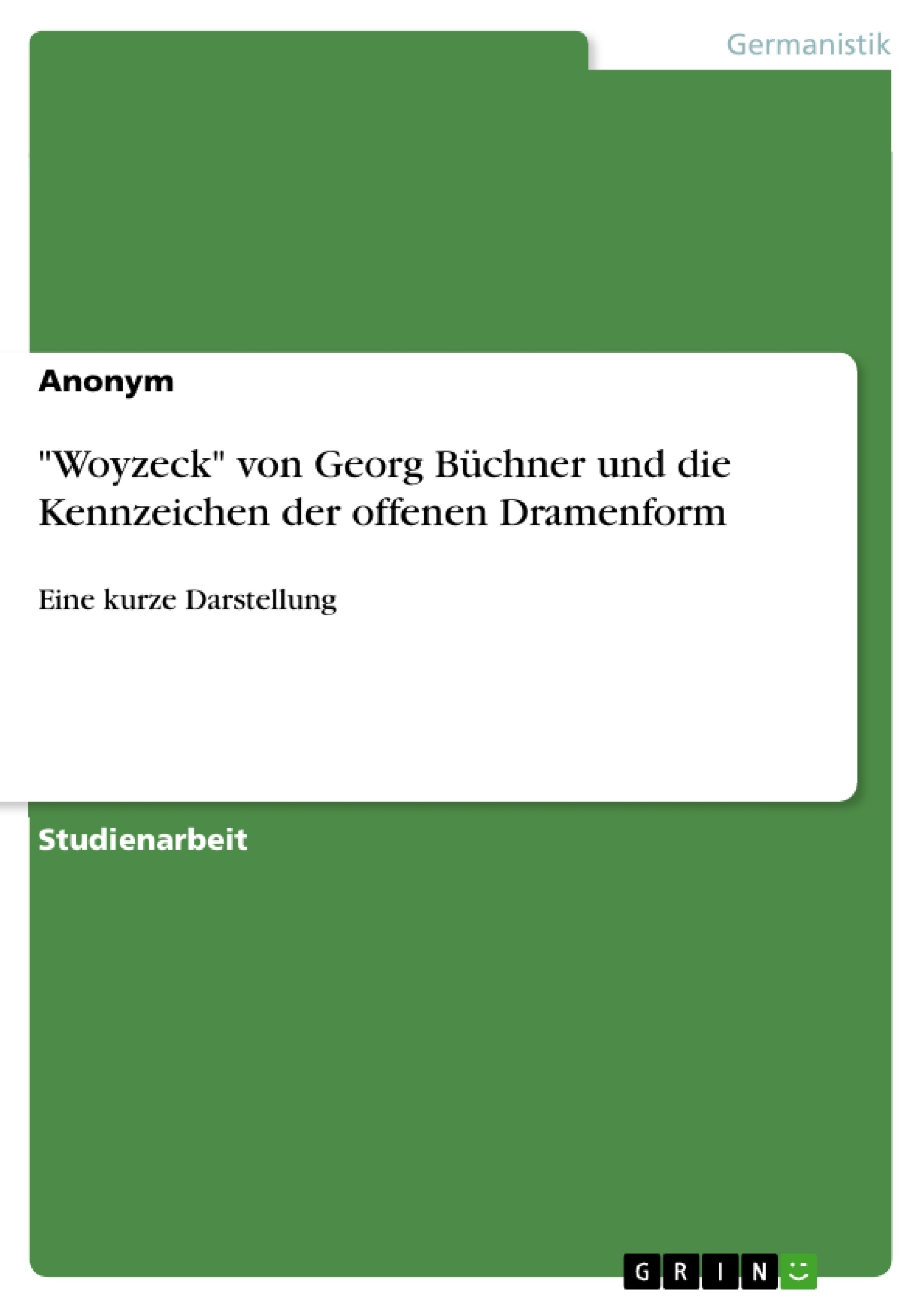Die Arbeit soll evaluieren, inwiefern Büchners Fragment "Woyzeck" Merkmale der offenen Dramenform aufweist. Dies geschieht, indem beginnend die geschlossene Form im Vergleich zur offenen Form im Drama umrissen wird, deren Unterscheidung auf das gleichnamige Buch von Literaturwissenschaftler Volker Klotz zurückgeht. Anschließend bildet die Untersuchung der offenen Form im Drama Woyzeck den Schwerpunkt und wird unter den Aspekten der Handlung, der Sprache und dem Zeit-Raumaspekt näher beleuchtet. Jedoch zeigt Büchners Drama trotz seiner offenen Struktur diverse semantische Zusammenhänge zwischen den einzelnen Szenen auf, welche die offene Form kompensieren. Hierbei spielen Parallelhandlungen und die Bildlichkeit eine große Rolle. Es stellt sich trotz der Nicht-Vollendung des Werkes heraus, dass Büchner sein Drama Woyzeck auf die offene Form hin anlegt, jedoch nicht komplett von der geschlossenen Dramenform abweicht und eine gewisse Gesamtstruktur erkennbar bleibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Georg Büchners Woyzeck
- Die geschlossene und offene Dramenform
- Die offene Dramenform
- Komposition und Handlung
- Sprachstil und Dialogführung
- Raum, Zeit und Personal
- Kompensierung der offenen Dramenform
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Georg Büchners Fragment „Woyzeck“ und untersucht, inwiefern es Merkmale der offenen Dramenform aufweist. Dabei werden die geschlossene und offene Dramenform im Vergleich betrachtet, wobei der Schwerpunkt auf der Analyse der offenen Form in „Woyzeck“ liegt. Die Arbeit beleuchtet die Handlung, die Sprache und die zeit-räumlichen Aspekte des Dramas. Darüber hinaus wird untersucht, inwiefern Büchners Drama trotz seiner offenen Struktur semantische Zusammenhänge zwischen den einzelnen Szenen aufweist, die die offene Form kompensieren.
- Die offene Dramenform in Georg Büchners „Woyzeck“
- Die Komposition und Handlung des Dramas
- Der Sprachstil und die Dialogführung in „Woyzeck“
- Die Kompensierung der offenen Dramenform durch semantische Zusammenhänge
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt den Leser in die Thematik ein und stellt Georg Büchner und sein Werk „Woyzeck“ in den Kontext der literarischen Moderne. Kapitel 2 behandelt die geschlossene und offene Dramenform und stellt die theoretischen Grundlagen der Analyse dar. Kapitel 2.1 beleuchtet die beiden Dramentypen im Vergleich, während Kapitel 2.2 die offene Dramenform im Detail untersucht, indem es auf die Handlung, die Sprache und die zeit-räumlichen Aspekte des Dramas eingeht. Abschließend wird in Kapitel 2.3 die Kompensierung der offenen Dramenform durch semantische Zusammenhänge zwischen den Szenen des Dramas erörtert. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die zentralen Ergebnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Offene Dramenform, geschlossene Dramenform, Georg Büchner, Woyzeck, Handlung, Sprache, Zeit, Raum, Komposition, Semantik, Dramenanalyse.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2015, "Woyzeck" von Georg Büchner und die Kennzeichen der offenen Dramenform, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/993862