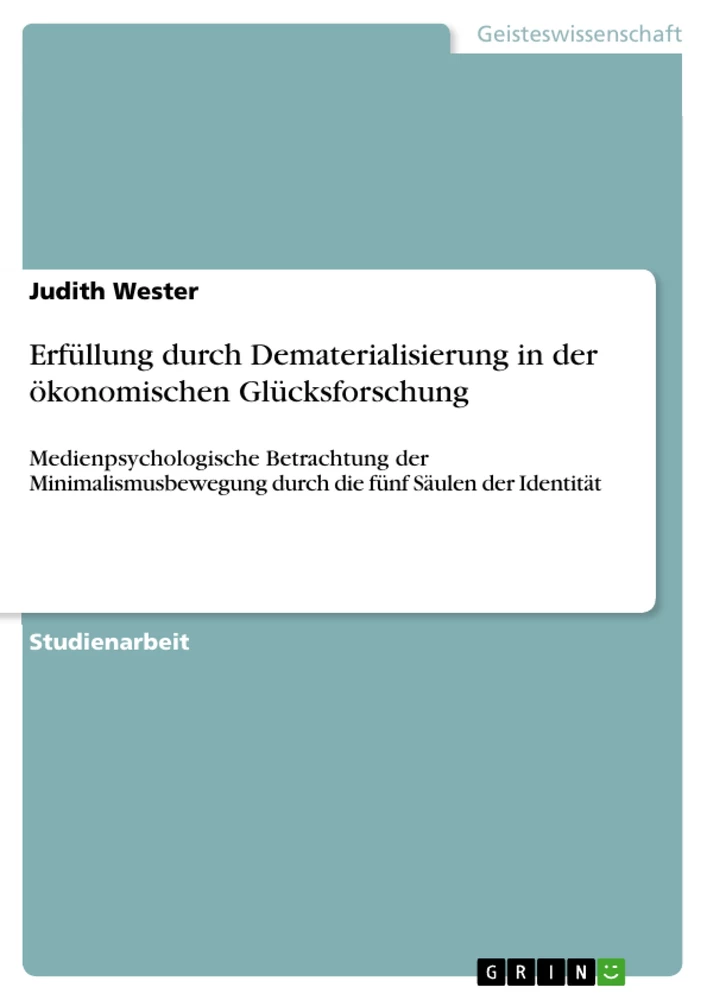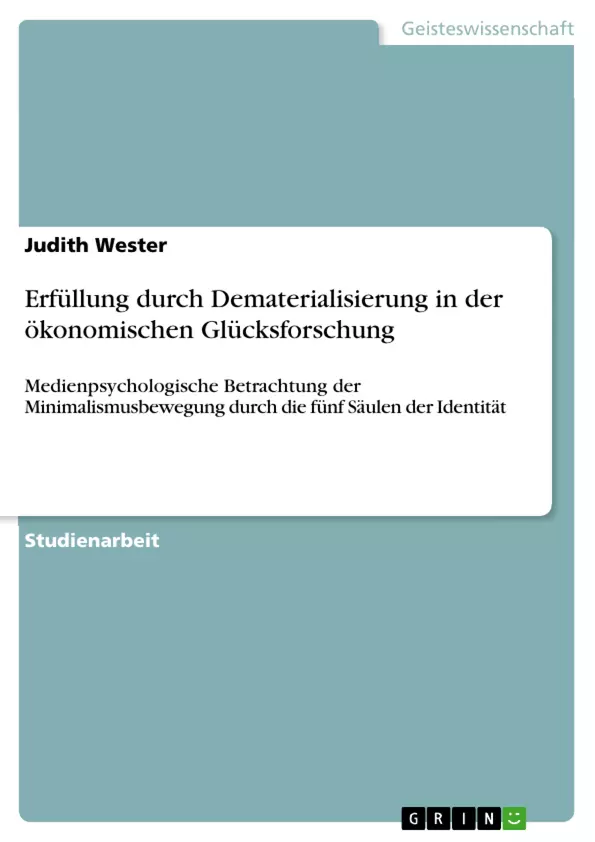Inwieweit kann das Loslösen von Besitz die Zufriedenheit des Einzelnen steigern? Dieses Phänomen soll in der Arbeit medienpsychologisch unter Zuhilfenahme der fünf Säulen der Identität nach Petzold und der ökonomischen Glücksforschung betrachtet werden.
Im heutigen Deutschland, das geprägt ist von einem bisher ungekannten Wohlstand und beinahe unbegrenzten Möglichkeiten der Vernetzung und Kommunikation, entwickelt sich eine Bevölkerungsgruppe, die scheinbar ganz bewusst auf diesen Wohlstand verzichtet. Die Minimalismus-Bewegung ist bestrebt, den eigenen materiellen Besitz und weitere soziale- und Umweltfaktoren auf ein Minimum zu reduzieren. Die Anhänger wollen sich ausschließlich mit den Dingen umgeben, die tatsächlich nötig sind, und allen selbst definierten Ballast aus dem eigenen Leben entfernen. Das Ziel scheint ein glücklicheres, zufriedeneres und freies Leben zu sein. Bemerkenswert ist die Ambivalenz zwischen dem Reduzieren des materiellen Besitzes auf der einen und der Verschiebung desselben in eine Art digitalen Besitz auf der anderen Seite.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Gang der Arbeit
- 2 Definitionen und Abgrenzungen
- 2.1 Minimalismus und der „Cult of Less“
- 2.2 Die fünf Säulen der Identität
- 2.3 Digitalisierung klassischer Medien
- 2.4 Ökonomische Glücksforschung
- 3 Dematerialisierung zur Identitätsbildung als Streben nach Glück
- 3.1 Reduzierung materieller Werte
- 3.2 Zufriedenheitssteigerung durch Minimalismus
- 4 Schlussbetrachtung
- 4.1 Fazit
- 4.2 Ausblick
- 5 Student-Consulting-Transfer
- 5.1 Beschreibung welzenbachs GmbH
- 5.2 IST Analyse
- 5.3 Handlungsempfehlung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Dematerialisierung, der Minimalismus-Bewegung und dem Streben nach Glück im Kontext der ökonomischen Glücksforschung und der fünf Säulen der Identität. Ziel ist es, die Veränderungen in der Identitätssäule „materielle Sicherheit“ bei Minimalisten zu analysieren und die Voraussetzungen für ein glücklicheres Leben durch Besitzreduktion zu erforschen.
- Minimalismusbewegung in Deutschland
- Die fünf Säulen der Identität nach Petzold
- Ökonomische Glücksforschung und Zufriedenheit
- Dematerialisierung und Identitätsbildung
- Digitalisierung klassischer Medien im Kontext des Minimalismus
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Minimalismus-Bewegung in Deutschland ein und beschreibt das scheinbare Paradoxon zwischen Wohlstand und dem bewussten Verzicht auf materiellen Besitz. Es wird die Forschungsfrage formuliert: Unter welchen Voraussetzungen verändert sich die Identitätssäule „materielle Sicherheit“ nach H.G. Petzold bei Dematerialisierung in Bezug auf das Streben nach Glück? Die Zielsetzung der Arbeit und der methodische Ansatz werden dargelegt.
2 Definitionen und Abgrenzungen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe wie Minimalismus, „Cult of Less“, und die fünf Säulen der Identität. Es beschreibt den Minimalismus als eine Lebensphilosophie, die auf der Reduktion materiellen Besitzes beruht und oft mit der Nutzung digitaler Medien verbunden ist. Die verschiedenen Aspekte des Minimalismus und seine vermeintlichen Vorteile, wie mehr Freiheit und Zeit, werden diskutiert. Der Bezug zu den fünf Säulen der Identität und der ökonomischen Glücksforschung wird hergestellt, um den Rahmen für die spätere Analyse zu schaffen.
3 Dematerialisierung zur Identitätsbildung als Streben nach Glück: In diesem Kapitel wird der Zusammenhang zwischen Dematerialisierung, Identitätsbildung und dem Streben nach Glück untersucht. Es wird analysiert, wie die Reduktion materieller Werte die Zufriedenheit steigern kann, indem es die Perspektive der ökonomischen Glücksforschung einbezieht. Die Kapitel untersuchen, inwiefern die Veränderung des materiellen Besitzes die Identität der Individuen beeinflusst und wie sich dies auf ihr Glücksgefühl auswirkt. Dabei wird der Fokus auf die Interaktion der verschiedenen Aspekte gelegt.
Schlüsselwörter
Minimalismus, Dematerialisierung, ökonomische Glücksforschung, Identität, fünf Säulen der Identität (Petzold), Digitalisierung, Medienpsychologie, Zufriedenheit, materielle Sicherheit, „Cult of Less“.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Dematerialisierung und Streben nach Glück
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Dematerialisierung, der Minimalismus-Bewegung und dem Streben nach Glück. Im Fokus steht die Analyse der Veränderungen in der Identitätssäule „materielle Sicherheit“ bei Minimalisten und die Erforschung der Voraussetzungen für ein glücklicheres Leben durch Besitzreduktion.
Welche zentralen Begriffe werden definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit definiert Minimalismus, den „Cult of Less“, die fünf Säulen der Identität nach Petzold und die ökonomische Glücksforschung. Es wird der Minimalismus als Lebensphilosophie mit Fokus auf Reduktion materiellen Besitzes und oft verbundener Nutzung digitaler Medien beschrieben.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Minimalismusbewegung in Deutschland, die fünf Säulen der Identität, ökonomische Glücksforschung und Zufriedenheit, Dematerialisierung und Identitätsbildung sowie die Digitalisierung klassischer Medien im Kontext des Minimalismus.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit Definitionen und Abgrenzungen, ein Kapitel zum Zusammenhang zwischen Dematerialisierung, Identitätsbildung und Streben nach Glück, eine Schlussbetrachtung und einen Student-Consulting-Transfer. Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage und die Zielsetzung. Die Schlussbetrachtung beinhaltet ein Fazit und einen Ausblick. Der Student-Consulting-Transfer analysiert ein Unternehmen im Kontext der Arbeitsthemen.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Unter welchen Voraussetzungen verändert sich die Identitätssäule „materielle Sicherheit“ nach H.G. Petzold bei Dematerialisierung in Bezug auf das Streben nach Glück?
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit beschreibt den methodischen Ansatz in der Einleitung, wobei die genaue Methodik im bereitgestellten Auszug nicht detailliert aufgeführt ist.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in jedem Kapitel?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik, Formulierung der Forschungsfrage und Zielsetzung. Kapitel 2 (Definitionen und Abgrenzungen): Klärung zentraler Begriffe wie Minimalismus und die fünf Säulen der Identität. Kapitel 3 (Dematerialisierung zur Identitätsbildung als Streben nach Glück): Analyse des Zusammenhangs zwischen Dematerialisierung, Identitätsbildung und Glück. Kapitel 4 (Schlussbetrachtung): Zusammenfassung der Ergebnisse, Fazit und Ausblick. Kapitel 5 (Student-Consulting-Transfer): Anwendung der Erkenntnisse auf ein reales Unternehmen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Minimalismus, Dematerialisierung, ökonomische Glücksforschung, Identität, fünf Säulen der Identität (Petzold), Digitalisierung, Medienpsychologie, Zufriedenheit, materielle Sicherheit, „Cult of Less“.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Der bereitgestellte Text deutet darauf hin, dass die Arbeit für einen akademischen Kontext bestimmt ist, möglicherweise als Studienarbeit oder Seminararbeit.
- Quote paper
- Judith Wester (Author), 2016, Erfüllung durch Dematerialisierung in der ökonomischen Glücksforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/994014