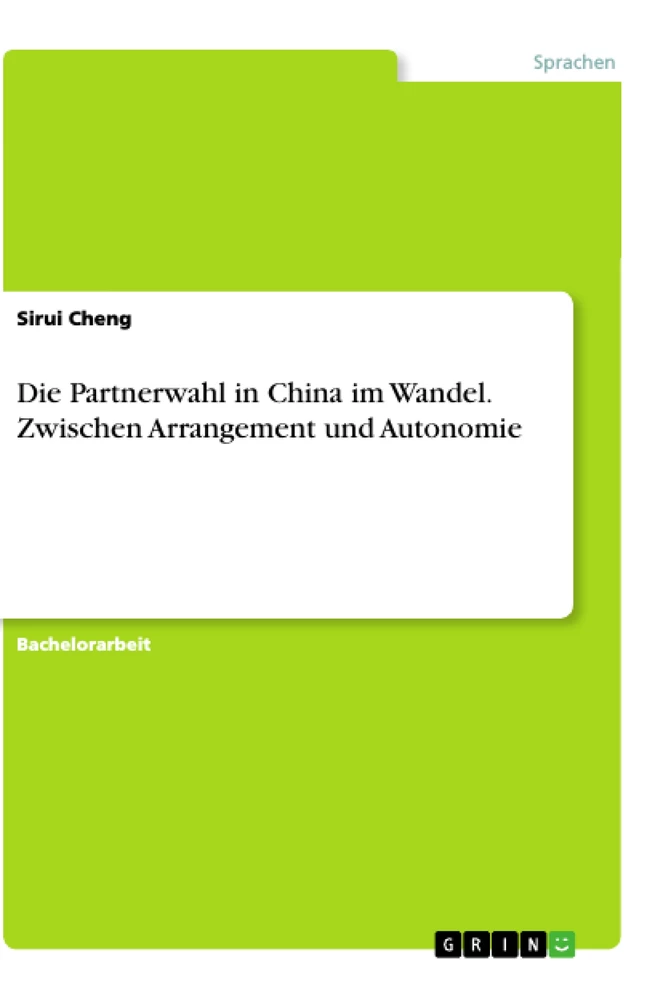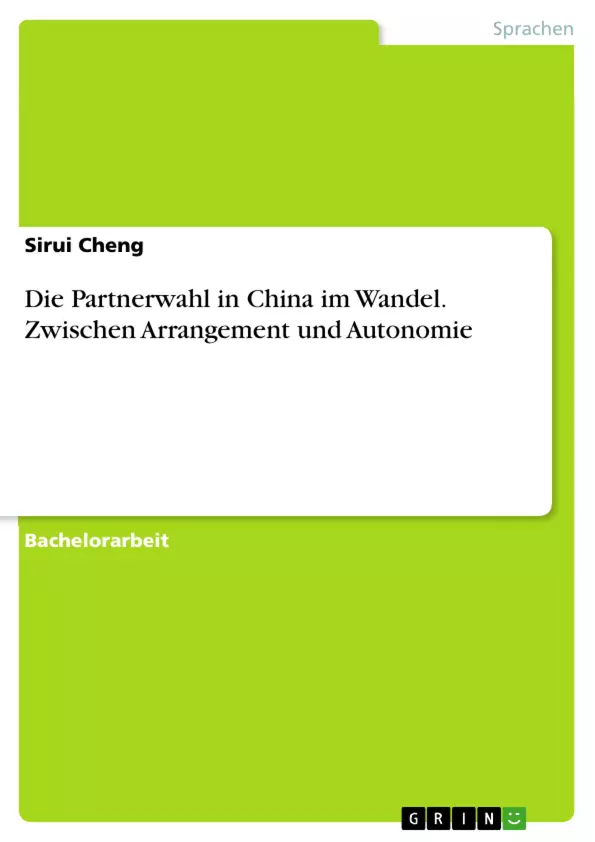Die vorliegende Bachelorarbeit legt den Fokus auf das Festland China, das über Jahrtausende hinweg von den patrilinearen und konfuzianischen Werten geprägt wurde. Dies ging damit einher, dass die meisten Ehen nach diesen Traditionen grundsätzlich von den Eltern arrangiert wurden, wohingegen sich in den vergangenen Dekaden auch eine grundlegende Umorientierung in Bezug auf die Ehe – größtenteils in den städtischen und Küstenregionen – abzeichnete. Vor allem die Handelsstädte in Küstengebieten erlebten sowohl am Anfang der Modernisierungswelle im 19. Jahrhundert als auch seit der marktwirtschaftlichen Reform in den 1970er Jahren durch den Zuzug von westlichen Investitionen und Ideologien eine immense politische, gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Entwicklung. Das Landesinnere blieb hiervon nahezu unberührt.
Dieses Stadt-Land-Gefälle lässt sich allerdings nicht nur aus Sicht des Entwicklungsstandes erklären, sondern auch anhand der sozialen Institution, allen voran der Geschlechterrolle, auf der die bestehende Gesellschaftsordnung basiert. Aus dem tiefgehenden gesellschaftlichen Wandel und der großen Heterogenität zwischen Stadt und Land resultieren die Fragen, inwieweit sich der Modus der Partnerwahl im Laufe des letzten Jahrhunderts geändert hat, ob die jüngeren Generationen und die in den neuen Zeiten Verheirateten über mehr Autonomie für die Eheschließung verfügen, welche Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen vorhanden sind, die sich auf
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Forschungshintergrund und Forschungsfragen
- 1.2. Begriffsdefinitionen und Rekonzeptualisierung der Partnerwahl
- 1.3. Überblick über die Gliederung
- 2. Theoretischer Hintergrund im chinesischen Kontext
- 2.1. Makroebene: gesellschaftliche Rahmenbedingungen
- 2.1.1. Historische Wurzel der arrangierten Ehe und der heutige Heiratsmarkt in China
- 2.1.2. Gesellschaftlicher Wandel: Industrialisierung, Modernisierung und sinkende familiäre Kontrolle
- 2.1.3. Intervention des Staates: Ideologie, Gesetzesänderung und Planwirtschaft
- 2.1.4. Stadt-Land-Unterschied
- 2.2. Mikroebene: persönliche Merkmale
- 2.2.1 Genderunterschiede und Geschlechterrolle im Zusammenhang mit Urbanität und Ruralität
- 2.2.2 Rolle der Selbstständigkeit: Bildung, Erwerbstätigkeit und Einkommen
- 2.3. Zusammenfassung der Hypothesen und methodische Herangehensweise
- 3. Daten und Methoden
- 3.1. Datenbasis
- 3.2. Messung und Operationalisierung
- 3.2.1. Abhängige Variablen
- 3.2.2. Unabhängige Variablen
- 4. Ergebnisse
- 4.1. Deskriptive Analyse
- 4.2. Multivariate Analyse
- 4.2.1. Binäre logistische Regression
- 4.2.2. Generalisierte ordinale logistische Regression
- 5. Fazit, Beschränkung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Wandel der Partnerwahl in China. Ziel ist es, den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen und individueller Faktoren auf die Entscheidungsfindung im Heiratskontext zu analysieren. Dabei werden sowohl makro- als auch mikroökonomische Perspektiven berücksichtigt.
- Der Einfluss historischer und gesellschaftlicher Entwicklungen auf die Partnerwahl in China.
- Die Rolle der Urbanisierung und des wirtschaftlichen Wandels bei der Veränderung traditioneller Heiratsmuster.
- Der Vergleich der Partnerwahl zwischen städtischen und ländlichen Regionen Chinas.
- Die Bedeutung von Genderrollen und individuellen Merkmalen (Bildung, Einkommen) für die Partnerwahl.
- Die zunehmende Autonomie bei der Partnerwahl in jüngeren Generationen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Partnerwahl in China ein und stellt den Forschungsgegenstand vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen dar. Sie beleuchtet den Gegensatz zwischen traditionell arrangierten Ehen und der zunehmenden Individualisierung der Partnerwahl. Die Arbeit fokussiert sich auf die Herausforderungen und den Wandel der Partnerwahl in China im Kontext von Modernisierung und Urbanisierung. Die Forschungsfragen und die Gliederung der Arbeit werden dargelegt.
2. Theoretischer Hintergrund im chinesischen Kontext: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Rahmen für die Untersuchung. Es analysiert die makro- und mikroökonomischen Faktoren, die die Partnerwahl beeinflussen. Auf Makroebene werden historische Entwicklungen, staatliche Interventionen und der Stadt-Land-Unterschied beleuchtet. Auf Mikroebene werden die Rollen von Gender, Bildung, Erwerbstätigkeit und Einkommen betrachtet. Das Kapitel verknüpft die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mit den individuellen Entscheidungen und leitet Hypothesen ab.
3. Daten und Methoden: Dieses Kapitel beschreibt die Datenbasis der Studie und die angewandten Methoden. Es erläutert die verwendeten Variablen (abhängige und unabhängige) und wie diese operationalisiert wurden. Die Auswahl der Daten und die Methoden der Datenauswertung werden detailliert dargestellt, um die wissenschaftliche Fundiertheit der Ergebnisse sicherzustellen.
4. Ergebnisse: Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse der deskriptiven und multivariaten Analysen. Es werden sowohl statistische Kennzahlen als auch graphische Darstellungen verwendet um die Befunde anschaulich zu machen. Die Ergebnisse der logistischen Regressionen werden detailliert diskutiert und im Kontext der Forschungsfragen interpretiert. Der Fokus liegt auf der Analyse der Zusammenhänge zwischen den unabhängigen und abhängigen Variablen.
Schlüsselwörter
Partnerwahl, China, arrangierte Ehe, gesellschaftlicher Wandel, Urbanisierung, Modernisierung, Genderrollen, Bildung, Einkommen, Stadt-Land-Unterschied, Individualisierung, Heiratsmarkt, logistische Regression.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Partnerwahl in China
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den Wandel der Partnerwahl in China und analysiert den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen und individueller Faktoren auf die Entscheidungsfindung im Heiratskontext. Dabei werden sowohl makro- als auch mikroökonomische Perspektiven berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss historischer und gesellschaftlicher Entwicklungen auf die Partnerwahl, der Rolle der Urbanisierung und des wirtschaftlichen Wandels, dem Vergleich der Partnerwahl zwischen städtischen und ländlichen Regionen, der Bedeutung von Genderrollen und individuellen Merkmalen (Bildung, Einkommen) sowie der zunehmenden Autonomie bei der Partnerwahl in jüngeren Generationen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Forschungshintergrund, Forschungsfragen, Begriffsdefinitionen), Theoretischer Hintergrund (Makro- und Mikroebene im chinesischen Kontext), Daten und Methoden (Datenbasis, Operationalisierung der Variablen), Ergebnisse (deskriptive und multivariate Analysen) und Fazit (Zusammenfassung, Limitationen, Ausblick).
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet quantitative Methoden. Die Datenbasis wird im Kapitel 3 detailliert beschrieben. Die Analyse umfasst deskriptive Statistiken und multivariate Verfahren wie binäre und generalisierte ordinale logistische Regressionen, um die Zusammenhänge zwischen den untersuchten Variablen zu analysieren.
Welche Variablen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl abhängige Variablen (bezogen auf die Partnerwahlentscheidung) als auch unabhängige Variablen (gesellschaftliche Faktoren wie Urbanisierung, wirtschaftlicher Wandel, Genderrollen und individuelle Faktoren wie Bildung und Einkommen).
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der deskriptiven und multivariaten Analysen. Die Ergebnisse der logistischen Regressionen werden detailliert diskutiert und im Kontext der Forschungsfragen interpretiert. Der Fokus liegt auf der Analyse der Zusammenhänge zwischen den unabhängigen und abhängigen Variablen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen, benennt Limitationen der Studie und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen. Es wird die Bedeutung der Ergebnisse für das Verständnis des Wandels der Partnerwahl in China im Kontext von Modernisierung und Urbanisierung herausgestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Partnerwahl, China, arrangierte Ehe, gesellschaftlicher Wandel, Urbanisierung, Modernisierung, Genderrollen, Bildung, Einkommen, Stadt-Land-Unterschied, Individualisierung, Heiratsmarkt, logistische Regression.
Wo finde ich die detaillierten Informationen?
Die detaillierten Informationen zu Methodik, Daten und Ergebnissen finden sich in den jeweiligen Kapiteln der Bachelorarbeit.
- Quote paper
- Sirui Cheng (Author), 2019, Die Partnerwahl in China im Wandel. Zwischen Arrangement und Autonomie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/994220