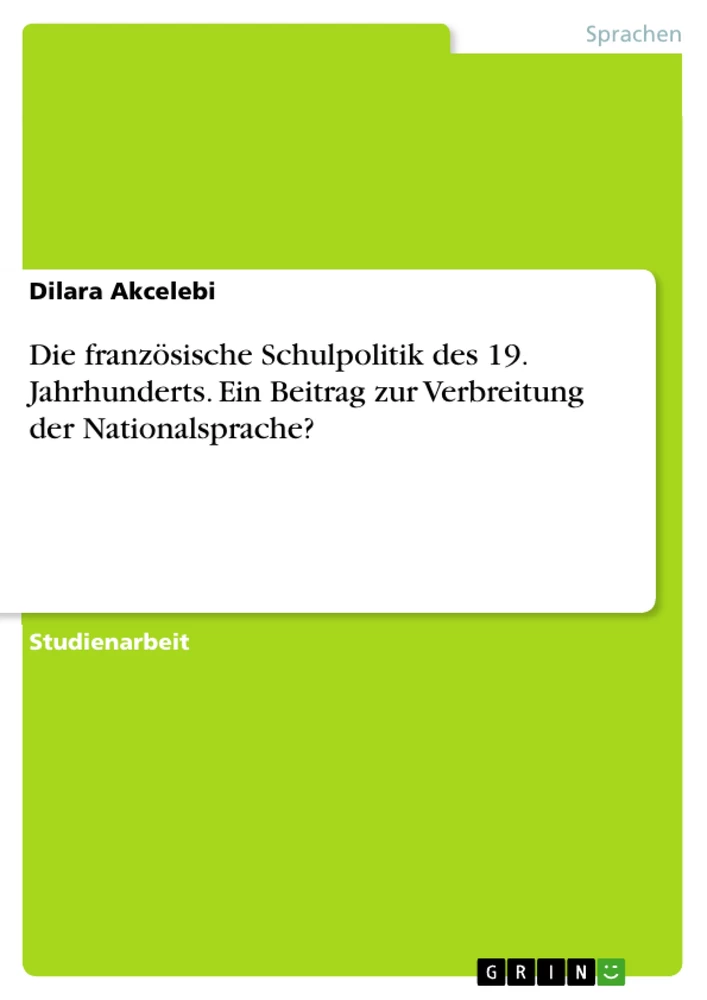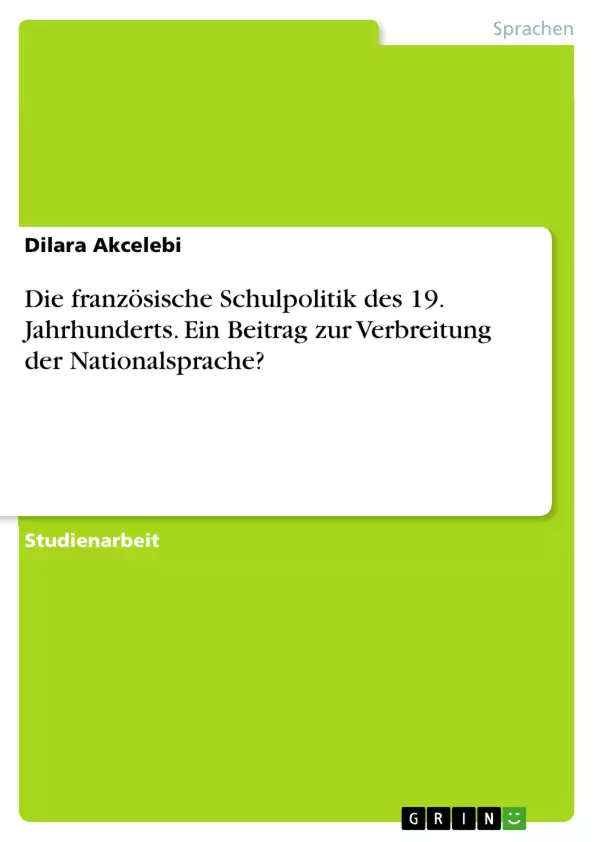In dieser Arbeit geht es primär um die Frage, welche Maßnahmen in der Schulpolitik der 3. Republik ergriffen wurden, um die französische Sprache als einheitliche Sprache der Nation durchzusetzen und gleichzeitig die vielen Regionalsprachen zu unterdrücken.
Zunächst wird am Anfang dieser Arbeit kurz dennoch präzise auf die Frage eingegangen, welche Rolle die französische Standardsprache während und nach der Französischen Revolution spielte und wie der Wunsch einer Einheit aufkam. Im zweiten Teil dieser Hausarbeit wird die Sprachpolitik des 19. Jahrhunderts näher beleuchtet, unter anderem mit Bezugnahme auf den damaligen französischen Ministerpräsidenten Jules Ferry, der mit seiner Politik einen bedeutsamen auf das Schulwesen hatte. Anschließend werden dem Leser wesentliche Änderungen innerhalb der Schulpolitik, d.h. neue Gesetzgebungen, aufgelistet und deren Einfluss auf die Durchsetzung einer Nationalsprache erläutert. Gleichzeitig soll aufgezeigt werden, inwiefern die vielen Regionalsprachen Frankreichs nachteilig behandelt wurden und neben der französischen Standardsprache verdrängt wurden.
Im Schlussteil dieser Arbeit werden die Ergebnisse der Untersuchung, mit welchen Mitteln Frankreich es schaffte, die Französische Standardsprache als Nationalsprache durchzusetzen, zusammengefasst und gewichtet. Des Weiteren wird die Aussagekraft dieser Ergebnisse beurteilt und eine Hypothese aufgestellt, welche Auswirkungen die Änderungen des Schulwesens des 19. Jahrhunderts auf das 20. Jahrhundert hatten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Sprachpolitische Auswirkungen der Revolution
- Nationenbegriff
- Nationalsprache im nachrevolutionären Frankreich
- Sprach-und Schulpolitik zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- Das Schulsystem- Von der Restauration bis zur Zweiten Republik
- Jules Ferry- Schulreform und Gesetzgebungen der Dritten Republik
- Verdrängung der Regionalsprachen
- Schluss
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Rolle der französischen Schulpolitik des 19. Jahrhunderts in der Verbreitung der Nationalsprache. Sie untersucht, wie das Schulsystem zur Durchsetzung der französischen Standardsprache beitrug und gleichzeitig die Regionalsprachen Frankreichs verdrängte.
- Sprachpolitische Auswirkungen der Französischen Revolution
- Der Nationenbegriff im 19. Jahrhundert
- Die Entwicklung der französischen Standardsprache als Nationalsprache
- Die Schulpolitik der Dritten Republik unter Jules Ferry
- Die Verdrängung der Regionalsprachen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Bedeutung der französischen Sprache und beleuchtet den Einfluss der Französischen Revolution auf die gesellschaftspolitischen Veränderungen in Frankreich. Sie führt den Wunsch nach einer nationalen Einheit und die Bedeutung der Alphabetisierung als Grundlage für die Durchsetzung der Standardsprache ein.
Der Hauptteil befasst sich zunächst mit den sprachpolitischen Auswirkungen der Revolution und dem Entstehen des Nationenbegriffs. Anschließend wird die Sprachpolitik des 19. Jahrhunderts, insbesondere die Schulreformen von Jules Ferry, analysiert und deren Auswirkungen auf die Durchsetzung der französischen Standardsprache und die Verdrängung der Regionalsprachen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen französische Standardsprache, Nationalsprache, Sprachpolitik, Schulpolitik, Regionalsprachen, Französische Revolution, Jules Ferry, Alphabetisierung, Nation und nationale Identität. Sie analysiert die Rolle des Schulwesens im 19. Jahrhundert in der Durchsetzung der französischen Standardsprache und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die sprachliche Vielfalt Frankreichs.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde Französisch zur einheitlichen Nationalsprache?
Dies geschah vor allem durch gezielte schulpolitische Maßnahmen im 19. Jahrhundert, die Französisch als Unterrichtssprache vorschrieben und Regionalsprachen unterdrückten.
Welche Rolle spielte Jules Ferry in der Schulpolitik?
Jules Ferry führte als Ministerpräsident Reformen ein, die die Grundschule kostenlos, laizistisch und verpflichtend machten, was die Verbreitung der Standardsprache massiv beschleunigte.
Warum wollte man die Regionalsprachen verdrängen?
Eine einheitliche Sprache galt als Voraussetzung für die nationale Einheit und die Festigung des republikanischen Nationenbegriffs nach der Revolution.
Wann entstand der Wunsch nach einer sprachlichen Einheit in Frankreich?
Der Wunsch kam massiv während und nach der Französischen Revolution auf, um die „eine und unteilbare Republik“ auch sprachlich zu manifestieren.
Was war die Folge der Alphabetisierung für die Dialekte?
Durch die allgemeine Schulpflicht und Alphabetisierung in der Standardsprache wurden lokale Patois (Dialekte) zunehmend in den privaten Bereich verdrängt und verloren an Bedeutung.
Welche Auswirkungen hatte die Schulpolitik des 19. auf das 20. Jahrhundert?
Die Maßnahmen führten dazu, dass im 20. Jahrhundert Französisch nahezu universell als Muttersprache in Frankreich etabliert war, während Regionalsprachen oft vom Aussterben bedroht waren.
- Quote paper
- Dilara Akcelebi (Author), 2018, Die französische Schulpolitik des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Verbreitung der Nationalsprache?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/994310