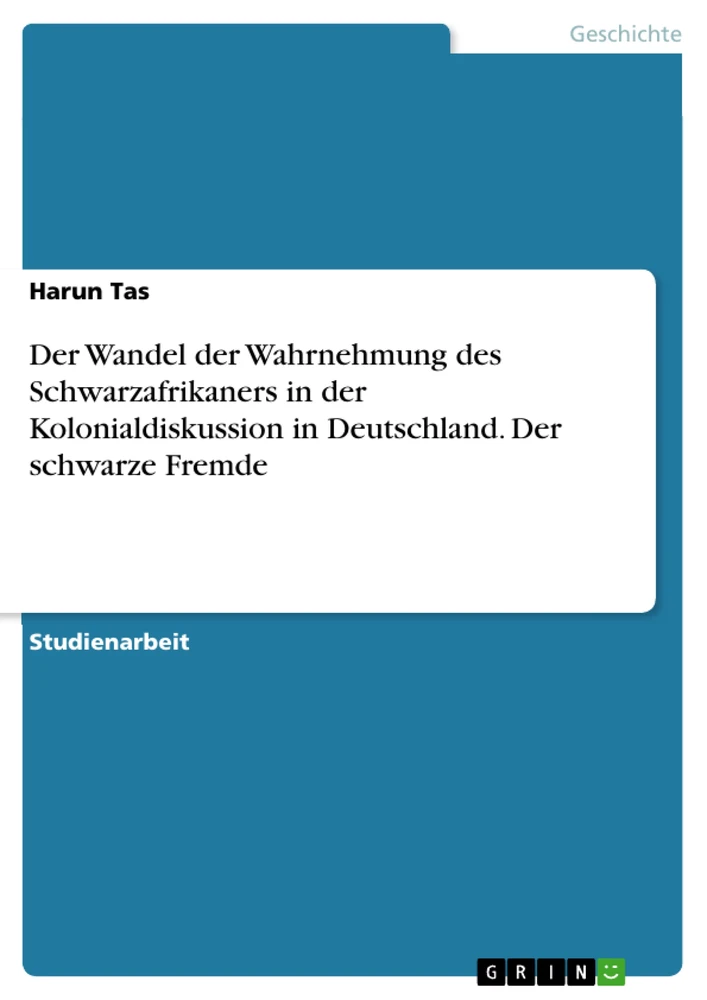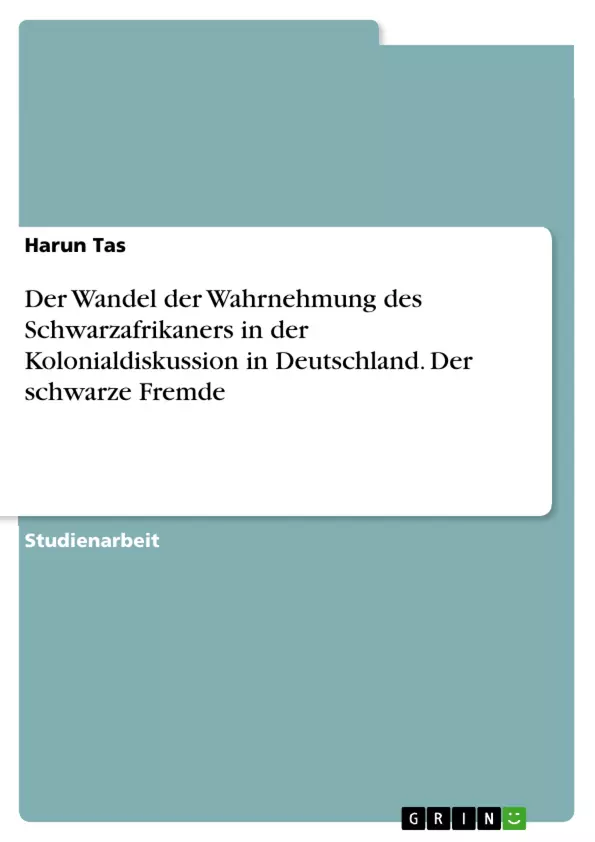Diese Hausarbeit wird den Wandel des Fremdbildes beziehungsweise die Argumentationen der Kolonialdiskussion zwischen den 1870er bis 1930er-Jahren unter Berücksichtigung von historischen Ereignissen analysieren.
In den vierziger Jahren des 18. Jahrhunderts setzte im Deutschen Reich eine Welle kolonialer Begeisterung ein. Die Aufteilung Afrikas zum Ende des 19. Jahrhunderts gehört zu den spektakulärsten Ereignissen der europäischen Expansionsgeschichte. So forderte Richard Wagner, Komponist und Schriftsteller, in seiner Rede im Dresdener Vaterlandsverein am 15. Juni 1848 die Deutschen auf, sich wie die anderen europäischen Mächte, an der Aufteilung der Welt zu beteiligen beziehungsweise Kolonien in Übersee anzueignen. Ein deutsches Kolonialreich existierte nur kurzzeitig. So plötzlich und unerwartet, wie die deutschen Annexionen von 1884 in Afrika den Grundstein für ein Reich in Übersee legten, so fand dieses sein schnelles Ende im Ersten Weltkrieg. Trotz der kurzen Dauer der deutschen Kolonialgeschichte, war diese Zeit geprägt von ständiger Reproduktion und Konstruktion von der Differenz zwischen Weiß und Schwarz bzw. vom Bild des Schwarzafrikaners.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Ausgangssituation
- Die Begründung der Möglichkeit der Kulturmission in der Aufklärung
- Vorkoloniale Diskussionen 1870-1880: Das Bild des Schwarzafrikaners in der Legitimation kolonialer Expansion
- Die Abschaffung des Sklavenhandels als historische Schnittstelle zu einem neuartigen System der Ausbeutung
- Kolonialismus ohne Kolonien: Kolonialer Revisionismus im ersten Weltkrieg und in der Weimarer Republik
- Von der Stereotypisierung zur Wahrnehmung des Anderen: Psychologische Menschenführung und deutsche Kolonialpolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den Wandel des Fremdbildes und die Argumentationen in der Kolonialdiskussion zwischen den 1870er und 1930er Jahren unter Berücksichtigung von historischen Ereignissen. Der Fokus liegt auf der Konstruktion des Bildes des Schwarzafrikaners und seiner Bedeutung für die Legitimation des deutschen Kolonialismus.
- Historische Voraussetzungen und Entstehungsbedingungen der deutschen Kolonialbewegung
- Die Rolle der Aufklärung im Diskurs über Afrika und die Konstruktion des "Anderen"
- Die Entwicklung des Bildes des Schwarzafrikaners in der kolonialen Propaganda und Debatte
- Die Legitimation des Kolonialismus durch rassistische Ideologien und wissenschaftliche Theorien
- Der Einfluss des Kolonialismus auf die afrikanische Gesellschaft und Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik der deutschen Kolonialgeschichte ein und erläutert die Intention und den Fokus der Arbeit.
- Das Kapitel "Historische Ausgangssituation" beschreibt die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Hintergründe, die zur Entstehung der deutschen Kolonialbewegung führten. Die Arbeit erläutert den Prozess der Industrialisierung in Deutschland, die daraus resultierenden sozialen Probleme und die Bedeutung der „sozialen Frage“ für die koloniale Argumentation.
- Das Kapitel "Die Begründung der Möglichkeit der Kulturmission in der Aufklärung" analysiert die Rolle der Aufklärung im europäischen Diskurs über Afrika und die Konstruktion des "Anderen". Es beleuchtet die Entwicklung des Afrikabildes von der Antike bis zum 19. Jahrhundert und zeigt, wie das Bild des Schwarzafrikaners in den Vordergrund der kolonialen Legitimation gerückt wird.
- Das Kapitel "Vorkoloniale Diskussionen 1870-1880: Das Bild des Schwarzafrikaners in der Legitimation kolonialer Expansion" widmet sich der Analyse der frühen Kolonialdebatte in Deutschland und der Entwicklung rassistischer Ideologien, die zur Legitimation der kolonialen Expansion dienten. Hierbei wird der Fokus auf die Darstellung des Schwarzafrikaners als „Wilden“ und seine Rolle in der kolonialen Propaganda gelegt.
- Das Kapitel "Die Abschaffung des Sklavenhandels als historische Schnittstelle zu einem neuartigen System der Ausbeutung" untersucht die Auswirkungen der Abschaffung des Sklavenhandels auf die Entwicklung des Kolonialismus und die Veränderung des Afrikabildes. Es zeigt, wie die Abkehr vom Sklavenhandel zu einer neuen Form der Ausbeutung durch den Kolonialismus führte.
- Das Kapitel "Kolonialismus ohne Kolonien: Kolonialer Revisionismus im ersten Weltkrieg und in der Weimarer Republik" analysiert die Entwicklung der Kolonialpolitik in Deutschland während des Ersten Weltkriegs und in der Weimarer Republik. Es zeigt, wie die deutschen Kolonialambitionen trotz des Verlusts der Kolonien weiterlebten und sich in neuen Formen manifestierten.
- Das Kapitel "Von der Stereotypisierung zur Wahrnehmung des Anderen: Psychologische Menschenführung und deutsche Kolonialpolitik" analysiert die Konstruktion des Bildes des Schwarzafrikaners in der kolonialen Psychologie und Pädagogik. Es zeigt, wie die Deutschen versuchten, den Schwarzafrikaner zu "zivilisieren" und in das koloniale System zu integrieren.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themengebiete der Arbeit sind deutsche Kolonialgeschichte, Afrikabild, Rassismus, Kolonialideologie, Kulturmission, Schwarzafrikaner, Kolonialpolitik, Imperialismus, Psychologische Menschenführung und koloniale Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte sich das Bild des Schwarzafrikaners in Deutschland?
Das Bild wandelte sich von vorkolonialen Diskussionen über die Aufklärung bis hin zur rassistischen Stereotypisierung zur Legitimation der Kolonialpolitik.
Welche Rolle spielte die Aufklärung bei der Kolonialdiskussion?
Die Aufklärung lieferte die theoretische Basis für die „Kulturmission“, indem sie die Notwendigkeit einer „Zivilisierung“ des afrikanischen „Anderen“ konstruierte.
Was war der „Koloniale Revisionismus“ in der Weimarer Republik?
Trotz des Verlusts der Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg lebten koloniale Ambitionen und Bilder in Deutschland weiter und wurden politisch instrumentalisiert.
Wie wurde der Kolonialismus psychologisch legitimiert?
Durch „psychologische Menschenführung“ wurde versucht, Afrikaner in das koloniale System zu integrieren und ihr Verhalten nach westlichen Normen zu formen.
Welchen Einfluss hatte Richard Wagner auf die Kolonialbegeisterung?
Wagner forderte bereits 1848, dass Deutschland sich wie andere Mächte an der Aufteilung der Welt beteiligen und Überseekolonien erwerben solle.
- Citation du texte
- Harun Tas (Auteur), 2018, Der Wandel der Wahrnehmung des Schwarzafrikaners in der Kolonialdiskussion in Deutschland. Der schwarze Fremde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/994721