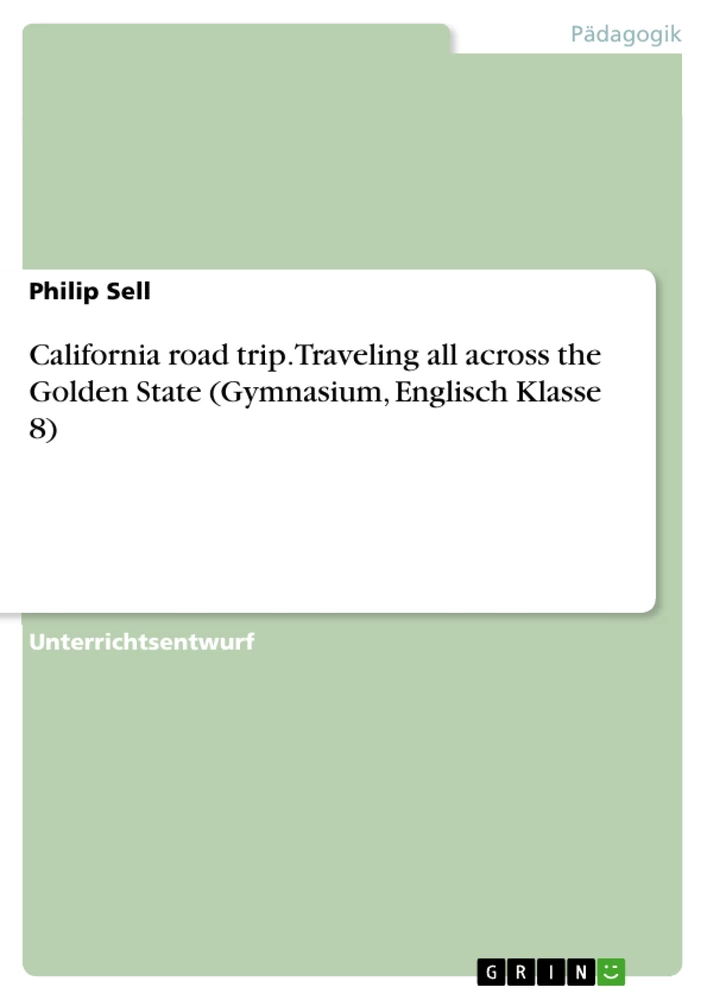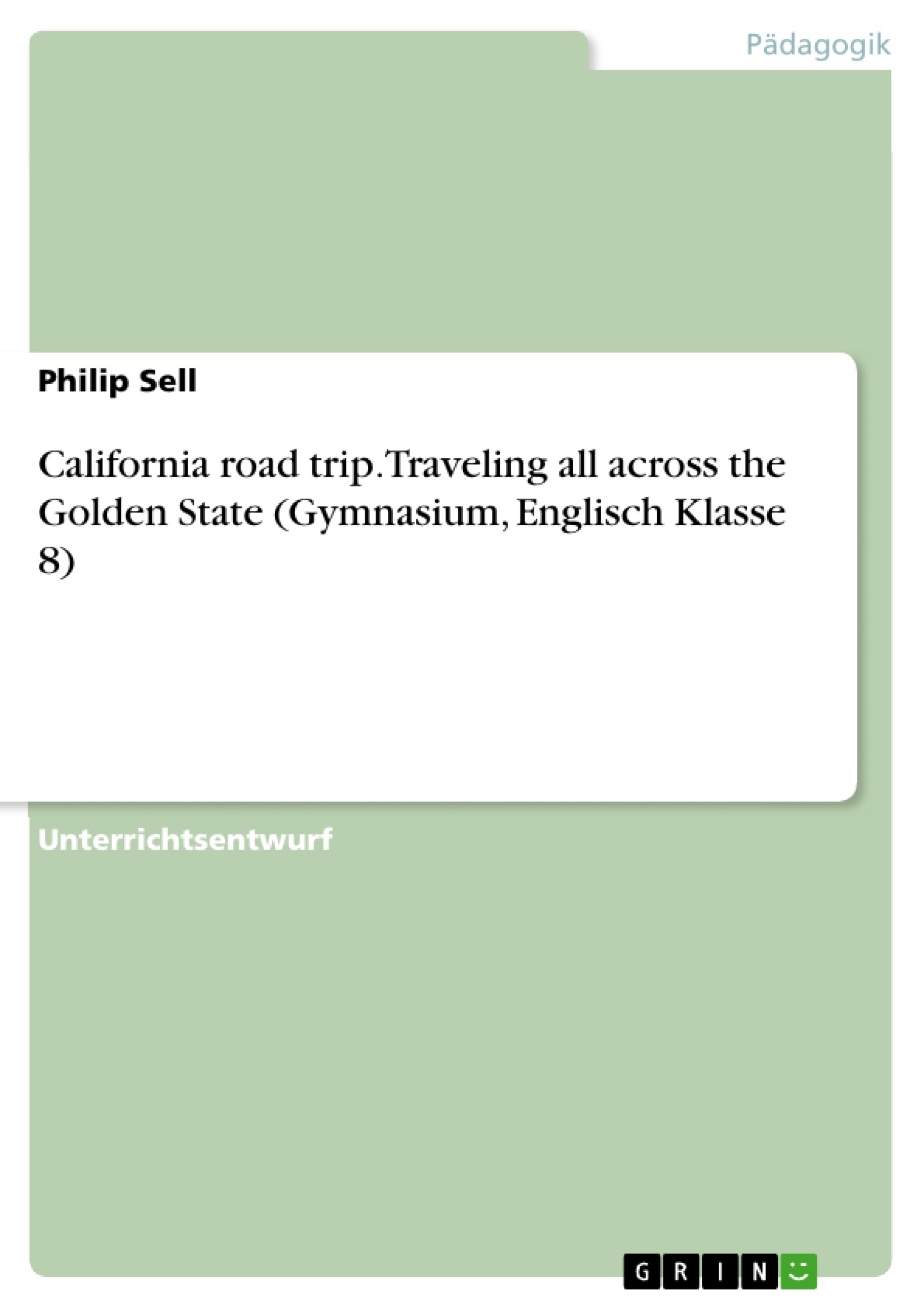Die Unterrichtssequenz "California road trip – traveling all across the Golden State" behandelt verschiedene geografische, gesellschaftliche und alltagskulturelle Aspekte des Bundesstaats Kalifornien. Die im Zentrum der vorliegenden Unterrichtsstunde stehende Auseinandersetzung mit den Grundlagen der amerikanischen Geschichte ist im Fachlehrplan des Landes Sachsen-Anhalt für die Schuljahrgänge 7/8 innerhalb des Kompetenzbereichs "Verfügung über soziokulturelles Orientierungswissen" thematisch fest verankert. Dabei steht die hier zu behandelnde Geschichte Kaliforniens exemplarisch und stellvertretend für die Entwicklung und den Aufstieg der Vereinigten Staaten zur Weltmacht sowie für verschiedene Phasen der amerikanischen Einwanderungsbewegung.
Kalifornien ist mit ca. 40 Millionen Einwohnern der mit Abstand bevölkerungsreichste Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Auf eine solche Entwicklung deutete jedoch vor rund 200 Jahren nur wenig hin. Nach der mexikanischen Unabhängigkeit im Jahr 1821 wurde Kalifornien zur abseits gelegenen Nordprovinz Mexikos deklariert. Die USA, ihrer Zeit bestrebt das Staatsgebiet Richtung Südwesten auszudehnen, machte Mexiko 1845 ein Kaufangebot für Kalifornien, welches jedoch abgelehnt wurde. Im Zuge des Mexikanisch-Amerikanischen-Krieges (1846-1848) proklamierten amerikanische Siedler im Mai 1846 die Unabhängigkeit der Kalifornischen Republik, ehe sie sich kurze Zeit später der Union der Vereinigten Staaten anschlossen. Zu dieser Zeit war Kalifornien mit ca. 150.000 Einwohnern dünn besiedelt. Große Rinderfarmen, die sogenannten Ranchos, prägten das damalige Erscheinungsbild, ein Umstand der sich alsbald ändern sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Lerngruppenbeschreibung
- Sachanalyse
- Didaktische Überlegungen
- Kompetenzentwicklung und Lernziele
- Methodische Entscheidungen
- Stundenverlaufsplanung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsentwurf hat zum Ziel, die Schüler der 8. Klasse mit der Geschichte Kaliforniens vertraut zu machen und ihnen so einen Einblick in die kulturelle Entwicklung des Bundesstaates zu ermöglichen. Dabei werden verschiedene historische Epochen beleuchtet und die Bedeutung Kaliforniens als kultureller Schmelztiegel hervorgehoben.
- Kaliforniens Entwicklung von der mexikanischen Provinz zur US-amerikanischen Republik
- Der Goldrausch als einflussreicher Wendepunkt in der Geschichte Kaliforniens
- Der Aufstieg Hollywoods zur Filmweltmetropole
- Die Hippie-Kultur der 1960er Jahre und ihr Einfluss auf Kalifornien
- Kalifornien als Symbol für Träume und neue Anfänge
Zusammenfassung der Kapitel
Lerngruppenbeschreibung
Dieser Abschnitt beschreibt die heterogene Lerngruppe mit ihren unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die unterschiedlichen sprachlichen Fähigkeiten der Schüler gelegt, wobei die Herausforderungen der eher passiven Schüler hervorgehoben werden.
Sachanalyse
Dieser Abschnitt beleuchtet die Geschichte Kaliforniens von seinen Anfängen als mexikanische Provinz bis hin zur Entwicklung zum bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA. Der Goldrausch von 1848 und seine Folgen sowie der Aufstieg Hollywoods als Zentrum der Filmindustrie werden als prägende Epochen beschrieben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Kalifornien, Geschichte, Entwicklung, Goldrausch, Hollywood, Hippie-Kultur, USA, Kultur, Schmelztiegel.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich Kalifornien historisch?
Kalifornien war ursprünglich eine dünn besiedelte Nordprovinz Mexikos. Nach dem Mexikanisch-Amerikanischen Krieg (1846-1848) schlossen sich amerikanische Siedler der Union an, was den Grundstein für den bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA legte.
Welche Bedeutung hatte der Goldrausch für Kalifornien?
Der Goldrausch von 1848 war ein entscheidender Wendepunkt, der zu einer massiven Einwanderungswelle führte und die wirtschaftliche sowie soziale Struktur des Staates nachhaltig veränderte.
Warum wird Kalifornien als „kultureller Schmelztiegel“ bezeichnet?
Durch verschiedene Einwanderungsbewegungen, die Geschichte als mexikanische Provinz und globale Einflüsse wie Hollywood hat sich Kalifornien zu einem Ort entwickelt, an dem viele Kulturen aufeinandertreffen.
Welche Rolle spielte die Hippie-Kultur der 1960er Jahre?
Die Hippie-Kultur prägte das gesellschaftliche Bild Kaliforniens als Symbol für Freiheit, Träume und gesellschaftliche Umbrüche, was bis heute Teil der kulturellen Identität des Staates ist.
Was sind die Lernziele dieses Unterrichtsentwurfs?
Schüler der 8. Klasse sollen soziokulturelles Orientierungswissen über die USA erwerben, indem sie die Geschichte Kaliforniens von den Anfängen bis zum Aufstieg Hollywoods kennenlernen.
- Quote paper
- Philip Sell (Author), 2021, California road trip. Traveling all across the Golden State (Gymnasium, Englisch Klasse 8), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/994844