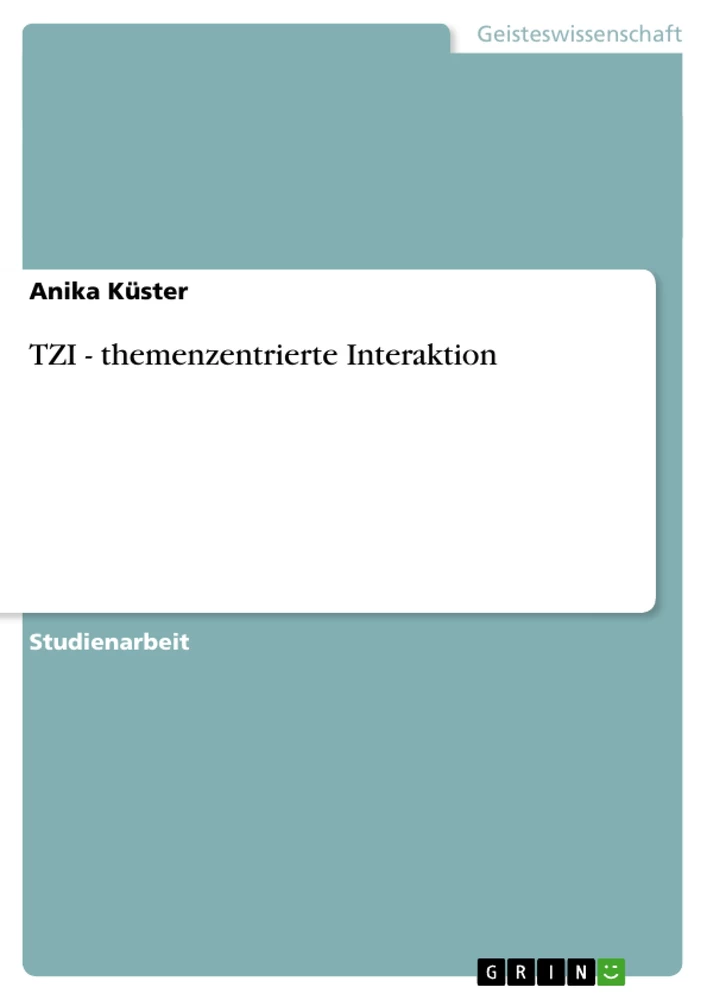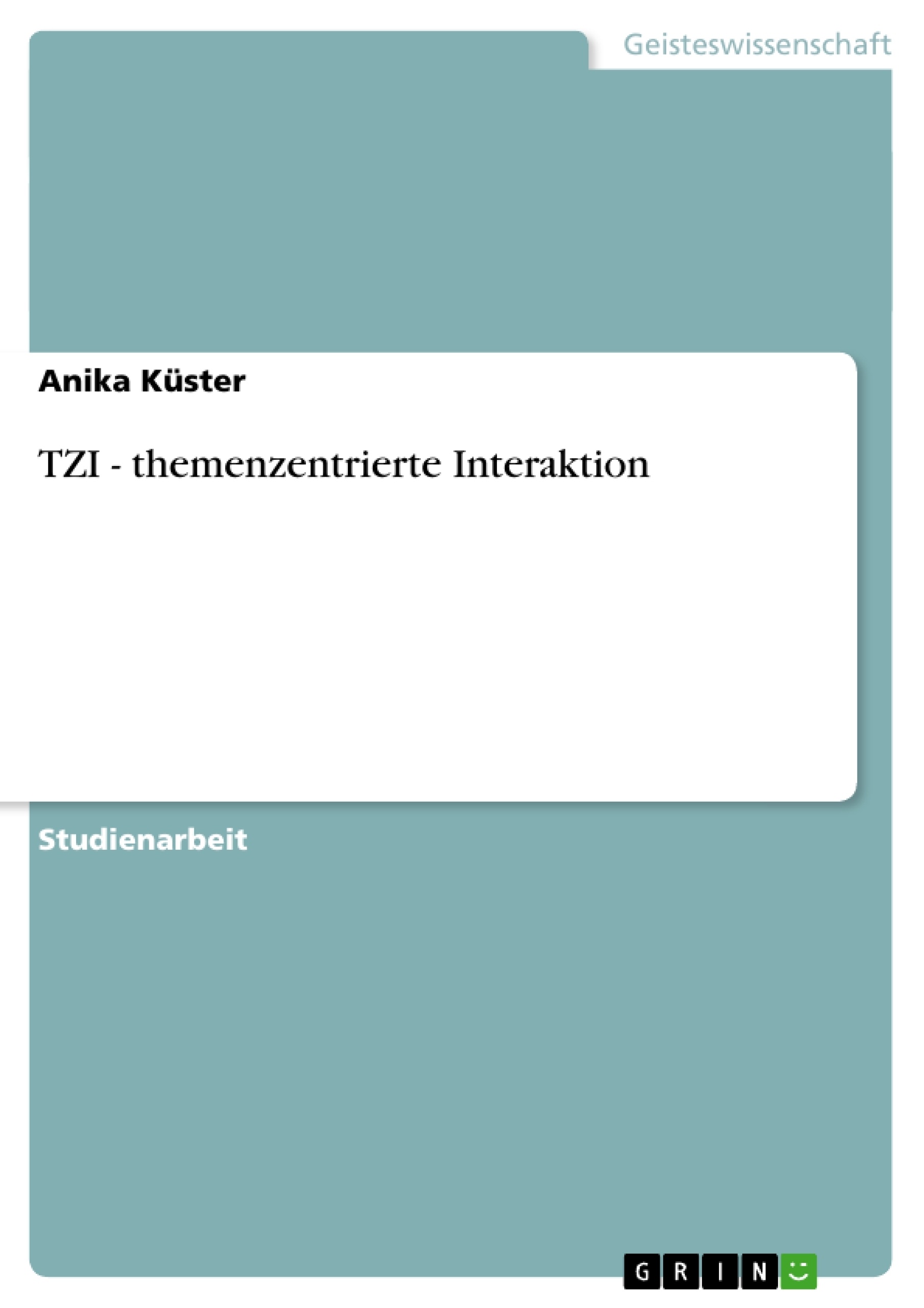TZI - themenzentrierte Interaktion
Quelle: Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion, Ruth C. Cohn, Klett-Cotta Verlag Stuttgart 1997
(1) zur Person
- Ruth Cohn wurde 1912 in Berlin geboren
- Ruth Cohn verließ Deutschland 1933, lebte in Zürich bis sie 1940 nach New York flüchtete
- Erst 1974 kehrt sie nach Europa zurück
- Studierte Psychologie in Berlin und Zürich
- Die Psychoanalytikerin interessiert sich besonders für das Problem der Gegenübertragung
(2) zur Entstehung der TZI
- von Zürich bzw. später von New York aus verfolgt sie die Geschehnisse in Deutschland, dass eine Mehrheit eine Minderheit unterdrückt und sogar tötet
- diese Form der Unterdrückung - das „Wir“ und „Die-da“ - gibt es immer wieder auf der Welt, viele Menschen werden unterdrückt und leiden darunter
- Ruth Cohn möchte vielen Menschen helfen, sie sieht ihre Möglichkeiten als Psychoanalytikerin darin sehr beschränkt ( Psychoanalyse kann immer nur einen Menschen behandeln, außerdem dauert es sehr lange bis sich ein Erfolg einstellt.)
- Versuch, pädagogisch-therapeutische Elemente in Schulunterricht und andere Kommunikationsgruppen einzubeziehen
- Besonderes Anliegen: eine Methode finden, welche dem Erziehungswesen zugute kommt
- Studenten empfinden Vorlesungen in Hörsälen oft als langweilig und trocken
- Gefühle finden in Schulklassen oder anderen Gruppen keinen (angemessenen) Platz
- Die Anfänge der TZI bildeten sich während eines Seminars zum Thema „Gegenübertragung“ aus (1955)
- Von der Einzelfallhilfe zur Gruppenarbeit
(3) Regeln der TZI
- zwei Postulate:
1. Sei dein eigener Chairman, der Chairman deiner selbst.
2. Beachte Hindernisse auf deinem Weg, deine eigenen und die von anderen. Störungen haben Vorrang.
- unterst ü tzende Hilfsregeln:
1. Vertritt dich selbst in deinen Aussagen; sprich per „Ich“ und nicht per „Wir“ oder per „Man“.
2. Wenn du eine Frage stellst, sage, warum du fragst und was deine Frage für dich bedeutet. Sage dich selbst aus und vermeide das Interview.
3. Sei authentisch und selektiv in deinen Kommunikationen. Mache dir bewusst, was du denkst und fühlst, und wähle, was du sagst und tust.
4. Halte dich mit Interpretationen von anderen so lange wie möglich zurück. Sprich statt dessen deine persönlichen Reaktionen aus.
5. Sei zurückhaltend mit Verallgemeinerungen.
6.Wenn du etwas über das Benehmen oder die Charakteristik eines anderen Teilnehmers aussagst, sage auch, was es dir bedeutet, dass er so ist, wie er ist (d.h. wie du ihn siehst).
7. Seitengespräche haben Vorrang. Sie stören und sind meist wichtig. Sie würden nicht geschehen, wenn sie nicht wichtig wären (Vielleicht wollt ihr uns erzählen, was ihr miteinander sprecht?).
8. Nur einer zur gleichen Zeit bitte.
9. Wenn mehr als einer gleichzeitig sprechen will, verständigt euch in Stichworten, über was ihr zu sprechen beabsichtigt.
(4) Merkmale der TZI
- TZI besitzt eine definitive Struktur, jedoch haben die Teilnehmer zu Anfang meist das Gefühl zu großer Freiheit
- Anzahl der Zusammenkünfte sowie Zeitspanne, Ort usw. werden vorher festgelegt
- Thema muss Notwendigkeit oder Interessen der Gruppe entsprechen
- Titel des Themas beeinflusst die innere Einstellung der Teilnehmer (z.B. „Probleme mit...“ oder „Überwindung von Problemen mit...“)
- TZI versucht die drei Instanzen ES, ICH und WIR in einer Balance zu halten
- Wenn einer der drei Instanzen zu sehr in den Mittelpunkt des Geschehens rückt, greift der/die Gruppenleiter/in ein (in einem fortgeschrittenen Stadium überprüft die Gruppe das selbständig)
- Einzelner (ICH), Gruppe (WIR) und Thema (ES) werden gleichberechtigt nebeneinander gestellt (klassischer Frontalunterricht ist ausschließlich am Thema interessiert)
- Gruppenatmosphäre ist akzeptierend
(5) Nutzen der TZI
- TZI dient Pädagogen, Sozialarbeitern, Beratern jeglicher Art, Therapeuten usw. dazu, sich selbst und ihre Gruppe zu leiten
- Lebendigkeit gruppentherapeutischen Lernens hat mit persönlichem Befinden des Einzelnen zu tun
- Gruppe ist persönlich beteiligt, wenn der Redner von sich selbst spricht und man seine Gefühlsregungen wahrnehmen kann
- Alternative zum klassischen Frontalunterricht
Häufig gestellte Fragen
Was ist TZI (Themenzentrierte Interaktion) laut Ruth C. Cohn?
TZI ist eine Methode, die von Ruth C. Cohn entwickelt wurde und auf den Prinzipien der Psychoanalyse basiert, aber für Gruppenarbeit angepasst ist. Sie zielt darauf ab, die Balance zwischen dem Individuum (ICH), der Gruppe (WIR) und dem Thema (ES) zu halten.
Wer war Ruth Cohn?
Ruth Cohn war eine in Berlin geborene Psychoanalytikerin (1912). Sie floh 1933 aus Deutschland und lebte in Zürich und New York, bevor sie 1974 nach Europa zurückkehrte. Sie interessierte sich besonders für die Gegenübertragung und suchte nach Wegen, psychoanalytische Prinzipien in der Pädagogik und Gruppenarbeit anzuwenden.
Wie ist die TZI entstanden?
Die TZI entstand aus Ruth Cohns Beobachtung der Unterdrückung von Minderheiten in Deutschland und ihrem Wunsch, mehr Menschen zu helfen, als es in der Einzeltherapie möglich war. Sie wollte pädagogisch-therapeutische Elemente in den Schulunterricht und andere Gruppen einbeziehen, um Gefühlen einen angemessenen Platz zu geben.
Welche Regeln gelten in der TZI?
Die TZI basiert auf zwei Postulaten: "Sei dein eigener Chairman, der Chairman deiner selbst" und "Beachte Hindernisse auf deinem Weg, deine eigenen und die von anderen. Störungen haben Vorrang." Es gibt auch unterstützende Hilfsregeln wie das Sprechen in der Ich-Form, das Vermeiden von Interpretationen und Verallgemeinerungen, das Beachten von Seitengesprächen und das Reden nur einer Person zur gleichen Zeit.
Welche Merkmale zeichnen die TZI aus?
Die TZI hat eine definitive Struktur, die aber den Teilnehmern anfangs eine große Freiheit vermittelt. Die Anzahl der Zusammenkünfte, die Zeitspanne, der Ort usw. werden im Voraus festgelegt. Das Thema muss den Bedürfnissen oder Interessen der Gruppe entsprechen. TZI versucht die drei Instanzen ES, ICH und WIR in einer Balance zu halten. Eine akzeptierende Gruppenatmosphäre ist dabei wichtig.
Was ist der Nutzen der TZI?
TZI dient Pädagogen, Sozialarbeitern, Beratern, Therapeuten usw. dazu, sich selbst und ihre Gruppe zu leiten. Sie fördert lebendiges gruppentherapeutisches Lernen durch die persönliche Beteiligung der Teilnehmer und bietet eine Alternative zum klassischen Frontalunterricht.
- Quote paper
- Anika Küster (Author), 2001, TZI - themenzentrierte Interaktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99486